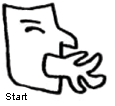


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Nachrichten rund um die Rechtschreibreform
Zur vorherigen / nächsten Nachricht
Zu den Kommentaren zu dieser Nachricht | einen Kommentar dazu schreiben
18.12.2007
Stefan Stirnemann
„Ich habe gemacht ein feines Geschäft“
Ein Wort über Ludwig Reiners, den Klassiker der Stilkunst
Eduard Engel, Autor des klassischen Werkes „Deutsche Stilkunst“ und im Dritten Reich als Jude verfemt, verdient einen ehrenvollen Platz in der Geschichte der Stillehre. Ludwig Reiners, Mitglied der NSDAP und Hochstapler, gab 1944 eine „eigene“ „Deutsche Stilkunst“ heraus.
Wer einen guten Stil schreiben will, braucht Begabung und Anleitung. Als beste Anleitung gilt seit 60 Jahren die «Stilkunst» von Ludwig Reiners. Die Bearbeiter der neuesten Ausgabe rühmen, sie sei ein Klassiker geworden, scheine unersetzlich und werde es nach menschlichem Ermessen noch lange bleiben. Was macht Reiners unersetzlich? Wohl seine schöpferische Idee, sein Stil und die Fülle der Kenntnisse. Reiners belehrt, aber unakademisch; er verbindet Wissenschaft mit Unterhaltung. Die Begriffe, die er verwendet, sind anschaulich und kräftig: Stopfstil, Stilschlamperei, Bandwurmsatz, Stilgecken, Schreistil, Menschenrede, die etwas anderes ist als bedrucktes Papier. Er zeigt, was die Meister des Satzbaus über Sprache und Stil sagten: Quintilian, Lessing, Schopenhauer. Die Fehler führt er an Beispielen aus Zeitung und Literatur vor. Und was kennt Reiners nicht alles: die griechischen Redner, Tacitus, das Nibelungenlied, Goethes Gespräche, entlegene Stellen aus Tieck und Droste-Hülshoff. Auch Victor Hugo und Mark Twain hat er im Blick.
Wer war dieser kenntnisreiche Ludwig Reiners (1896–1957)? Nach dem Bericht eines Freundes, des Schriftstellers Eugen Roth, leitete er in München eine Nähfaden-Fabrik und gab in seiner Freizeit Bücher heraus. Sein klassisches Werk erschien 1944 unter dem vollen Titel «Deutsche Stilkunst». Woher hat Reiners seine Idee, seinen Stil, sein Wissen? Er hatte keine Idee, keinen Stil und weder Zeit noch Fähigkeit zu Studien; er stellte sein Buch aus anderen Büchern zusammen und plünderte vor allem die «Deutsche Stilkunst» eines wahrhaft klassischen Autors, des wegen seiner jüdischen Herkunft entrechteten Eduard Engel. Was Reiners auszeichnet, stammt von Engel.
Eduard Engel (1851–1938) mit wenigen Worten vorzustellen ist unmöglich. Er war eine Persönlichkeit des literarischen Lebens und verfasste Literaturgeschichten verschiedener Sprachen. Ihm lag am reinen Ausdruck, er verabscheute Fremdwörter; das trug ihm den Titel eines Puristen ein. Er liebte sein deutsches Vaterland und schrieb in dieser Haltung auch Sätze, mit denen man sich abfinden muss. Theodor Fontane lobte Engel 1883 in einem Brief: «Für mich hat Ihre Schreibweise einen charme, weil sie das absolute Gegenteil von akademischer Langenweile bedeutet, es sprudelt, es quietscht vor Vergnügen und das Vergnügen teilt sich einem mit.» Das gilt auch von Engels Lebensbuch, wie er selbst es nennt, eben seiner «Deutschen Stilkunst». Er veröffentlichte sie 1911; zum letztenmal erscheinen konnte sie 1931, es war die 31. Auflage. 1936 sprach die Schmähschrift «Jüdische und völkische Literaturwissenschaft» dem «jüdischen Literaturpapst» Recht und Fähigkeit ab, über deutsche Dinge zu urteilen. Im Dritten Reich war Engel ohne Schutz, und Reiners konnte ihn unbesorgt ausrauben. Wie ging er dabei vor?
Aus der Werkstatt eines Fälschers
Engel hat diesen Grundsatz: «Alles Wichtigste in der Stillehre nimmt von selbst die Form des Verneinens an.» «Lehrbar ist nur, die angebildeten Laster des Satzes, wie des Stiles überhaupt abzutun.» Daraus macht Reiners: «Daher ist jede Stilanleitung zum guten Teil negativer Natur: es ist wichtiger und leichter, Stillaster abzulegen als Stiltugenden zu erlernen.» Den Stilmeister will Engel nicht belehren: «Ihm werden hier keine Lehren gegeben, keine Warnungen erteilt, denn er ist mein Lehrer, nicht ich der seine.»
Reiners: «Ihn kann kein Stilbuch etwas lehren, es kann von ihm nur lernen.» An Stilmeistern führt Reiners dieselbe Auswahl vor wie Engel, zum Beispiel Theodor Storm mit dem Satz: «Meine Prosa hat mich stets mehr Zeit gekostet als Verse.» Halt, das schrieb nicht Storm, sondern Lessing, wie Engel richtig angibt; Reiners vertauschte beim Abschreiben die Namen. Reiners kennt nicht nur die Literatur zu wenig, er hat auch keine eigene Erfahrung, die er weitergeben könnte. Engel berichtet, wie er an seinem Werk über Goethe arbeitete: «Ich habe die Handschrift fünfmal durchgelesen, und zwar nach einer ersten fachlichen Prüfung unter diesen Hauptgesichtspunkten: 1. Ausdruck (Bestimmtheit, Anschaulichkeit, Wörter auf ung usw.); 2. Beiwörter, Umstandswörter; 3. Satz- und Absatzlänge; Satzzeichen, Satzbau, Wortfolge, Schachtelung, Bezugsätze; 4. Klang; 5. Überflüssiges.»
Reiners: «Da wir nicht bei einer Durchsicht auf alle Fehler achten können, so müssen wir unsere Entwürfe mehrmals durchgehen und jedesmal etwas anderes im Auge behalten, nämlich 1. inhaltliche Fehler, 2. Knappheit, 3. Zuspitzung und Anschaulichkeit des Ausdrucks, 4. Vermeidung unnötiger Haupt- und Beiwörter, 5. Satzbau, 6. Klang.»
So ging Reiners vor: er schrieb ab und um.
Eigentlich hat Eugen Roth schon alles gesagt. Er nannte Reiners einen «Feierabend- und Sonntagsschreiber», dessen bestes Werk, die Stilkunst, aus mindestens so vielen eigenen wie fremden Quellen gespeist sei. Man hat seither ab und zu auf diesen Tatbestand hingewiesen, ihn aber noch nicht gründlich untersucht und mit der nötigen Klarheit beurteilt. Und noch niemand hat deutlich gesagt, dass Reiners ein Hochstapler ist.
Der Laie als Fachmann
Engel zitiert aus einer griechischen Literaturgeschichte: «Ausserdem hatten die Athener in dieser Zeit ihrer grössten Aufgewecktheit eine besondere Vorliebe für eine gewisse Schwierigkeit des Ausdrucks; ein Redner gefiel ihnen weniger, der ihnen alles plan heraussagte, als der sie etwas erraten liess und ihnen dadurch das Vergnügen machte, dass sie sich selbst gescheit vorkamen.» Bei Reiners klingt das so: «Schon die Griechen hatten seit der Zeit der Sophisten und noch mehr in der Zeit des Hellenismus eine Vorliebe für eine gewisse Schwierigkeit des Ausdrucks. Ein Redner, der alles gerade heraussagte, gefiel ihnen weniger als einer, der sie etwas erraten liess und ihnen dadurch das Vergnügen machte, dass sie sich selbst gescheit vorkamen.» Reiners nennt die Quelle nicht, gibt also eine fremde Erkenntnis als eigene aus. Und indem er eine Aussage, die einer bestimmten Zeit Athens gilt, gleich auf das ganze Griechentum ausweitet, zeigt er, dass ihm neben der Ehrlichkeit auch das Urteilsvermögen fehlt. So schreibt ein Narr Kulturgeschichte. Wie steht es mit seinem Sinn für Stil? Über einen Vorgänger urteilt Reiners stolz: «Wenn der Jungdeutsche Theodor Mundt in einem Buch über Prosakunst eine neue lebendige Sprache fordert, so geschieht das in einem qualvollen Papierstil.» Zum Beweis führt er sieben Zeilen aus Mundts Buch an und übersieht, dass in fünfen Mundt nicht selber spricht, sondern Wilhelm von Humboldt zitiert. In einem besonders närrischen Kapitel behauptet Reiners: «Wenn man einen charakteristischen Text einem geschulten Ohr vorliest – nicht die Worte selbst, sondern nur ein la la la, aber mit richtigem Rhythmus –, so erkennt es sofort heraus, ob hier die Stimme Goethes oder Schillers, Kleists oder Nietzsches redet.» Nun hatte das geschulte Ohr und sogar Auge mehr vor sich als ein Lalala, und doch erkannte Reiners die Stimmen Humboldts und Mundts nicht.
Bezeichnend für Reiners ist auch das: «Von dem Humor mancher andern großen Männer – Luther, Lessing, Nietzsche – ist in anderen Kapiteln die Rede. Sie alle hätten das Wort Hebbels unterschrieben: ‚Für einen vorzüglichen Witz soll man eine Million gewöhnlicher Jamben hergeben‘.» In Wahrheit schrieb Hebbel, dass ein ‚Kunstverständiger‘ für einen einzigen Nestroy’schen Witz de première qualité eine Million gewöhnlicher Jamben hingebe, und meinte damit, ein gutes Possenspiel sei mehr wert als eine schlechte Tragödie oder Komödie. Reiners fälscht ein Zitat, um grosse Namen in einen albernen Zusammenhang zu zwingen.
Gemeines Judendeutsch
Oft wurde Engel unterstellt, dass er seine «Stammesgenossen» fördere. Ein Rezensent warf ihm 1916 vor: «Wie wird aber die Stillehre von Becker-Lyon heruntergekanzelt, weil sie eine jüdische Wortstellung mit Recht ‚gemeines Judendeutsch‘ nennt!» Engel hatte den Ausdruck abgewiesen und sachlich geschrieben: «Wir dürfen nicht sagen, noch schreiben: Ich habe gesehen meinen Freund, denn dies ist undeutsch.» 1944 führte Reiners das Judendeutsch wieder in die Stillehre ein: «Nur in längeren Sätzen können wir das Verb voranziehen. In kürzeren klingt das Voranziehen wie Judendeutsch: ‚Ich habe gemacht ein feines Geschäft‘.» Reiners war Mitglied der NSDAP. Im Begriff, mit dem Buch eines als Jude Verfemten ein feines Geschäft zu machen, witzelte er über jüdische Geschäftstüchtigkeit.
Das Urteil
Für ein «Kleinod in der Krone deutscher Prosakunst» hält Engel diesen Satz aus Mörikes «Mozart auf der Reise nach Prag»: «Wie von entlegenen Sternenkreisen fallen die Töne aus silbernen Posaunen, eiskalt, Mark und Seele durchschneidend, herunter durch die blaue Nacht.» Es sind die Klänge, zu denen der steinerne Komtur Don Giovanni warnt: «Dein Lachen endet vor der Morgenröte.» Am folgenden Abend überbringt er das Urteil: «Deine Zeit ist um.» Welches Urteil verdient Ludwig Reiners? Engel spricht es so: «Alle Verstösse gegen die Sprachrichtigkeit lassen sich verzeihen und durch Unterricht beseitigen. Unbeholfenheit des Ausdrucks, Schwerfälligkeit des Satzbaues, Verworrenheit im Ordnen der Gedanken lassen sich mindern oder abstellen. Die unverzeihliche Todsünde des Stils, die Sünde gegen den heiligen Geist in der Menschenrede ist die Unwahrheit.» Reiners äfft ihm auch dieses Urteil nach, mildert es aber, im Bewusstsein darum, dass es sein eigenes ist: «Den Unbeholfenen können wir ertragen, den Papierenen belehren, dem Unsicheren verzeihen, aber der Windbeutel, der Taschenspieler, der aufgedonnerte Scharlatan ist unserer heiteren Verachtung gewiss.» Heitere Verachtung ist freilich zu wenig für das, was Reiners tat. Mit seinem Diebstahl vernichtete er Eduard Engels Namen.
Reiners, den Menschen kannte Engel kaum; Reiners, der Typ war ihm vertraut. Er schrieb seine «Stilkunst» ausschliesslich gegen ihn: den Bildungsflunkerer, den Hochstapler, den literarischen Betrüger. Er verlangte: «Sei wahr! Wolle nicht mehr sagen, als du sicher weisst, klar denkst, ehrlich fühlst.» Dass ausgerechnet Engel einem Reiners in die Hände fiel, hat etwas alptraumhaft Ironisches, und wenn die Verdeutschung trifft, die Engel der Ironie beigibt, Feinspott, so ist das Feinspott vom gröbsten. Soll die hinterlistige und geschäftstüchtige Dummheit den Sieg davontragen? Eduard Engel muss seinen Namen zurückbekommen; seine «Deutsche Stilkunst» muss neu herausgegeben werden. Der Verlag C. H. Beck sollte Reiners aus dem Angebot entfernen.
Reiners erschwindelte sich den Titel eines Klassikers der Stilkunst und führte ihn sechzig Jahre. Die übrige Zeit wird er als Klassiker der Hochstapelei und des literarischen Diebstahls zubringen.
NZZ am Sonntag, 16. 12. 2007
| Kommentare zu »„Ich habe gemacht ein feines Geschäft“« |
| Kommentar schreiben | neueste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von AH, verfaßt am 18.12.2007 um 16.48 Uhr |
| Bin sehr beeindruckt von Stirnemanns Artikel und erschüttert, da ich als Germanistikstudent noch in den siebziger Jahren Reiners auch für den "Stilpapst" gehalten habe (weil von Professoren empfohlen; Stillehren gab und gibt es nur sehr wenige; ein schweres Feld). Der NS-Hintergrund war mir unbekannt. Reiners aus dem Beck-Verlagsprogramm entfernen muß man zwar nicht, aber Eduard Engel, der mir als Verfasser kundiger Literaturgeschichten (bzw. Epochengeschichten) zur Literatur des 19. Jahrhunderts vielfach in Originalausgaben begegnet ist, sollte in der Tat mit der "Deutschen Stilkunst" dem NS-Verdikt und dem unverdienten Vergessen entrissen werden, wenn so offensichtlich ist, daß Reiners nicht das Original, sondern ein Ausbeuter ist. Eine späte Wiedergutmachung scheint nötig! Was kümmert's "die Germanisten"? |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 18.12.2007 um 18.08 Uhr |
| Das angebliche "Judendeutsch" ist einfach der normale englische Satzbau, also ein Anglizismus. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.12.2007 um 05.51 Uhr |
| Mir war die Plagiatorentätigkeit des Herrn Reiners aufgefallen, als ich meinen Aufsatz über Engel und Schopenhauer schrieb (Muttersprache 1988). Später hat Helmut Glück viel für die Rehabilitation Engels getan, vor allem durch Betreuung einer Dissertation von Anke Sauter. Glück hat Engels Nachlaß erworben. Was bei Reiners aber ebenso abstößt, ist der chauvinistische Ton, der bei Engel noch fehlt (jedenfalls in der Stilkunst). Am harmlosesten sind noch die Klischees, die er einfach weiterverbreitet: „Amerikanische Urwaldstämme haben fünfzig verschiedene Wörter für die Spielarten der grünen Farbe, dagegen kein gemeinsames Wort für grün.“ Usw. Er hat es besonders auf die Franzosen abgesehen. Zustimmend zitiert er Moeller van den Bruck: „Von einer abgeschlossenen Sprachentwicklung, wie wir sie heute in der französischen haben, kann man (...) ohne weiteres auf die gleichfalls abgeschlossene Volksentwicklung schließen“ usw. Die Franzosen sind praktisch schon erledigt. Sie haben es verdient: „Die deutsche Sprache beruht durchgängig auf deutschen Wurzeln, die französische dagegen auf lateinischen.“ Diesen Satz muß man sich auf der Zunge zergehen lassen! Die romanischen Sprachen setzen eben das Lateinische fort, daran ist nichts Bemerkenswertes. „Das Französische ist nur ein entwickeltes, verändertes, verwandeltes Latein“. (Jules Marouzeau: Das Latein) Die deutsche Sprache hat deshalb keine größere „Erdhaftigkeit“ (Reiners S. 19), „Wurzelhaftigkeit“ (S. 20). Das Französische habe wegen seiner Endbetonung „etwas spechtartig Trommelndes“ (S. 20) und lauter banale Reime. Ob es sich lohnt, ein solches Machwerk immer wieder neu bearbeiten zu lassen? Für C. H. Beck lohnt es sich offenbar. |
Kommentar von Roger Herter, verfaßt am 19.12.2007 um 06.17 Uhr |
| Zu Eintrag #6271 von Germanist: Es ist halt auch der normale Satzbau des Jiddischen. Wird der nun ins Deutsche und auf deutsche Juden übertragen, so entsteht der (beabsichtigte) Eindruck, diese seien keiner vernünftigen Sprache fähig, sondern brächten lediglich eine Art Kauderwelsch zustande. Hier handelt es sich um ein uraltes Stereotyp bei der Beschreibung von Juden. So läßt etwa Wilhelm Hauff [in den "Memoiren des Satan", 1825/6] eine deutsche Jüdin sagen (das "Schickselchen, die Kalle, des Juden Tochter" heißt natürlich Rebekka): "Der Shawl hat mir jekostet achthundert Gulden." Einige Seiten weiter befürchten (selbstverständlich spekulierende) Juden einen Verlust an der Börse: "Wirst sehen, 's wird geben ä grauße Operation!... Ich weiß nicht, wo mer steht der Kopf... Aß ich nicht kann riechen, wie se stehen, die Metalliques!" Kauderwelsch, wie gesagt, oder eben "Judendeutsch". |
Kommentar von R. M., verfaßt am 19.12.2007 um 10.55 Uhr |
| „Zunächst was die neumodische Bezeichnung ,Jiddisch' oder gar ,Yiddisch' anbetrifft, so ist die einfach unsinnig und geschmacklos. Es gibt in der Welt keine Völkerschaft, die sich ,Jidden' oder ,Yidden' nennte. [. . .] Wem die Bezeichnung Jüdisch zu unbestimmt ist, mag Judendeutsch sagen, wie das fast allgemein geschah." (Binjamin Segel, 1916) |
Kommentar von GL, verfaßt am 19.12.2007 um 21.14 Uhr |
| Im Buch „Verschwundene Welt“ mit einem Vorwort von Elie Wiesel hat Roman Vishniac seinen Bildern eindrückliche Gedanken und Erinnerungen beigefügt, um ihnen Leben einzuhauchen. 1936 interessierten sich zwei junge Burschen in Trnava (Tschechoslowakei) für einen Fremden, der ihr Dorf besuchte. Herr Vishniac lächelte ihnen zu und sprach sie in „Mameloschen“ (ihrer jiddischen Muttersprache) an und kam so mit ihnen in ein Gespräch. Ich verstehe nicht, warum die Bezeichnung „jiddisch“ neumodisch bzw. was an der jiddischen Muttersprache unsinnig oder gar geschmacklos sein sollte! |
Kommentar von Richard Dronskowski, verfaßt am 19.12.2007 um 23.50 Uhr |
| Die Bezeichung "Jiddisch" oder "Yiddisch" halte ich auch für absolut neutral. Was daran neumodisch, unsinnig oder geschmacklos sein soll, kann ich nicht erkennen. "Kol Israel", die Stimme Israels, sendet übrigens regelmäßig gegen Mitternacht kurze Beiträge in "yiddisher" Sprache in Richtung Westeuropa, und zwar auf 6985 bzw. 7545 kHz. Wer ein Kurzwellenradio besitzt, der höre hinein; recht nett klingt das! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.12.2007 um 04.40 Uhr |
| Zum Jiddischen in Franken hat mein Erlanger Kollege Alfred Klepsch vor einigen Jahren seine umfangreiche Habilitationsschrift vorgelegt, woraus sein Westjiddisches Wörterbuch entstanden ist. Auf dieses bedeutende Werk möchte ich bei dieser Gelegenheit hinweisen. Es ist auch sprachsoziologisch sehr interessant. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 20.12.2007 um 11.21 Uhr |
| Die Wikipedia-Beiträge zu "Jiddisch" halte ich ausnahmsweise für glaubwürdig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.12.2007 um 18.24 Uhr |
| Bei Wikipedia kommt Reiners trotz Stirnemann-Zitat immer noch recht gut weg. Die angeführten Beispiele für guten Stil erledigen sich allerdings für den geschmackvollen Leser von selbst. Seltsam drückt sich der anonyme Verfasser aus: "Das 19. Jahrhundert naht sich mittels treffender Farben hart dem Leser." (Über Reiners' Bismarck-Biographie) Was übrigens wiederum zu Engel führt, denn der kannte Bismarck wirklich, von Berufs wegen. |
Kommentar von Christoph Schatte, verfaßt am 22.12.2007 um 13.02 Uhr |
| Ludwig Reiners und seine „Deutsche Stilkunst“ sollten sofort dem völligen Vergessen anheim fallen. Jede Erwähnung dieses "Autors" und seines "Werkes" ist eine Peinlichkeit, für die gewisse Verlage leider unsensibel sind. |
Kommentar von Roger Herter, verfaßt am 22.12.2007 um 15.25 Uhr |
| Der genannte Wikipedia-Artikel zeigt, welcher Rang Ludwig Reiners heute noch zugebilligt wird: "[Reiners wurde] nach dem Krieg (...) ein Leuchtturm für Fragen des Ausdrucks und gab auch den Stilduden heraus." In Wahrheit hat er das "Stilwörterbuch der deutschen Sprache" (Der Große Duden 2, 1956) weder herausgeben (oder mitherausgegeben), noch überhaupt daran mitgewirkt. Es gibt da lediglich ein Vorwort von ihm, das ist alles. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.12.2007 um 06.59 Uhr |
| „...the Wikipedia system that apparently enables any idiot to write whatever he likes about other people, in what purports to be a major international knowledge resource, with no quality control whatever.“ (Geoffrey Sampson: „The truth behind the Wikipedia entry“ 2007) |
Kommentar von Stefan Stirnemann, verfaßt am 23.12.2007 um 12.29 Uhr |
| Wenn die geschichtlichen Umstände nicht wären, könnte man über den Hochstapler Reiners lachen. Eine große Frage ist, was die Bearbeiter des Werks eigentlich gemacht haben. Wie kann man Reiners lesen, ohne nach wenigen Seiten zu merken, was los ist? Ich drucke einen älteren Beitrag ab; er erschien in der Zeitschrift "Harass", Heft 18 (2003). Ein Einbrecher als Klassiker Ludwig Reiners und sein Buch „Stilkunst“ Was tut man, wenn man einen Einbrecher ertappt? Man packt ihn, und hat man Glück, so ist er nicht gewalttätig und wartet ergeben, bis die Polizei eintrifft. Ihn unterdessen nach seinen Gründen zu fragen, lohnt sich nicht. In den meisten Fällen ist die Sachlage klar: es sucht jemand seinen Vorteil auf einfachem Weg. „Einfach“ bedeutet nicht „ohne Mühe“. Es ist eine Anstrengung, Beute und Wege auszukundschaften, die Leiter anzustellen, Türen und Schränke aufzubrechen und zu tun, was sonst noch nötig ist. Dazu kommt die Angst, erwischt zu werden. Ich habe Ludwig Reiners erwischt: er hat sein berühmtes Buch „Stilkunst“ in bisher nicht bekanntem Ausmaß abgeschrieben. Die Erstausgabe erschien 1944, und nur im Dritten Reich war diese Schurkentat möglich. Der Bestohlene, der Literaturhistoriker Eduard Engel (1851-1938), war seit sechs Jahren tot und sein Werk infolge der Rassengesetze der Plünderung freigegeben. Das Grundsätzliche habe ich in meinem Aufsatz „Das gestohlene Buch“ dargelegt (Schweizer Monatshefte, August/September 2003). Hier nur soviel: Ludwig Reiners (1896-1957), in der Wirtschaft tätig, war schon 1930 und 1933 als Autor eines wirtschaftlichen Sachbuches hervorgetreten. In der ihm eigenen Behendigkeit schrieb er 1933: „Denn – wie der Führer es in glasklarer Kürze formuliert hat – es ist besser, die Arbeit zu verteilen als ihre Ergebnisse.“ Oder: „Das bloße Erscheinen der Regierung Hitler bewirkte einen Umschwung in der Wirtschaft, noch bevor sich ihre Wirschaftsmaßnahmen auswirken konnten, so wie ein bedeutender kraftvoller Mensch eine Menge durch seine bloße Anwesenheit beeinflußt, noch bevor er den Mund aufgetan hat.“ In der Folge muß Reiners den Plan gefaßt haben, auch seinen persönlichen wirtschaftlichen Um- und Aufschwung zu fördern und aus Eduard Engels erfolgreichen, aber nun verbotenen Werken ein neues Buch zusammenzustellen. Es ist eindeutig, daß Reiners seine literarische und sprachliche Bildung Engel verdankt; wo er über ihn hinauswill oder gar selbständige Überlegungen anstellt, schreibt er immer wieder den größten Blödsinn. Und auch dort, wo er abschreibt, irrt er nicht selten: er hatte keine Zeit, sorgfältig zu sein, wie er keine Zeit und Fähigkeit für eigenes echtes Forschen hatte. Ich habe, wie Reiners, Engels Werke gelesen und kann deshalb beurteilen, wie der niederträchtige Dieb vorgegangen ist. Das meiste hat er aus Engels „Deutscher Stilkunst“ genommen, an erster Stelle den Titel. Ihn verknappte er für die zweite Auflage (1949) in „Stilkunst“. Ein paar Beispiele, bis auf eines sind es andere als in den Monatsheften: 1) Engel schreibt: „Was nicht wirkt, schadet; es beansprucht Zeit und Kraft des Lesers ohne Frucht. Jedes Wort, das unbedeutende wie das bedeutende, fordert Geistestätigkeit (…). Aus diesen Tatsachen folgt das Gesetz des kleinsten Mittels für den Stil wie für alle Kunst.“ Reiners nimmt das so auf: „Weil die Aufnahmefähigkeit des Lesers abnimmt, darum gilt für den Stil das Gesetz vom kleinsten Kunstmittel: je kleiner der Sprachaufwand im Verhältnis zum Inhalt, desto größer die Wirkung.“ 2) Engel warnt davor, trockene, farblose Wörter wie „derselbe“ zu verwenden, nur um eine Wiederholung zu vermeiden: „Die Wiederholung gilt für langweilig, und wir haben ja erfahren, wozu dieser Aberglaube verführt: lieber zum unlebendigen Derselbern als zum gemütlichen Wiederaufnehmen eines Ausdruckes.“ Reiners: „Manche Leute leiden an dem Aberglauben, man dürfe ein Wort nicht innerhalb weniger Zeilen wiederholen. Sie schreiben dann derselbe oder ersterer und letzterer.“ 3) Engel zitiert in seiner deutschen Literaturgeschichte Lessings Spott, daß man bei Gottscheds Gedichten mit zwei Talern das Lächerliche und mit vier Groschen das Nützliche bezahle, und fährt fort: „Zwei Taler für die Lächerlichkeit sind allein Gottscheds Verse auf Peter den Großen wert: Deines Geistes hohes Feuer / Schmelzte Rußlands tiefsten Schnee(…).“ Reiners tut so, als ob er Gottsched kenne: „Ebenso komisch der Sprachpapst Gottsched von Peter dem Großen: Deines Geistes hohes Feuer / Schmelzte Rußlands tiefsten Schnee.“ 4) Engel schreibt in „Was bleibt?“, seiner Sichtung der Weltliteratur, über ein Stück Gerhart Hauptmanns: „Kein Mensch mit dem geringsten Sinn für Stil würde den frühmittelalterlichen Markgrafen Ulrich in ‚Griselda’ sagen lassen: Ich bin diesen Brutalitäten des Lebens nicht gewachsen.“ Reiners, der nicht einmal fähig ist, Titel und Wortlaut richtig abzuschreiben: „Gerhart Hauptmann läßt in Griseldis den Markgrafen Ulrich zu einer Zeit, in der Ravenna noch Raben hieß, sagen: ‚Ich bin der Brutalität des Lebens nicht gewachsen.’ Diese Wortwahl ist wirklich brutal.“ 5) Ich wiederhole ein Beispiel, aus den Monatsheften; wegen eines Versehens der Redaktion ist dort ein Satz in unverständlicher Form gedruckt worden. Engel kennt die literarischen Schatzkammern vieler Sprachen und bietet seinen Lesern die schönsten Stücke daraus. Als besonders geglücktes Bild führt er, ohne weitere Angabe, Goethes Vergleich an: „Ich komme mir vor wie jenes Ferkel, dem der Franzos die knupperig gebratene Haut abgefressen hatte, und es wieder in die Küche schickte, um die zweite anbraten zu lassen.“ Reiners kann gar nicht anders, er muß diese Stelle auch haben, schreibt ab und fügt an: „Jeder dieser Vergleiche haftet in unserem Gedächtnis (…).“ Daß er das Ferkel Engel verdankt und nicht etwa seinem Gedächtnis, ist eindeutig: Engel vereinfacht, wie oft beim Zitieren, die Wortfolge, und Reiners zitiert in dieser Form und nicht so, wie Goethe am 13. September 1778 an Charlotte von Stein schrieb. Reiners’ einziger Beitrag ist die Veränderung von knupperig in knusperig. 6) Engel über eine Aufgabe des Doppelpunkts: „Die beiden Punkte übereinander mag man den Angeln an einer Tür vergleichen, die aus einem Zimmer ins andre führt.“ Reiners übersetzt das schöne Gleichnis zeitgemäß ins Politische: „Vor allem können wir den Doppelpunkt oft als Schlagbaum verwenden, den wir gelassen emporziehen, um den Leser - nach einer kleinen Pause - in ein neues Land einzulassen.“ 7) Ein Beispiel für Reiners’ Unwissen. Engel war es ein Anliegen, Fremdwörter durch deutsche zu ersetzen; er hat aus seinem großen Wissen die höchst lebendige Geschichte solcher Verdeutschungen dargestellt. Mit Recht rühmt er Johann Heinrich Campe und Philipp von Zesen. Reiners will es ihm nachtun und schreibt: „Vor 150 Jahren hat Campe als Ersatz für Passion mit kühnem Griff das schöne Wort Leidenschaft erfunden.“ Das ist nicht richtig, und irgendwann in der Nachkriegszeit hat irgendwer eine Korrektur versucht (wohl nicht mehr Reiners selbst): „Vor zweihundert Jahren hat Philipp von Zesen als Ersatz für Passion mit kühnem Griff das schöne Wort Leidenschaft erfunden.“ Philipp von Zesen lebte 1619-1689. In der Überarbeitung von 1991 liest man: „Vor dreihundert Jahren hat Philipp von Zesen als Ersatz für Passion mit kühnem Griff das schöne Wort Leidenschaft erfunden.“ Immer noch falsch: die Verdeutschung stammt nicht von Zesen; Zesen hat sie nur in Umlauf gebracht, wie Engel mit der Umsicht des Mannes schreibt, der die Dinge kennt, von denen er berichtet. Zur Überarbeitung von 1991: Stephan Meyer und Jürgen Schiewe haben sie nur oberflächlich durchgeführt. Sie hätten sehen müssen, daß hier einer am Werk war, der nicht Bescheid weiß. Und schon damals hätte man das Buch gründlich überprüfen müssen, denn 1988 hatten Willy Sanders und Theodor Ickler erste Hinweise auf Plagiate gegeben. Diese Überprüfung habe ich jetzt durchgeführt, die Dinge sind klar, und man kann anfangen, den Schaden zu beheben. Die Geschichte der Stilkunde muß berichtigt werden. Reiners muß den angemaßten Platz im Tempel der Stilkunst räumen und umziehen in die Rumpelkammer der Hochstapler und Betrüger. Vor allem aber muß Engels Stimme wieder erklingen. Er hat Schönes und Bedenkenswertes über die Sprache gesagt, wichtig gerade im Zeitalter der Rechtschreibreform: - „Wehe jeder Sprache, über welche die dem sprießenden Sprachleben feindlichen Regelschmiede und Zuchtmeister Gewalt bekämen.“ - „Mein Grundsatz ist in sechs Worten: Im Notwendigen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit; und da es weit mehr Zweifelhaftes als unerschütterlich Notwendiges gibt, so darf ich mich rundweg einen Vertreter größtmöglicher Freiheit in allen Fragen Deutscher Sprache und guten Stiles nennen.“ - „Man schreibt für Leser, nicht für sich selbst, folglich sind die durchschnittlichen Fähigkeiten der Leser im Überschauen, Aufnehmen, Verstehen für den Schreiber maßgebend. Der Schreiber muß seinen Satzbau so entwerfen und zimmern, daß nicht er allein, der ja den Inhalt schon kennt, sich darin zurechtfinde; sondern er hat zuerst und alsdann und zuletzt an den Leser zu denken.“ - „Nicht mein oder irgendeines Einzelnen Geschmack, sondern nur der einer deutlich erkennbaren überwiegenden Mehrheit der Gebildeten gibt den Ausschlag.“ - „Die Sprache liest keine Sprachlehren.“ Stefan Stirnemann, St. Gallen HARASS Die Sammelkiste der Gegenwartliteratur aus dem Sängerland Der Harass ist das Publikationsorgan der Autorinnen und Autoren, die sich in der literarischen Vereinigung SIGNAThUr SCHWEIZ, Gruppe Thurgau, Bodensee & Rhein, zusammengeschlossen haben. Der HARASS ist offen für Erstpublikationen von Lyrik, dichterischer Prosa und für weitere kulturelle Beiträge, auch von Gastautoren. Diese beziehen sich auf das von SIGNAThUR vorgegebene Hauptthema oder enthalten selbstgewählte Stoffe. Herausgeber: Bruno Oetterli Hohlenbaum, CH-8580 Dozwil TG signathur@gmx.ch |
Kommentar von Glasreiniger, verfaßt am 23.12.2007 um 15.51 Uhr |
| Es stellt sich hier die Frage, was zu tun ist. Da der Verlag offenbar den Anstand nicht aufbringt, das Plagiat aus dem Verkehr zu ziehen, scheint mir das Beste, Engels Buch einzuscannen und bei gutenberg.de einzustellen. Das Copyright dürfte doch 2008 auslaufen. |
Kommentar von Oliver Höher, verfaßt am 23.12.2007 um 17.20 Uhr |
| Prinzipiell eine sehr gute Idee, lieber Glasreiniger. Die letzte, von Herrn Stirnemann beschriebene Ausgabe wäre somit seit 2001 frei, wenn ich eine Dauer des Urheberschutzes von 70 Jahren nach dem Tod des Autors korrekt im Kopf habe. Meine Einschränkung durch das kleine Wort "prinzipiell" bezieht sich freilich darauf, daß gerade diese Auflage in Fraktur gedruckt wurde. Das scheint bei Engel, seinen Werken und seinen diversen Verlagen durcheinander zu gehen. Ich habe seine englische und französische Literaturgeschichte in Antiqua und die deutsche Literaturgeschichte in Fraktur (alles freilich keine Erstdrucke). Hat jemand zufällig die "Deutsche Stilkunst" im Erstdruck von 1911? Vielleicht Herr Stirnemann: Antiqua oder Fraktur? Aus philologischen Gründen kämen für gutenberg.de meiner Meinung nach nur der Erstdruck oder die letzte Auflage, die Engels noch bearbeitete, in Frage. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.12.2007 um 12.20 Uhr |
| Meine Ausgabe ist von 1911, in Fraktur (natürlich!). |
Kommentar von R. M., verfaßt am 25.12.2007 um 00.35 Uhr |
| Noch ist das Buch von Google nicht eingelesen worden, aber das kommt schon noch. Der Titel ist immerhin schon zwölfmal erfaßt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.12.2010 um 18.13 Uhr |
| Habe mal in die von Schiewe (jetzt Mitglied des Rechtschreibrates) bearbeitete Neuausgabe von Reiners' Stilkunst geguckt. Im Register wird aus Behaghel Behagel, der übliche Fehler. Aus Erich Drach ist Ernst Drach geworden.Von Bismarck wird nicht mehr gar so viel zitiert, dafür gibt es im Register neben Otto Fürst von Bismarck einen zweiten Autor: Otto von Bismarck-Schönhausen. Die "Schule des Schreibens", die Reiners einem gewissen Brodersen zuschrieb, stammt vielleicht von Broder Christiansen, aber in der Neubearbeitung heißt der Verfasser Arvid Brodersen (im Text) bzw. Arrid Brodersen (im Register). Houston Stewart Chamberlain ist immer noch der "vortreffliche Kantforscher", weiter nichts. Ewald Geißler und andere Größen werden auch noch erwähnt. Das Nachwort von Schiewe liest sich idyllisch, vom Plagiator Reiners hat der Bearbeiter noch nie etwas gehört. Der opportunistische Umgang des Nationalsozialisten R. mit den zitierten Schriftstellern wird nicht erwähnt. Man sollte das Buch aus dem Verkehr ziehen, jetzt erst recht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.02.2011 um 09.31 Uhr |
| Ein gewisser Klaus Jarchow weiß zwar nichts Genaueres über Eduard Engel, zieht aber trotzdem alle Register (wahrscheinlich nach Zitaten aus zweiter Hand): "Die Stilsaga der Sprachkritik 16. Januar 2007 | Von Klaus Jarchow In manchen Fällen ist das Woher interessanter als das Was. Vor allem in der Sprachkritik, wo die Wiedergängerei zum Berufsbild gehört. Wenn er weiß, dass vieles, was heute von den Sick und Schneider kassandrahaft ausgeschrien wird, zu den unverwüstlichen Evergreens des Genres gehört, dann nimmt der Blogbewohner diese stilistischen Klageweiber nicht mehr ganz so ernst. Der Urahn aller Sprachkritiker - Wustmann möge mir verzeihen - ist Eduard Engel: Die Stillehre dieses Altphilologen - jemand also, der sich mit den alten Sprachen befasst - erreichte in der Kaiserzeit und in der Weimarer Republik unglaubliche 31 Auflagen. Das sind Zahlen, von denen sogar ein Bastian Sick heute träumt. Kurzum: Der «Engel» war in jedem bürgerlichen Bücherschrank zu finden, überall dort, wo ein Filius oder eine Filia mit Schulwissen über deutsche Sprache traktiert wurde. Das Lustige für heutige Leser an seinen Texten ist, dass sich fast «der gesamte Wolf Schneider» schon «in nuce» hier vorgeformt findet: Der kurze Satz wird gelobt, das Adjektiv verteufelt, die «Fremdwörterei» beschimpft, die Verwechslung von «als» und «wie» mit dem Untergang des germanischen Abendlandes gleichgesetzt - kurzum: alles steht schon dort, wo es gegenwärtig auch im trauten Heim unserer Sprachkritiker zu finden ist. Nur dass Engels Beispiele natürlich noch nicht aus «Zeit» und «Frankfurter Rundschau» stammen können. Auch das konservative Pathos, das Sprachverfall mit nationalem Untergang gleichzusetzen geneigt ist, tönt hier wie die Posaunen von Jericho. Damals schon heißt es: «Unter allen schreibenden Völkern sind die Deutschen das Volk mit der schlechtesten Prosa». Ein wissenschaftlicher Beleg für diese kühne Behauptung erübrigt sich einst wie heute, so etwas spürt der germanische Recke in seiner Heldenbrust, von Anfang an liest der Areopag der Sprachkritiker im Kaffeesatz: «Diese Tatsache braucht nicht erwiesen zu werden, sie steht nach dem Urteil der berufenen Kenner der Sprache und des Stiles fest» (S. 9). Und damals wie heute war auch schon jeder berufen, ob Industriekaufmann (Ludwig Reiners) oder Journalist (Wolf Schneider), sofern er nur in dieses Klagelied des sprachkritischen Gesangsvereins aus voller Brust einzustimmen wusste. Manche Traditionslinien, die von Engels Sprachkritik aufs nahegelegene politische Gebiet führen, sind nicht nur komisch, sondern erschreckend, wie hier der Gebrauch des Adverbs «minderwertig»: «Das Fremdwort ist minderwertig: jedes Prosastück voll Schwung und Weihe beweist das" (S. 217). Und: «So gemein. wie sie wirklich sind, müssen die Fremdwörter für das Volksgefühl werden» (S. 218). Vielen «Fremden» ging es bekanntlich kurz darauf so … Wer sich also informieren möchte, wo unsere heutigen Sprachkritiker ihren Most beziehen, der möge an «dem Engel» nicht vorbeigehen - auch deshalb, weil er dann auch auf jene überreiche Zitatquelle stößt, wo schon damals die Beispiele der heutigen Texte sprudelten." - Engel zeigt an zahllosen Beispielen, daß das Fremdwort im jeweiligen Zusammenhang tatsächlich minderwertig ist. Schon die Stellen aus dem einst vielgelesenen Dilthey sind tödlich. Fast immer verdeckt das Fremdwort die Schwindelei über das Nichtwissen. Daß die Nazis das Wort minderwertig auf Menschen wie Engel selbst anwandten, kann doch kein Grund sein, es für alle Zeiten und auch noch rückwirkend anzuprangern. Engel war kein Purist, er gebrauchte die geläufigen Fremdwörter wie Stil (schon im Titel) und Prosa (im ersten Satz, den auch Jarchow zitiert). "Der Urahn aller Sprachkritiker - Wustmann möge mir verzeihen - ist Eduard Engel." Dieser Satz soll Jarchow als Kenner ausweisen und ist doch bloß lächerlich. Jarchow kritisiert, daß Engel für seinen Einleitungssatz «Unter allen schreibenden Völkern sind die Deutschen das Volk mit der schlechtesten Prosa» keine wissenschaftlichen Beweis antritt. Natürlich nicht! Aber das ganze riesige Werk ist der Beweis. Engel "verteufelt" das Adjektiv nicht, aber um das zu erkennen, müßte man das Kapitel lesen, und dazu scheint es bei vielen superklugen Heutigen nicht zu reichen. Engels "Stilkunst" ist zeitgebunden und müßte für unsere Zeit wiederholt werden (ich sage absichtlich nicht "bearbeitet", wie Schiewe es mit Reiners unrettbarem Machwerk versucht hat). Aber seine Grundsätze und sehr viele Einzelheiten bleiben gültig. Daß er überall den Schwindel als Kern des Kritikwürdigen hervorhebt und sich nicht in den Niederungen eines Sick verliert, hebt ihn über die Sprachmeisterei hinaus. Unzeitgemäß war damals auch seine Verteidigung der Journalisten; sie sollten ihm noch heute dankbar sein. Sick gehört nicht zu Erben Engels, Schneider sehr wohl. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.07.2011 um 19.09 Uhr |
| Obwohl er das Buch von Anke Sauter gelesen hat, hält Eisenberg an einem Bild von Eduard Engel fest, das sich stark nach „Peter von Polenz' befreiendem Vortrag auf dem Germanistentag 1966“ richtet. Er zieht also bloß die Schriftchen aus dem Weltkriegstaumel heran, nicht die "Deutsche Stilkunst". So kann er folgendes behaupten: „Selbst der vom Reinheitsgedanken getriebene, ihn in allen nur denkbaren Facetten ausformulierende Nationalist Eduard Engel kommt gelegentlich auf Verständlichkeit zu sprechen, allerdings verbunden mit starken moralischen Wertungen.“ (Peter Eisenberg: Das Fremdwort im Deutschen. Berlin/New York 2011:122f.) Die Stilkunst ist auch im Literaturverzeichnis nicht erwähnt. Läse Eisenberg sie, würde er auf Stellen wie diese stoßen: "Was fragt die Sprache nach dem Ursprung?" (1911:50) Ist das der Reinheitsgedanke? Was Engel wirklich antreibt, liest man bei ihm selbst auf jeder Seite. Reinheit und Nationalismus gehören nicht dazu. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 16.07.2011 um 17.04 Uhr |
| Engels Deutsche Stilkunst (28.-30. Tsd. 1917) als pdf hier: http://www.megaupload.com/?d=6TAZ8OVX |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.07.2011 um 08.54 Uhr |
| Eine wahrheitsgemäße Darstellung und gerechte Beurteilung des "Sprachpurismus" ist lange durch Peter von Polenz behindert worden, der auf dem Münchner Germanistentag 1966 jene Rede hielt, auf die sich bis heute Eisenberg und andere verlassen. Darin sprach er den - auch anderswo oft gedruckten Satz : „Der ganze Sprachpurismus beruht auf dem methodologischen Irrtum der Vermischung von Diachronie und Synchronie.“ Das ist natürlich Unsinn und kann allenfalls mit dem damals herrschenden Optimismus über den neuentdeckten Strukturalismus erklärt werden, zusätzlich zur "aufklärerischen" Grundstimmung der Gesellschaftskritik. Aber der Versuch, Eduard Engel zum Nazi ante litteram zu machen, mußte sich als schwierig erweisen, und die folgenden Eiertänze um das Schicksal des Purismus im Dritten Reich wirken so künstlich, wie sie waren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.07.2011 um 08.58 Uhr |
| Hierzu auch Polenz' These in einem FAZ-Interview sehr viel später: "Bis zur Goethezeit herrschte eine weltoffene, kosmopolitische, mehrsprachige Einstellung. Aber seit den napoleonischen Kriegen hat sich der Nationalismus durchgesetzt, der zu einer verhängnisvollen Einsprachigkeit führte." Dieses Geschichtsbild kommt mir konstruiert vor. Wer war bis zur Goethe-Zeit mehrsprachig und danach nicht mehr? Oder sollen wir zwischen "mehrsprachiger Einstellung" (?) und Mehrsprachigkeit unterscheiden? |
Kommentar von Heinz Erich Stiene, verfaßt am 18.07.2011 um 14.38 Uhr |
| Man könnte der Konstruktion des Herrn von Polenz mit einer knappen Beobachtung Adalbert Stifters von 1844 begegnen: „Die Kinder reden etliche Sprachen, d. h. sie sagen in ihnen Dinge, die deutsch zu fade klängen.“ Es ist die Crux nicht nur der Geisteswissenschaften, daß ihre Vertreter über die gescheite Beliebigkeit des Feuilletons oftmals nicht hinauskommen (wollen). Hauptsache, man ist Teil des eitlen Diskurses. Und so kann man polierte Doktorarbeiten abliefern, deren Plagiat niemand bemerkt - weil es im Grunde belanglos ist. Warum muß ich dabei nur immer wieder an die Menuettszene im Film 'Tanz der Vampire' denken? |
Kommentar von R. M., verfaßt am 18.07.2011 um 16.06 Uhr |
| Die Vorstellung, ganz Deutschland sei vor 1815 in sprachlicher Hinsicht eine Art großes Luxemburg gewesen, ist wirklich närrisch. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 19.07.2011 um 11.08 Uhr |
| Die Vorwürfe von Polenz' an Engel (z.B. http://www.vds-ev.de/texte-zur-deutschen-sprache/695-peter-von-polenz-fremdwort-und-lehnwort-sprachwissenschaftlich-betrachtet) sind hart, daß ich sie hier nicht wiederholen möchte, noch dazu, wenn sie unberechtigt sind. Stefan Stirnemann schreibt dazu nur, man muß sich damit abfinden. Also zumindest ausgedacht hat von Polenz sie sich wohl nicht. Engels Buch habe ich runtergeladen und gleich mal auf Seite 50 ("Was fragt die Sprache nach dem Ursprung?")nachgeschlagen. Das liest sich so interessant und gut, daß ich mich nach der halben Nacht mit Gewalt losreißen mußte. Danke für diesen Buchtip! |
Kommentar von Igor , verfaßt am 09.08.2012 um 09.12 Uhr |
| Hat jemand zufälligerweise Engels Deutsche Stilkunst als pdf? Es gibt hier einige andere Werke von ihm online, aber genau das ist nicht zu finden. http://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Engel%2C+Eduard%2C+1851-1939%22 Würde mich sehr darüber freuen, wenn jemand es mir zuschicken könnte. LG Igor |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.08.2012 um 12.09 Uhr |
| Das ist schade, es müßte mal eingescannt werden. Die preisgünstigsten Exemplare sehe ich z. Zt. bei ZVAB. Diese Anschaffung lohnt sich! In Antiquariaten findet man es beim Stöbern manchmal noch billiger. |
Kommentar von Igor, verfaßt am 12.08.2012 um 16.18 Uhr |
| So, ich habe jetzt das Buch gefunden und es auf archiv.org hochgeladen. Hier der Link: https://archive.org/details/DeutscheStilkunst Kommt auch gleich auf Wiki :) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.06.2013 um 07.42 Uhr |
| Ludwig Reiners führt auch den Nutzen des Passivs vor. In seiner Stilkunst von 1967 heißt es: Vor einigen Jahren ist allgemein verboten worden, neue Abkürzungsworte im Amtsbereich zu verwenden. 1943 stand an derselben Stelle: Das Reichsministerium des Innern hat allgemein verboten .. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.07.2013 um 05.27 Uhr |
| Ludwig Reiners empfiehlt ja in seiner "Stilkunst", immer das konkrete, "anschauliche" Wort zu verwenden. Die Folgen für die Aufsatzdidaktik und die mindere Schriftstellerei sind bekannt. Man schreibt nicht gehen, sondern stapfen, nicht sehen, sondern lugen usw. Es ist die Anleitung zur sprachlichen Hochstapelei, letzten Endes zu gesteigerter Klischeehaftigkeit. Den rumpelnden Bauernkarren, den Reiners anführt, hat er wahrscheinlich selbst nie gesehen und gehört. Bauernkarren rumpeln eben, bis in alle Ewigkeit, das weiß man einfach. An derselben Stelle die knisternde Erotik, die namenlose Angst. Google liefert zur Zeit 104.000 Belege für knisternde Erotik (ohne flektierte Formen). Das sollte doch reichen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.08.2016 um 18.05 Uhr |
| Zur Neuausgabe von Engel s. auch: http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/26194 Die klebrige Bearbeitung von Reiners durch Meyer und Schiewe hat die Entnazifizierung noch etwas weiter geführt. Entfernt oder verändert wurden laut Nachwort: Formulierungen und Beispiele patriotischen und militärischen Inhalts (wenn auch zitiert aus klassischen Werken); gewisse Über- bzw. Unterschätzungen von Leistungen der deutschen Sprache im Vergleich mit anderen Sprachen; eine für die vierziger Jahre verständliche, für heute aber überlange Auseinandersetzung mit der Problematik „Fremdwort und Neuwort“ (wobei die für damals erstaunlich ausgewogene These des Autors auch heute noch gültig ist); eine gelegentliche zeitbedingte Einschätzung von zitierten Autoren, die wir heute anders sehen (...) Das bloße Wiedererscheinen von Engels Werk bedeutet nun hoffentlich das Ende des Reiners-Machwerks. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.09.2016 um 13.04 Uhr |
| Unterstöger schreibt in seiner zwiespältigen Besprechung der Neuausgabe: "Deutlicher denn je sieht man nun, was ein großer Mann zu leisten vermag, und ebenso deutlich tritt zutage, wo und in welchem Ausmaß seine Nachfolger sich ihre Inspiration holten. Es muss an dieser Stelle der Name Ludwig Reiners fallen, dessen unendlich erfolgreiche Sprachbücher mit dem Vorwurf leben, sie seien aus Eduard Engels Unglück erblüht. Mit diesem Tenor wird auch die Neuausgabe beworben, doch sind Zweifel angebracht, ob man frank und frei sagen kann, Reiners habe Engel gewissermaßen ausgeweidet und ruchlos plagiiert. Engel war nicht, wie glauben gemacht wird, verschwiegen und vergessen. An der Bamberger Universität sind unter der Obhut von Helmut Glück zwei umfassende Arbeiten zum Thema entstanden, die eine von Anke Sauter, die andere von Heidi Reuschel. Weder dieser noch jener lässt sich entnehmen, dass Reiners ein übler Plagiator gewesen sei. Er stand in einer bis heute nicht erloschenen Abschreibtradition, und wenn, wie Reuschel fordert, der Reinersche Erfolg auf Eduard Engel übergehen sollte, so ist diese Neuausgabe der aussichtsreichste Weg dazu." Zweideutig ist schon der Begriff "Abschreibtradition". Engel selbst schreibt ja nicht ab, und wo er sich anderen verpflichtet sieht, sagt er es. Aber vielleicht ist nur die Tradition des Abschreibens von Engel gemeint. Ob "übel" und ruchlos" oder nicht - Reiners ist als Plagiator überführt und hat im "Spiegel" seine Arbeitsweise selbst offen dargestellt, da gibt es nichts zu relativieren, besonders seit Stefan Stirnemanns Untersuchungen. Engel war nicht verschwiegen und vergessen? Verglichen mit dem Ruhm und Erfolg des Abschreibers war er das sehr wohl. Sein großes Werk ist nie wieder aufgelegt worden, Polenz' Diffamierung wirkte unter Germanisten durchschlagend, und als ich 1988 meinen Aufsatz über Engel veröffentlichte, konnte ich nicht voraussetzen, daß die Leser wußten, wer das war. Helmut Glück hat den Nachlaß des weithin Unbekannten, einst sehr Berühmten erworben und seine Doktorandinnen darauf angesetzt, um ihn der Vergessenheit zu entreißen. Das war überaus verdienstvoll. Aber es war zwei Menschenalter nach Engels Tod - nach einer beispiellosen Karriere des Plagiators. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.09.2016 um 15.25 Uhr |
| Treitschke war ein schlechter Geschichtsschreiber Das steht im Neudruck von Engels Stilkunst. Ich habe die Vorlage (31. Auflage) nicht zur Hand, aber ich glaube nicht, daß Engel je anders als Geschichtschreiber geschrieben hat, denn er hielt das Fugen-s hier für überflüssig. Es ist anzunehmen, daß der neue Text durch ein Korrekturprogramm gelaufen ist. Über Harden: „Geburtstag wagt selbst er nicht zu schreiben, und Geburtstag wäre gegen seine heiligste sprachwissenschaftliche Überzeugung.“ (Im ersten Fall müßte Geburttag stehen; die Pointe geht verloren). Wo Engel selbst über das Fugen-s schreibt, steht nun: "Hoffentlich ist die 'Hilflosigkeit' bei einer Sprachmeisterin wie Ricarda Huch nur ein Druckfehler." - Natürlich müßte Hilfslosigkeit stehen, der Druckfehler ist in die Neuausgabe hineinkorrigiert. Der Neudruck ist bibliophil gestaltet, die Textwiedergabe aber nicht ohne Fehler (Unterstöger hat es auch schon bemerkt): 17: Handwerk-sunterschiede 4: Veit-stanz 42: Ulrich Bräcker (statt Bräker) 56: humanis-tischen, Spra-cherneuerers 66: al-tenglischer 74: Verste-cken 90: Federfuchser-eien 93: Handwerk-serzeugnis (Weitere Trennfehler ab hier nicht mehr erwähnt, schätzungsweise hundert.) 87: nicht notwendigsten (statt: die notwendigsten) 89: Richte für ungut! (statt: Nichts für ungut!) Durch falsche Kursivierung wird Schopenhauer die Klage unterstellt, daß manche Leute dann statt gewiß sagen. (95) Abgesehen von falschen Trennungen sind die meisten Fehler beim Einscannen und Umsetzen der Fraktur entstanden: 119: Moellendorfs statt Moellendorff 128: seinem Sprachklanggefühl statt feinem Sprachklanggefühl 137: lobte statt tobte 137: Wirtschast statt Wirtschaft 146: das rollende N statt das rollende R (an einer Stelle, wo es gerade auf den Unterschied von N und R ankommt!) 160: Fremdwörtern statt Fremdwörtlern 170: sohoffe 192: Geschmückte statt Geschmäckle 194: Halter statt Haller 207: mit seinen Wörtern statt mit feinen Wörtern 208: der punctus saliens statt das punctum saliens 225: videantor statt videantur Wilhelm hält Mignon auf und nicht aus, wie es in der Neuausgabe heißt! (227) 227: 2tanzenden statt tanzenden 232: frz. es statt est 232: Abschottungen statt Abschattungen 233: des Wagen statt des Wagens 245: archiprét statt archiprêt 245: légere statt léger 246: greifender Wein stat greisender Wein 259: philósophia statt philosóphia 308: Subfellien (zweimal) statt Subsellien 324: lasten statt lassen 327: Fremdwörtern statt Fremdwörtlern 339: Lebenslust statt Lebensluft 358: oú statt où 362: Sino statt Si no, é statt è (zweimal), troyato statt trovato, captationes statt captatiis, Werten statt Werben, Duobus statt Inter duobus 381: Kation statt Nation 396: wäret statt waret 398: vielen statt Vielen 403: Zeitwörter auf ietert statt Zeitwörter auf ieren 413: Clement statt Element; Versicherern statt Bereicherern 415: intérét statt interêt 420: Konsifchen statt Konfifchen 437: platzgreift statt Platz greift 439: Doch jeder Fremdwörtler statt Noch jeder Fremdwörtler 448: Gelehrtentaste statt Gelehrtenkaste 452: die nichtigen Ausländer statt die tüchtigen Ausländer 495f.: (Demosthenes ist zweimal falsch getrennt) 496: Mannesreise statt Mannesreife 497: compoposito (wie im Original, nicht korrigiert) 498: arrét statt arrêt 501: Trit statt Tritt 513: fünf Zeilen (usw. stimmt im Neusatz nicht mehr) 532: (falsche griechische Transkription 557: Interrupt statt interrupt; überflüssiges statt Überflüssiges 566: 313 statt 554 577: (falsche griechische Transkription) 589: sehen statt setzen 596: (Die Aussagen über den eigenen Gebrauch der Anführungszeichen stimmen im Neusatz nicht mehr.) 616: Tatsachensatztz 617: ober statt oder 646: plancuit statt placuit 650: la viea statt la vie 651: gerade um statt gerade nur, Hinsehen statt Hinsetzen 703: Geschichtschreibern statt Geschichtschreiber 714: (falscher griechischer Spiritus) 719: auslösenden statt auflösenden 720: voranstellenden statt voranstehenden 736: jeder großem statt jeder großen 742: Protestes statt Protesten 787: lli statt Ili 878: erhoffen statt er hoffen 910: (Seitenverweis), Försters statt Forsters 915: Lohe statt Lotze |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.09.2016 um 16.08 Uhr |
| Nicht nur als Plagiator macht Reiners eine schlechte Figur, auch durch die zeitgeistgemäße Aussparung und nach dem Ende des Dritten Reiches ebenso zeitgeistgemäße Einfügung unerwünschter Autoren: Thomas Mann, Heinrich Heine, aber immer noch nicht Franz Kafka oder Kurt Tucholsky. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.09.2016 um 14.45 Uhr |
| “Den Stil verbessern heißt: den Gedanken verbessern.” (Ludwig Reiners) (http://satzdreh.de/) Soweit ist es schon gekommen. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 21.09.2016 um 15.41 Uhr |
| "verschwiegen sein" und "verschwiegen werden" ist eines von den Beispielen, über die ich jedesmal stolpere und überlegen muß, ob ein Zustand oder ein Vorgang gemeint ist. Man sollte sich eindeutiger ausdrücken. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.09.2016 um 18.01 Uhr |
| Im Ernst? Habe gerade mal Google News durchgesehen: Seite um Seite keine einzige zweideutige Stelle. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 21.09.2016 um 18.19 Uhr |
| "Er war verschwiegen" und "er wurde verschwiegen" bedeutet nicht dasselbe. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.09.2016 um 04.20 Uhr |
| Natürlich nicht (wie tausend andere Homonyme und Polyseme)! Aber meine Frage ist, wann und wo Sie darüber stolpern können, wo doch praktisch alle wirklichen Beispiele durch Kontext und Konstruktion überhaupt keinen Zweifel lassen? |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 23.09.2016 um 14.23 Uhr |
| Manchmal ist es ein Nachteil, daß die deutsche Sprache keine eigene Form für ein Partizip Perfekt Aktiv hat. Das Partizip Perfekt kann sowohl ein Adjektiv sein, welches keine passivische Bedeutung hat, als auch als gleichlautende Verbforn passivisch sein. Das muß dann durch "sein" oder "werden" verdeutlicht werden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.09.2016 um 16.00 Uhr |
| Denken Sie an solche Fälle wie das bekannte verrückt? Der verrückte Schrank ist von jemandem verrückt worden, der darüber verrückt geworden ist. Wie man sieht, reicht sein/werden nicht einmal aus, die Sprache hält aber andere Mittel bereit. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 24.09.2016 um 02.21 Uhr |
| Zu 10601: Auf www.satzdreh.de findet man z. B. auch sowas: Während meines [Deckers] Studiums fokussierte ich Forschungen zur Historik der deutschen Sprache und Kultur und beschäftigte mich intensiv mit Kommunikation und Textoptimierung – zum Beispiel durch Analysen der BILD-Zeitung, der Übertragung von Verhandlungsstrategien im Harvard-Konzept auf zwischenmenschliche Streit- und Diskussionsformen oder dem Vergleich von Technologien gegenüber geistigen Möglichkeiten der Textoptimierung. Ein Text in korrekter Rechtschreibung und Grammatik schenkt dem Leser Vertrauen in die inhaltliche Richtigkeit Ihrer Ausführungen.Ein schlechter Satz hingegen reicht aus, um das Wohlwollen Ihrer Leser zu verlieren. Der zweite Teil ist sehr richtig, daran sollte sich auch der erste Teil orientieren: ... beschäftigte mich ... mit [etwas] - z. B. durch Analysen der ..., der Übertragung ... oder dem Vergleich ... Was für ein Kauderwelsch. Und zu jemandem, der in seiner eigenen Werbung für sich selbst so fehlerhaft schreibt, soll man Vertrauen haben, "Wohlwollen" empfinden? Da wundert es auch nicht, daß er Reiners als Plagiator nicht kennt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.09.2016 um 06.01 Uhr |
| Zur Homonymie s. a. hier: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1576 Meistens klappt es mit mehrdeutigen Wörtern recht gut, aber manchmal kommt schon der Wunsch nach Eindeutigkeit auf. So haben wir uns zwar daran gewöhnt, daß Montag bis Freitag im Geschäftsleben fünf Tage umfaßt, aber die Süddeutschen haben eine bessere Lösung gefunden: Montag mit Freitag, also ähnlich wie englisch through. Unser umständliches bis einschließlich zeigt ja nur, daß hier etwas fehlt. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 26.09.2016 um 22.41 Uhr |
| "fassungslos" sind viele LED-Leuchten, denn sie haben keine Fassungen für den Austausch defekter LEDs. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.08.2019 um 16.29 Uhr |
| Treitschke warf Heine sogar vor, er habe wegen seines Judentums kein einziges Trinklied gedichtet und nicht richtig zechen können. Eduard Engel konterte, das könne man auch von Mörike sagen, aber vor allem: Aber Heine hat in der Tat einen der besten Beiträge zur deutschen Kneipseligkeit geliefert: das Gedicht vom Bremer Ratskeller „Im Hafen“ (1826). (Geschichte der deutschen Literatur II:167) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.05.2023 um 04.55 Uhr |
| Bei C. H. Beck ist der „Ewige Brunnen“ „neu ausgewählt und herausgegeben von Dirk von Petersdorff“ erschienen, ohne daß in der breiten Anzeige der Name Ludwig Reiners erscheint. Man fragt natürlich gleich, wieso „neu“ - was war denn vorher? Reiners ist besonders nach Stefan Stirnemanns Enthüllungen eine Unperson, aber das Geschäft mit ihm geht unter anderem Namen weiter. Sonst hätte v. Petersdorff ja eine anders betitelte Anthologie herausgeben können. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.07.2023 um 06.40 Uhr |
| Zum vorigen: In der SZ-Empfehlung von Sommerlektüre stellt Hilmar Klute das Buch vor, wieder ohne Erwähnung von Reiners und ohne Hinweis auf die lukrative Titel-Fledderei. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.02.2024 um 17.57 Uhr |
| Aus dem Ramschkasten gefischt: Alfred Webinger: Artbewußtes Sprachdenken. Zweite, vermehrte Auflage. NS-Gauverlag, Graz 1944. Im Stabreim hört Webinger „die entschossene Einsatzbereitschaft in den Kampf ziehender Sippenverbände“ usw. In der Stammsilbenbetonung des Germanischen „siegte der Inhalt gegen die Form, das Gefühl gegen den Verstand“. Verstand ist überhaupt schlecht, jüdisch, welsch. Die Juden wurden bei uns lange „verhätschelt“, aber jetzt wird ihre „Gaunersprache“ aus dem Deutschen ausgemerzt. Aber auch die Engländer, obwohl Germanen, denken bloß geschäftsmäßig. Das Deutsche ist so reich an Gemüt, daß es nicht in andere Sprachen übersetzt werden kann Webinger veröffentlichte nach 1945 noch viel Belehrendes und auch Heiteres. Die Juden waren ja dann mal weg. |
| Als Schutz gegen automatisch erzeugte Einträge ist die Kommentareingabe auf dieser Seite nicht möglich. Gehen Sie bitte statt dessen auf folgende Seite: |
| www.sprachforschung.org/index.php?show=newsC&id=563#kommentareingabe |
| Kopieren Sie dazu bitte diese Angabe in das Adressenfeld Ihres Browsers. (Daß Sie diese Adresse von Hand kopieren müssen, ist ein wichtiger Teil des Spamschutzes.) |
| Statt dessen können Sie auch hier klicken und die Angabe bei „news“ von Hand im Adressenfeld ändern. |
