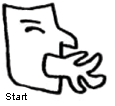


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Reinhard Markner
Wenn Forscher Normen fordern
Für die Publizität einer bemerkenswerten Entdeckung war der Zeitpunkt ungünstig. Aufständische Republikaner rückten gerade von Baden aus auf Frankfurt vor, als Philipp Wackernagel, Lehrer am Herzoglich Nassauischen Realgymnasium im nahegelegenen Wiesbaden, am 10. April 1848 seine orthographische Theorie erstmals vorstellte. Inmitten revolutionärer Geschehnisse fundierte er sie auf einem konformistischen Grundsatz: „Die hauptregel der orthographie, die wir so scharf in kainer grammatik ouzgesprochen finden, haizt ganz ainfach: schreib wie die andern.“
So scharf und schlicht zugleich war in der Tat das Prinzip der Orientierung am herrschenden Sprachgebrauch noch nicht formuliert worden. Daß Wackernagel in der Öffentlichkeit und seitens der noch jungen Germanistik wenig Anerkennung fand, lag allerdings nicht nur an den widrigen Zeitumständen, sondern auch an dem eigenartigen Mißverhältnis zwischen Inhalt und Form seiner Darlegungen. Der Grammatiker Felix Sebastian Feldbausch, ein Gegner „unbegründeter Neuerungen“ auf dem Gebiet der Rechtschreibung, spottete, Wackernagel habe in Wahrheit eine ganz andere orthographische Regel befolgt: „Schreibe wie gar Niemand in ganz Deutschland zu schreiben pflegt.“
Die wissenschaftliche ebenso wie die dilettantische Beschäftigung mit der deutschen Orthographie hat nicht erst seit 1848 viel Selbstwidersprüchliches und Versponnenes, aber nur wenige gesicherte Erkenntnisse hervorgebracht. Man behalf sich lange genug mit Leitsätzen wie jenem des Sprachforschers Johann Christoph Adelung, an dessen Stelle Wackernagels „Hauptregel“ hätte treten sollen: „Schreib das Deutsche . . . mit den eingeführten Schriftzeichen, so wie du sprichst, der allgemeinen besten Aussprache gemäß, mit Beobachtung der erweislichen nächsten Abstammung und, wo diese aufhöret, des allgemeinen Gebrauches.“ Diese 1788 aufgestellte Devise wurde zwar in der untauglichen Kurzform „Schreib, wie du sprichst“ zum geflügelten Wort. Tatsächlich jedoch war Adelung, mehr als selbst der vollständige Wortlaut erwarten ließ, in seinem großen vierbändigen Wörterbuch weitgehend dem „Usus scribendi“ der Leipziger Verleger gefolgt. Immerhin leistete er damit einen kaum zu überschätzenden Beitrag zur Vereinheitlichung der deutschen Rechtschreibung.
Für sein eher pragmatisches als prinzipientreues Verfahren gab es also gute Gründe; die Bestimmung der „allgemeinen besten Aussprache“ war in einem vielstaatigen Sprachraum, der noch von der Maas bis an die Memel reichte, eigentlich undurchführbar. Bezeichnenderweise notierte ein Besucher im Juni 1798, wie auffallend „der Unterschied zwischen dem Schriftsteller und dem Sprecher“ im Falle Adelungs sei. Der Dresdner Gelehrte spreche weder Französisch noch Latein, das Deutsche aber „ ziemlich nachlässig und gemein, anders als man nach dem Schriftsteller erwarten sollte“.
Wie treffend diese Beobachtungen waren, läßt sich leider nicht bestimmen. Was man über Adelungs eigene Aussprache allenfalls sagen kann, muß sich auf seine Schriften stützen, sein Wörterbuch zumal, das heute in digitalisierter Form bequem zugänglich ist. Aber auch die „Deutsche Sprachlehre“ lohnt die Lektüre mit klar formulierten Einsichten wie dieser: „Da also einzelne Glieder der Gesellschaft nicht befugt sind, den Sprachgebrauch eines Volkes zu ändern, so haben sie auch kein Recht, sich an dem Schreibegebrauch zu vergreifen, am wenigsten aber, wenn solches aus willkührlichen und ungegründeten Grundsätzen geschiehet.“
Adelungs Mahnung blieb ungehört. Zahllose Eiferer ersannen im 19. Jahrhundert immer neue „fereinfaxte“ Orthographien, die zumeist das Ziel der absoluten Lauttreue verfolgten, „damit dän nixtliteraten, überhaupt däm folke“ nicht nur das Schreiben selbst, sondern zugleich auch „di rixtige ausspraxe erleixtert værde“ (so Vilhälm fon Hinüber, 1880). Die Autoren, zumeist Schulmeister, sahen sich zwar nicht selbst befugt oder befähigt, den Sprachgebrauch zu ändern, glaubten aber, daß dem Staat dieses Recht ohne weiteres zukomme. Ohnehin bestritten sie, daß für den Schreibgebrauch dasselbe gelte wie für die Sprache im ganzen, da sie die Schrift für ein bloßes Derivat der gesprochenen Sprache ansahen.
Das „phonetische Prinzip“ trug zwar wenig genug dazu bei, die Verschriftung des Deutschen linguistisch zu erfassen. Es gewann gleichwohl viele Anhänger in einer Epoche, die in der Sprachgeschichte immer neue „Lautgesetze“ entdeckte. Die Frage, in welchem Maße es zur Geltung gebracht werden könne, bestimmte den Verlauf einer 1876 in Berlin abgehaltenen Orthographischen Konferenz. Seine Durchsetzung bewegte auch die Rechtschreibreformer der Jahre 1941-44, deren weit gediehene Vorhaben kurzfristig als „nicht kriegswichtig“ auf die Zeit nach dem Endsieg verschoben werden mußten. Und an das Prinzip der Unterordnung der Schrift unter die Sprache wird auch noch in dem 1996 verabschiedeten Regelwerk appelliert, wenn es einleitend heißt, daß sich die „Zuordnung von Lauten und Buchstaben“ in der deutschen Rechtschreibung an der „Standardaussprache“ orientiere.
Diese Zuordnung grundlegend zu ändern ist den Reformern trotz intensiven Bemühungen nicht gelungen. Ihr Projekt sollte eigentlich eine Systemveränderung mit sich bringen; übriggeblieben sind einige Änderungen ohne System. Die Tilgung des h in „rauh“ erinnert noch an einstige Kampagnen gegen die „Dehnungsbuchstaben“, die unvertraute Schreibung diverser Fremdwörter an umfassende Germanisierungsbestrebungen. Was die Kultusminister an Eingriffen zuließen, vermag nur zu verstehen, wer die ursprünglichen Planungen kennt.
„Die Zahl der Einzelfestlegungen und Ausnahmen ist mit der Neuregelung kaum kleiner geworden“, stellten die Schweizer Reformer Peter Gallmann und Horst Sitta 1996 fest, und statt „kaum“ müßte es richtiger „keineswegs“ heißen. So verhält sich der allgegenwärtige „Tipp“ als Ausnahme zu den in der Schreibung unangetasteten englischen Internationalismen. Tatsächlich hatte der Vorsitzende der Reformkommission, der Siegener Linguist Gerhard Augst, einst die Eindeutschung auch der anderen Wörter gleichen Typs gefordert, so zum Beispiel „Bopp, Flopp, Hitt, Popp, Sett, Stripp“. Warum zuletzt nur bei „Stepp“ und „Tipp“ der Schlußkonsonant verdoppelt wurde, weiß niemand zu sagen. Augst hatte seinen Vorstoß mit dem Eingeständnis verbunden, daß „früher übliche Integrationen auf diesem Gebiet heute nicht mehr vorgenommen werden“. Diese richtige Erkenntnis hinderte ihn nicht daran, hartnäckig an der Durchsetzung der unzeitgemäßen Germanisierungen zu arbeiten.
Auch der umstrittenste Teil des Regelwerks, die zur Spaltung unzähliger Wörter führende Kodifizierung der Zusammenschreibung, ist in der ausdrücklichen, für Linguisten ganz unstatthaften Absicht entworfen worden, dem Sprachwandel entgegenzuwirken. Ähnlich verhält es sich mit der Wiedereinführung längst obsoleter Großschreibungen („Recht haben“, „im Voraus“) oder der überraschenden Exhumierung einer einst gegen Adelung von Johann Christian August Heyse propagierten ss/ß-Regel. Von der Öffentlichkeit wurden die restaurativen Züge dieser Maßnahmen kaum wahrgenommen, weil sie durch den unverwüstlichen Begriff „Reform“ von der Aura der Fortschrittlichkeit umweht waren. Die Sprachwissenschaft wiederum war unaufmerksam, weil niemand mit dem Erfolg der schon so oft gescheiterten Bestrebungen zur Veränderung der deutschen Orthographie rechnete.
Einer ihrer namhaftesten Vertreter äußerte sich erst, als die neuen Regeln bereits in den Schulen unterrichtet wurden. Im dritten Band seiner „Deutschen Sprachgeschichte“ gab Peter von Polenz zu Protokoll, daß er die „neuen Richtungen ,vermehrte Großschreibungen‘ und ,Getrenntschreibung‘ als opportunistische Reformertaktiken zur Rettung ihres Berufungsbewußtseins nach dem Scheitern der Kleinschreibungsreform“ ansehe. Das war deutlich, kam aber sehr spät. Zu diesem Zeitpunkt konnte man die gravierenden linguistischen Mängel und Widersprüche der amtlichen „Orthografie“ nicht mehr nur als das Resultat eigentümlicher Verirrungen zweitrangiger Fachkollegen abtun. Auf Betreiben der Kultusminister entwickelten sie sich bereits zu einem Problem der gesamten Sprachgemeinschaft, dessen Lösung voraussichtlich noch etliche Jahre beanspruchen wird.
Philipp Wackernagel ist vergessen oder allenfalls noch Experten der evangelischen Hymnologie ein Begriff. Die Reformer unserer Tage hingegen haben sich ihren Platz in der deutschen Sprachgeschichte erkämpft. Wir müssen sie uns als glückliche Menschen vorstellen.
Rheinischer Merkur, 29. 1. 2004
Zu diesem Aufsatz gibt es noch keine Kommentare.
| Als Schutz gegen automatisch erzeugte Einträge ist die Kommentareingabe auf dieser Seite nicht möglich. Gehen Sie bitte statt dessen auf folgende Seite: |
| www.sprachforschung.org/index.php?show=aufsaetzeA&id=10 |
| Kopieren Sie dazu bitte diese Angabe in das Adressenfeld Ihres Browsers. (Daß Sie diese Adresse von Hand kopieren müssen, ist ein wichtiger Teil des Spamschutzes.) |