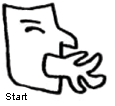


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
24.10.2014
Sprache und Erinnerung
Bemerkungen zu einem alten Problem
Warum können wir uns im allgemeinen nicht an Ereignisse aus den ersten drei Lebensjahren erinnern? In einer populären Zeitschrift heißt es in Anlehnung an den Psychologen Hans Markowitsch:
So sehr Sie sich auch bemühen - an die ersten drei Jahre seines Lebens wird sich Ihr Kind später nicht erinnern können. (...)
Die Drei Faktoren für die Erinnerung
Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass drei Faktoren zusammenkommen müssen, damit man sich später an bestimmte Ereignisse erinnern kann:
1. Die Sprache
Erst wenn wir unsere Muttersprache nahezu beherrschen, fängt das autobiographische Gedächtnis, in dem wir persönliche Erlebnisse aufbewahren, an zu funktionieren. Hans Markowitsch: "Erlebnisse, die wir als Kinder noch nicht mit Worten beschreiben konnten, sind für uns als Erwachsene nicht mehr abrufbar." Das heißt: Die zerbrochenen Christbaumkugeln sind zwar irgendwo im Hirn ihres Kindes abgespeichert, aber es wird ihm nicht gelingen die Erinnerung später hervorzukramen.
2. Die Hirnreifung
Das Gehirn eines Kleinkindes ist mit dem eines Erwachsenen nicht vergleichbar. Erst in der Pubertät hat sich das Netzwerk von Nervenzellen so weit ausgebildet, dass die Bedingungen zur Abspeicherung von Erinnerungen optimal sind. Bei Babys und Kleinkindern funktioniert das Gedächtnis noch auf sehr einfache Art, es entwickelt sich erst über die Jahre hinweg zu einem komplexen System. Ganz am Anfang erinnern sich Babys nur an Dinge, die fast reflexhaft ablaufen: zum Beispiel daran, dass sie an der Brust saugen müssen, um satt zu werden. Oder an den Geruch der Mutter. Später erinnern sie sich daran, wer Opa ist und dass die Herdplatte heiß sein kann. Erst ab einem Alter von etwa drei Jahren ist die Hirnentwicklung so weit, dass auch das autobiographische Gedächtnis, das persönliche Erlebnisse speichert, zu funktionieren beginnt.
3. Die Ich-Entwicklung
Im Alter von zwei bis drei Jahren entwickeln Kinder eine Vorstellung davon, wer sie sind, und dass sie ein eigenständiges Leben führen. In dieser Phase lernen sie, sich in den großen Zusammenhang der Welt einzuordnen und zu erkennen, was gestern, heute oder morgen ist. "Solange Kinder kein Verständnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben, können sie auch keine Erinnerungen abspeichern oder wieder hervorrufen", sagt Gedächtnisforscher Markowitsch.
Der dritte Punkt ist auffälligerweise nicht operationalisierbar. Verhaltensänderung, also Lernen findet schon im Mutterleib statt und ist von Dauer; das ist für alle Sinnesmodalitäten nachgewiesen. Nur die besondere Leistung des Berichtens aus der Kindheit – nur das nennen wir „Erinnerung“ (im Text „bewusste Erinnerung“) – reicht nicht so weit zurück.
Es käme nun darauf an, das Erlernen solcher Berichte zu studieren. (Das geschieht natürlich längst, ich weiß.) Interessant ist der Anfang, wenn man Kinder erzählen läßt, was "gestern" war, vor allem wenn man selbst dabeigewesen ist. Dann kann man beobachten, wie das Kind aus Gedächtnisspuren etwas konstruiert und stilisiert. Unter drei Jahren hat es noch nicht die "Kategorien". d. h. auch: die Interessen, die annähernd denen der Erwachsenen entsprechen, die eine verständliche Erzählung in unserer Sprache erst ermöglichen. Damit sind wir wieder bei Wittgensteins Löwen: Könnte er sprechen, wir würden ihn nicht verstehen.
Die mentalistische Darstellung unter Punkt 3 macht aber eine Forschung von vornherein unmöglich.
Es melden sich Leser, die ziemlich aufgebracht berichten, sie könnten sich an die ganze Zeit nach der Geburt genau erinnern, das Blaulicht über dem Frühgeborenen (offenbar gegen neonatalen Ikterus) usw. - das sind bestimmt Einbildungen.
| Kommentare zu »Sprache und Erinnerung« |
| Kommentar schreiben | neueste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von R. M., verfaßt am 25.10.2014 um 01.45 Uhr |
|
Kleinkinder können sich durchaus an zurückliegende Ereignisse erinnern und darüber sprechen. Folglich kann das Vergessen nicht ursächlich an der mangelnden Fähigkeit zur Versprachlichung liegen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.10.2014 um 07.39 Uhr |
|
Das ist richtig, nach meinen Protokollen treten erste Erzählversuche etwa mit 18 Monaten auf. Die Anordnung auf einem "Zeitstrahl" macht noch einige Zeit Schwierigkeiten. (Manche Völker scheinen nur zwischen heute und nichtheute zu unterscheiden.) Trotzdem ist es möglich, daß sich die "Kategorien", wie ich es vorläufig genannt habe, so entwickeln, daß die "Erwachsenentechnik" des Erzählens keinen unmittelbaren Zugriff mehr auf die frühen Erinnerungen hat. Sie werden, anders gesagt, durch das Tradieren selbst ständig umgestaltet, im Wechselspiel mit der Stilisierung durch die Erwachsenen. (Analogie zur geschichtlichen Überleiferung liegt nahe.) Aber das sind nur Vermutungen, ich habe die Sache nicht erforscht. Man muß auch bedenken, daß das Kind entgegen landläufiger Auffassung keine eigene Sprache hat, die "sich entwickelt" sondern von Anfang an mit Bruchstücken der Erwachsenensprache wirtschaftet, in der die Teile aber ganz anders geordnet sind. Überspitzt gesagt: Das frühe kindliche Erzählen ist nur scheinbar in der gleichen Sprache abgefaßt wie das spätere. Mentalistisch gefaßt: Das Kind "erlebt" die Welt in einer Weise, die es später nicht mehr nachvollziehen und auf Begriffe bringen kann und die daher immer nebulöser wird und schließlich weitgehend versinkt (oder durch eingebildete, aus Erwachsenenerzählungen stammende "Erinnerungen" ersetzt wird). |
Kommentar von R. M., verfaßt am 26.10.2014 um 02.03 Uhr |
|
Es läßt sich wohl sagen, daß die Fähigkeit zum Erinnern bei Kleinkindern derjenigen zum Wiedererkennen untergeordnet (oder jedenfalls, wenn man es nicht in dieser Weise kategorisieren möchte, schwächer entwickelt) ist. Letztere Fähigkeit wird durch die Namengebung unterstützt, also z. B. »Oma« für eine Person, die das Kind nicht täglich sieht. (Der Name kann von den Erwachsenen vorgegeben oder auch selbst gewählt sein.) Aber ein Kind, das mit zwei Jahren ohne weiteres diese Person als »Oma« (wieder)erkennen und benennen kann, wird sich trotzdem später nicht an sie erinnern können, falls sie stirbt, bevor das Kind vier ist.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.11.2014 um 08.43 Uhr |
|
Kleine Kinder können schon ziemlich gut sprechen und auch erzählen, was sie erlebt haben. Aber wenn man ihnen zuhört und sie beobachtet, merkt man, daß sie das "Realitätsprinzip" der Erwachsenen, also eine bestimmte Art der Disziplinierung, noch nicht völlig verinnerlicht haben. Tagträumereien und Wunschdenken werden als Wirklichkeit genommen; sie berichten auch als Selbsterlebtes, was sie in Wirklichkeit von anderen gehört haben usw. Das alles muß "vergessen" werden. Das habe ich gemeint mit der Bemerkung über unterschiedliche "Kategorien", in denen die Welt von Kindern und von Erwachsenen wahrgenommen und verarbeitetet wird. Davon muß man ganz abtrennen, daß die Konditionierung und insofern auch das "Gedächtnis" natürlich schon im Mutterleib beginnen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.12.2014 um 04.48 Uhr |
|
Wie schon mehrmals besprochen: Der Eindruck, man könne sich etwas genau vorstellen, sehe es geradezu vor sich, ist meist nicht durch die Tatsachen gerechtfertigt. Dieser Eindruck, ein Vertrautheitsgefühl, wird offenbar separat erzeugt. So auch bei Erinnerungen. Ich kann mir, so meine ich, den Geruch der Klassenzimmer in meiner Grundschule vor über sechzig Jahren genau vorstellen: eine Mischung aus Bohnerwachs, feuchtem Tafelschwamm (mit Kreide) und Schweiß. Aber es ist nicht anzunehmen, daß diese Einzelheiten eine Entsprechung im Gehirn haben. (Anderswo habe ich den Geruch der alten Pariser Métro erwähnt, den ich ebenfalls während meiner Schulzeit kennengelernt hatte: Schmieröl plus Reinigungsmittel meiner Ansicht nach. Ich könnte ihn jederzeit vom Klassenzimmergeruch unterscheiden. Der Nervus olfactorius ist, wie man heute weiß, kein Hirnnerv, wird aber praktischerweise immer noch in den bekannten Sprüchlein als deren erster angeführt. Die Physiologie ist hier nicht ganz unwichtig, weil mit der Archaik des Geruchssinnes möglicherweise die sprachliche Abdeckung dieses Bereichs zusammenhängt.)
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 11.12.2014 um 11.39 Uhr |
|
Wiedererkennen ja, aber kann man sich einen Geruch vorstellen? Nur am Rande: Der besondere Geruch der Métro hängt damit zusammen, daß es sich nicht um eine Eisenbahn, sondern um einen Spurbus handelt, jedenfalls auf einigen Linien. Dort hängt dann Gummiabrieb in der Luft. |
Kommentar von dickbrettbohrer, verfaßt am 11.12.2014 um 11.48 Uhr |
|
Literaturtip: Barry Sanders: Der Verlust der Sprachkultur (antiquarisch) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 11.12.2014 um 15.26 Uhr |
|
Ich kann mich noch gut erinnern, wie in meiner Kindheit Busse und Züge gerochen haben. Ich glaube, die Gerüche haben sich gar nicht so sehr verändert, aber ich habe sie damals viel intensiver wahrgenommen, weil ich als Kind das Busfahren nicht vertragen habe. Deshalb wollte ich möglichst immer mit der Bahn fahren. Schon vom Geruch eines Busses wurde mir fast so schlecht wie vom Fahren. Obwohl sich das später völlig gegeben hat, kann ich mir die für mich sehr intensiven Gerüche von damals noch gut vorstellen. Eigentlich war es das Geschaukel, das ich nicht vertragen habe, aber die Gerüche wurden mir zu einer Art Pawlowschem Reiz. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.12.2014 um 06.05 Uhr |
|
Wie bei allen sogenannten "Vorstellungen" (ein folkpsychologisches Konstrukt) muß man es hier beim Appell bewenden lassen. Also ich möchte behaupten, daß ich mir einen Geruch genau vorstellen kann. (Vielleicht läßt sich sogar eine physische Reaktion messen, wie ja auch manche Leute schon bei der Vorstellung von Erdbeeren einen Ausschlag bekommen – gar nicht zu reden von Männern, die bei der Vorstellung reizvoller Szenen etwas anderes bekommen...) Mein Standardbeispiel sind frisch aufgeschnittene Gurken, weil sie so wunderbar duften und auch deshalb, weil ich mich immer wieder wundere, daß so ein wäßriges Gebilde es schafft, aus Wasser und Luft derart intensive Duftstoffe herzustellen – und wozu? Bloß damit das ganze Haus danach riecht. Auch beim Riechen scheint Vorwissen eine Rolle zu spielen. Es gibt sicher, wie auch Tiere beweisen, eine angeborene Ab- und Zuneigung, aber wenn wir z. B. seit je mit dem Geruch von Gurken höchste Lebensgefahr verbänden, käme er uns vielleicht abscheulich vor. Wörter und Bilder sollen im Geist gespeichert sein (Paivio u. a.), na ja, das liegt dem naiven Menschen vielleicht nahe, aber Gerüche? Die hat bisher nur die Stasi speichern können. |
Kommentar von Pt, verfaßt am 12.12.2014 um 12.42 Uhr |
|
Zu #27538: Die Gerüche haben sich sehr verändert, die Luft in den Bussen ist sehr viel besser geworden, da das Ausleben bestimmter Süchte in Bussen heute nicht mehr erlaubt ist. Außerdem gibt es heute andere Sitzbezüge, oft Klimaanlage und das Fahrwerk ist besser. Auch das Geschaukel hatte sicher einen Einfluß, insbesondere wenn es zusammen mit schlechten Gerüchen auftrat. Für ein Kind ist beides belastender als für Erwachsene, da die von den Süchtigen produzierten Stoffe stärker auf Kinder wirken, wenn sie gezwungen werden, diese einzuatmen. Die Erwachsenen waren auch schon an diesen Gestank adaptiert und nahmen ihn deshalb kaum mehr wahr. Süchtige sind rücksichtslos, insbesondere gegenüber Kindern. |
Kommentar von Pt, verfaßt am 12.12.2014 um 12.57 Uhr |
|
Zu #27540: Der Geruchssinn ist der älteste Sinn. Wir nehmen nur das wahr, wofür wir Rezeptoren haben. Vielleicht richen Gurken für andere Tiere deshalb anders? An Gerüche kann man sich adaptieren, so daß zwar die Geruchsmoleküle noch vorhanden sind, sie aber nicht mehr wahrgenommen werden. Warum nicht auch Gerüche? Durch die Geruchsrezeptoren werden sie in ein neuronales Erregungsmuster umgesetzt, das ebenso abgespeichert und erinnert werden kann wie die Erregungsmuster, die von den Augen bzw. Ohren kommen. Was der ''Geist'' ist, darüber kann man sich streiten. |
Kommentar von Walter Lachenmann, verfaßt am 13.12.2014 um 00.34 Uhr |
|
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als es um 1948/49, also nach der Währungsreform, wieder alles mögliche gab, von dem wir Kinder schon gar nicht mehr wußten, daß es das überhaupt mal gegeben hat, und ich sozusagen zum ersten Mal einen Zitronensaft zu trinken bekam, also eine ausgepreßte Zitrone mit Wasser in einem Glas angefüllt, mir dieser Geschmack durchaus vertraut war. Ich war 11 Jahre alt, vermutlich gab es damals seit meinem 3. Lebensjahr – zumindest in unserer Familie – keine Zitronen mehr. Mit Bananen ging es mir ähnlich. Die berühmte Madeleine bei Proust handelt ja von demselben Phänomen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.12.2014 um 06.03 Uhr |
|
Zu #27537: Dieses Buch hat im Deutschen zwar einen apokalyptischen Titel und Untertitel, hält aber meiner Ansicht nach nicht, was es verspricht. Ganz gelesen habe ich es freilich nicht, der mäandernde Stil wurde mir bald zuviel. Sanders gibt zahlreiche literaturgeschichtliche Exkurse, z. B. zu Huckleberry Finn, die wenig zum Thema beitragen. Seine Ansichten über die Bedeutung der Schriftlichkeit und Mündlichkeit (sinnloserweise als Oralität und Literalität "übersetzt") bezieht er aus Ong, Havelock usw., sie sind daher auch in derselben Weise falsch, aber noch krasser: Die Greuel unserer Zeit führt er darauf zurück, daß die Menschen wegen des Verfalls der Lesekultur kein "Selbst" mehr entwickeln, denn das sei an die Schriftlichkeit gebunden. Mündliche Kulturen stellt er sich so vor, als palaverten und erzählten die Oralprimaten den ganzen Tag und sonst nichts. Aber keine Kultur hat sich so früh und so eingehend mit dem "Selbst" (atman) beschäftigt wie die weitestgehend mündliche der alten Inder. So kommt gleich am Anfang ein falscher Ton in die Spekulation, und er bleibt bis zuletzt. Das Bild, das sich die ausgewerteten Forscher von mündlichen Kulturen machen, ist nach wie vor weitgehend von Afrika geprägt. Wenn man vormodernes Material sucht, sollte man Indien und China vergleichen, zwei Hochkulturen, von denen die eine stark mündlich, die andere stark schriftlich geprägt ist. Für Verallgemeinerungen zu wenig, aber besser als gar nichts oder als die üblichen Vergleiche. Das Buch ist für ein paar Cent zu beziehen, und das kann man immerhin ausgeben, aber man wird sehen, daß das Thema verschenkt ist, und sollte sich vor den Fehlinformationen hüten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.06.2015 um 05.45 Uhr |
|
Man muß kein Gedächtniskünstler sein, um sich die folgende Ziffernfolge auf Anhieb zu merken: 08008080789. Das muß man nämlich, wenn man einer Hörfunkdiskussion folgt und sich selbst beteiligen will. Auf dem Weg zum Telefon wiederholt man sich innerlich die Verbalisierung, die der Sprecher vorgenommen hat: Nullachthundert achtzig achtzig siebenachtneun. Das klappt ohne weiteres. Wer Kinder hat, weiß, daß sie alles mögliche schnell auswendig lernen. Ein paar Verse, ein- oder zweimal vorgesagt, schon sitzen sie, vielleicht für immer. Wir können das nicht mehr. Das ist eine Tatsache, und es wäre leichtfertig, sie nicht auszunutzen. Wenn man älter wird, weiß man, wie kostbar die Zeit ist und daß man sie nicht vergeuden sollte. Aber die Kinderzeit ist noch kostbarer, und die Kinder wissen nichts davon. Es ist traurig, die Kinder vor der Glotze zu sehen, Tag für Tag. Lesen ist was ganz anderes. Da hört man das liebe Kind in seinem Zimmer schluchzen, erkundigt sich vorsichtig nach der Ursache und findet, daß sie ein Buch gelesen hat, das traurig endet. Sie weiß nicht, daß sie dieses Erlebnis zur guten Hälfte selbst erzeugt hat, freilich nach einer Vorlage, und ihr Vergnügen an tragischen Gegenständen wird sie dazu bringen, sich gleich den nächsten Band zu besorgen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.12.2015 um 06.11 Uhr |
|
Wie Freud und Skinner gezeigt haben, sind unsere Gedankengänge und Redeflüsse gerade dann am übersichtlichsten motiviert, wenn sie ganz frei dahinzuströmen scheinen ("freie Assoziation"). Innersprachliche Reaktionen sind einfacher, unkontrollierter als sachlich oder logisch motivierte. Man denke an den "fliegenden Start" beim Aufsagen oder Musizieren. Manchmal fällt mir (ich habe das schon erwähnt) eine Ziffernfolge nicht ein, obwohl ich sie dringend brauche, z. B. als Kontonummer bei der Universitätsbibliothek oder auch bei der Bank. Sie ist aber nicht verschwunden, sondern am nächstentag wieder da, ganz unbegreiflich anstrengungslos. Hilfsweise überlasse ich die Eingabe meinem Fingergedächtnis, wie ein Pianist. Manche Eigennamen kann ich mir einfach nicht merken. Das kann peinlich sein, wenn ich jemamdem begegne, den ich schlecht fragen kann, wie er eigentlich heißt. Nicht daß ich etwas gegen ihn hätte, es ist nur einfach das Lautgebilde. Heute morgen brauchte ich fast zehn Minuten, bis ich das einfache Zitat "Est modus in rebus" beisammen hatte. Oft muß ich nachschlagen, wie ein englisches Wort ausgesprochen wird, und eine Woche später schon wieder dasselbe Wort. Ich will mir merken, daß es nicht so ausgesprochen wird, wie ich es mir - mit Zweifeln, sonst hätte ich ja nicht nachgeschlagen - vorgestellt hatte, aber nach einer gewissen Zeit weiß ich nicht, ob es so gesprochen wird oder doch eher genau anders herum. Bei manchen englischen Wörtern muß ich seit einem halben Jahrhundert immer wieder die genaue Bedeutung nachschlagen, z. B. heute morgen bei denizen. Es kommt in den Texten gerade so selten vor, daß ich es zwischendurch vergessen kann (jetzt nach diesem Geständnis aber bestimmt nicht mehr). Ziemlich peinlich, aber ich liege ja hier sowieso auf der Couch, und alles muß raus. Was heißt noch mal denizen? Langenscheidt, hilf! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.05.2016 um 14.43 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1626#27536 Wobei mir wiederum aus meiner Kindheit einfällt, daß unser Französischbuch ein Kapitel enthielt: Les trains qui roulent sur l'air. Auch daran habe ich seither bestimmt nicht gedacht. (Luft ist es übrigens nicht.) Die Erinnerung an etwas weit Zurückliegendes, etwa an einen Namen, an den ich 60 Jahre nicht gedacht habe (z. B. G. S., ein Mitschüler in der Grundschule, ein Gastwirtssohn, zu dem ich keine näheren Beziehungen hatte), ist wahrscheinlich unvorstellbar kompliziert im Gehirn begründet. Vielleicht viele weit verteilte Veränderungen an Synapsen, die außerdem stabil sein müssen, auch wenn die Substanz seither mehrmals ausgetauscht worden ist. Auszuschließen sind einzelne Synapsen oder Zellen als Träger der Erinnerung, denn dann wären sie zu anfällig für Störungen (Verletzungen, Erschütterungen). Andererseits müssen die verteilten Veränderungen spezifisch genug sein, um in mir die Motorik zu steuern, die als Aussprechen des Namens verstanden wird. Wenn ich den Namen tatsächlich vollständig reproduzieren kann, ist ausgeschlossen, daß ich mir die Genauigkeit der Erinnerung nur einbilde, wie vielleicht bei einem visuellen oder olfaktorischen Eindruck.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.01.2017 um 05.46 Uhr |
|
Beim Anblick eines Pressefotos: Daß ich von Hannelore auf Kraft komme, ist gewissermaßen noch verständlich, als "fliegender Start", den man als Ungeübter auch beim Klavierspiel usw. braucht. Aber warum komme ich auch von Kraft auf Hannelore? (Und warum wissen wir das immer noch nicht?) Und – schon erwähnt – warum wird das Suchen nach einem Wort mit wachsendem Wortschatz nicht immer schwerer, sondern leichter? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.03.2018 um 08.00 Uhr |
|
Wenn uns ein Wort nicht einfällt, haben wir oft ein Gefühl dafür, wie weit wir noch davon entfernt sind. Wenn es uns "auf der Zunge liegt", hat es Sinn, ein wenig weiterzusuchen. Gestern fiel mir der Name eines früheren bayerischen Ministerpräsidenten nicht ein, und ich wußte zugleich, daß ich nicht den kleinsten Pfad betreten hatte, der mich zu ihm führen könnte, gab es also auf. Heute morgen verstand ich nicht mehr, wie ich "Streibl" je vergessen konnte. Was mag da vorgehen? Das Zungenspitzenphänomen besteht wohl darin, daß auf dem inkrementellen Weg eine oder mehrere Vorgestalten des Endverhaltens bereits ausgebildet, aber nicht so ausgedehnt sind, daß sie die Artikulationsmotorik in Gang setzen könnten. Dieser Zustand wird aber nicht "wahrgenommen" oder "beobachtet" (es gibt weder einen Beobachter noch Wahrnehmungsorgane), sondern allenfalls "bekundet" wie die Endhandlung selbst. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.06.2018 um 17.49 Uhr |
|
Jan und Aleida Assmann bekommen den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Jan Assmann hat sich auch oft über Mündlichkeit und Schriftlichkeit geäußert. Er hat andererseits das Begriffspaar "Gebrauchs- und Gedächtniskultur" eingeführt, was die Sache besser trifft als die bekannte Unterscheidung von Koch/Oesterreicher. Die indische Kultur bleibt aber auch hier der blinde Fleck. Anregend seine Überlegungen zum Monotheismus. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.09.2018 um 09.21 Uhr |
|
Oft passiert mir folgendes: Meine Frau sagt, daß ihr ein bestimmter Name nicht einfällt, und dann fällt er mir auch nicht ein, aber ich habe das Gefühl, daß er mir ohne weiteres eingefallen wäre, wenn sie es nicht gesagt hätte. Vielleicht eine Selbsttäuschung wie so mancher „Zufall“. Vielleicht wird aber auch mein Erinnerungsverhalten dadurch geschwächt, daß meine Frau die Aufgabe vorab als schwierig gekennzeichnet hat. Man hat experimentell festgestellt, daß jemand die Beinchen von vorgestellten Tieren nicht so schnell zählen kann, wenn er aufgefordert wird, sich die Tiere sehr klein vorzustellen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.01.2019 um 07.21 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1626#27540 "Dual coding" implies that verbal and non-verbal systems are alternative internal representations of events. For example, one can think of a house by thinking of the word "house", or by forming a mental image of a house. The verbal and image systems are connected and related, for one can think of the mental image of the house and then describe it in words, or read or listen to words and then form a mental image. (Allan Paivio) Solange nicht geklärt ist, was wirklich vorgeht, wenn man solche konventionellen alltagssprachlichen Schilderungen gibt, kann das nicht als wissenschaftliche Psychologie ernstgenommen werden. Wenn der fiktive Charakter des „Mentalen“ unerkannt bleibt, ist es leeres Gerede. Das hat viele – auch Paivio – nicht daran gehindert, pädagogische Folgerungen abzuleiten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.07.2020 um 07.46 Uhr |
|
Ich erinnere mich an einen Mann nur deshalb, weil mir sein Name immer nicht eingefallen ist und auch jetzt nicht einfällt. Stattdessen fiel und fällt mir der Name "Wittek" ein, aber so heißt er nicht. Das Ganze ist seltsam und auch schade, denn es war ein netter Kerl, der als Seniorenstudent in meiner Vorlesung saß. Das erwähne ich, damit man nicht meint, ich hätte eine Freudsche Hemmung wegen irgendeiner Abneigung. Ebenso: Ich erzähle meiner Familie gern von den überaus prächtigen Gulmohar-Bäumen, die ich in Indien in voller Blüte gesehen habe, aber deren Name fällt mir niemals spontan ein, ich muß immer wieder unter "indian trees" nachsehen, so auch jetzt. Solche Blockaden sind vollkommen individuell, mich würden ähnliche Berichte interessieren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.08.2020 um 05.39 Uhr |
|
Bennett L. Schwartz/Alan S. Brown, Hg.: Tip-of-the-tongue states and related phenomena. New York 2014. Das ist der neueste Sammelband zum Thema. Die Herausgeber fangen gleich mit „retrieval“ usw. an, vertreten also das naive Speichermodell. Der Wortschatz wird als ein mentales „Lexikon“ konzipiert, dessen Struktur erforscht werden müsse. Wer mit dem Speichermodell nichts anfangen kann, hat es schwer, bei solchen Texten nicht die Geduld zu verlieren. |
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 07.08.2020 um 21.15 Uhr |
|
Noch zu #43875: Ich kann mir den Namen der Stadt Oppenheim partout nicht merken. Jedesmal, wenn ich von meinem Besuch dort vor ein paar Jahren erzählen will, geht das Rätselraten wieder los, auch wenn ich mit dem Zug daran vorbeifahre oder irgendwo unverhofft ein Foto von der schönen Stadtsilhouette sehe. So geht es mir auch mit bestimmten Personennamen und einzelnen Wörtern wie »Rustika« oder »frivol«. Das angestrengte Nachdenken führt aber fast immer zum richtigen Ergebnis. Ich durchlaufe dabei in meiner Vorstellung das Alphabet. Jeder Buchstabe wird als Anfangsbuchstabe getestet. Nach einigen erfolglosen Anläufen (Alt…, Ann…, App…, Auf…) ist der nächste Buchstabe dran, bis der richtige ausgemacht ist. Wenn mir spontan ein bestimmter Anfangsbuchstabe einfällt, ist er meistens falsch. Bei der Suche nach »Rustika« hat sich inzwischen eine Art Protokoll eingestellt. Ich stehe vor einer Häuserfassade mit Rustika-Mauerwerk und denke immer als erstes: »Mit M fängt das Wort, nach dem ich suche, nicht an!« Sodann gehe ich wieder das Alphabet durch, bis ich beim R fündig werde. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.08.2020 um 05.26 Uhr |
|
Moreover, the TOT is a metacognitive experience that accompanies the breakdown in retrieval. It is not the retrieval failure itself. (Schwartz/Metcalfe in: Bennett L. Schwartz/Alan S. Brown, Hg.: Tip-of-the-tongue states and related phenomena. New York 2014:28) Wenn man TOT in solchen Begriffen beschreibt, findet man aus den mentalistischen Konstrukten nicht mehr heraus. Personennamen besonders oft betroffen. Das kann aber daran liegen, daß sie keine Synonyme haben, auf die man beim Sprechen unvermerkt ausweicht. Außerdem sind sie noch in einem zweiten Sinn willkürlich, über die reine Konventionalität der Sprache hinaus, ohne Verankerung in anderen Wörtern. Mit fällt der Name des Regisseurs von „Alice in Wonderland“ (Tim Burton) nicht ein, nur Tim Burke... Ich weiß dabei, daß es falsch ist, daß es mir wieder einfallen wird, daß es im Augenblick hoffnungslos ist. Zwei Stunden später kommt es ganz mühelos. Seltsam ist, daß ich mit dem Vornamen den fliegenden Start schon hatte, der die Erinnerung normalerweise erleichtert. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.05.2021 um 16.11 Uhr |
|
Da die Sprache Vorgänge verschlüsselt und damit ermöglicht, diese zu speichern, einzordnen und für den Abruf bereitzustellen, kann sie als „zeitbindend“ bezeichnet werden. (Ruch/Zimbardo: Lehrbuch der Psychologie. Berlin, New York, Heidelberg 1975:84) Vorgänge kann man weder verschlüsseln noch speichern. Warum erzählen Standardwerke solch einen Unsinn? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.06.2021 um 08.22 Uhr |
|
In jedem Dorf gibt es „Gedächtnistraining für Senioren“ oder so ähnlich. Man kennt die Materialien. Sie haben nichts Anregendes, keinen Bezug zum Leben der Menschen. Das Gedächtnis ist aber kein Karteikasten, in den man nach Belieben weitere Karten hineinstecken kann, sondern ein Baum mit weitverzweigten (biographischen) Wurzeln. Das ist längst bekannt, aber man tut so, als wüßte man es nicht. Warum läßt man Menschen nicht aus ihrem Leben erzählen und sich darüber austauschen, was man gemeinsam erlebt hat und was nicht? Meine eigene Erfahrung mit inzwischen verstorbenen leicht dementen Angehörigen, die manche Nachmittagsstunde mit solchen abstrakten Übungen verbracht haben, waren ziemlich ernüchternd.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.02.2023 um 05.13 Uhr |
|
Scheinbar zwingende Logik: Aus meinem Wortschatz von 100.000 Wörtern muß ich jede Fünftelsekunde eins auswählen. Es gibt nicht den geringsten Ansatz zu einer physiologischen Erklärung für diesen Vorgang und schon für die Speicherung selbst. Näher an den physischen Tatsachen und frei von den logischen Verknotungen ist folgendes Modell: Es gibt Milliarden Nervenzellen mit durchschnittlich je 10.000 Verbindungen zu anderen, dazu Kaskaden solcher Verschaltungen; also ein praktisch unendlich großes Netz. Ständig sind große Mengen von Impulsen unterwegs, die sich erregend und hemmend ausdehnen. Sie könnten eine unendlich große Zahl von Muskelbewegungen (auch des Artikulationsapparates) auslösen, aber nur verschwindend wenige gelangen durch Selbstverstärkung und Unterdrückung konkurrierender Impulse (laterale Inhibition) bis an die Peripherie, wo die motorische Exekutive dann tatsächlich stattfindet. Die Matrix, in der diese Auslese (nicht Auswahl) sich ereignet, wird durch Lernen ständig verändert. Die unterdrückten Verhaltensweisen, also auch die möglichen Wörter, sind nicht wie in einem Wörterbuch präsent, sondern nur als Anbahnungen in irgendeinem Stadium. Sie stehen nicht wirklich zur Wahl, und die Anbahnung aus kleinsten Anfängen heraus erfordert nicht viel Platz und Energie. In Assoziationsversuchen und bei Verleistungen (Versprechern usw.) zeigt sich, daß Wörter, die in verschiedener Hinsicht miteinander zusammenhängen (paradigmatisch oder syntagmatisch, s. meinen Aufsatz „Paradigmen als Syntagmen“), gleichzeitig verstärkt werden; sie bilden das Feld im Rennen um die motorische Exekutive. Es gibt keinen Speicher, kein passives Lexikon. Alle Bewegungen, die überhaupt möglich sind, also auch das Aussprechen sämtlicher Wörter, die man je gehört hat oder aus bekannten Bestandteilen neu bilden kann, sind jederzeit möglich und befinden sich sozusagen schon auf dem Weg, wenn nicht das allermeiste ebenfalls jederzeit unterdrückt würde. Umfassende physiologische Aktivität, solange man lebt, ist der Ausgangszustand. Die Vorstellung vom inerten Speicher paßt zu einer traditionellen Psychologie, die ja auch mit „Motivation“ rechnet, weil sie dem Automatenmodell verpflichtet ist (meist ohne es zu wissen): Man steckt den Stimulus hinein und kriegt die Response heraus. Der Radikale Behaviorismus, dem man dieses Modell nachsagt, sieht es gerade andersherum: Leben ist Verhalten. („Men act upon the world“ - so beginnt Skinners „Verbal behavior“). „Motivation“ ist überflüssig, sie wird durch Lernen (Konditionierung) ersetzt, d. h. durch Veränderung der erwähnten Matrix. Es geht nicht darum, den Organismus zu aktivieren, sondern darum, seine Aktivität, die mit dem Leben schon gegeben ist, in eine erwünschte Richtung zu lenken. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 27.02.2023 um 06.10 Uhr |
|
Wenn Sie unter einem Speicher nur ein passives Lexikon (oder irgendwelche ähnlich passiven, festen Ablagen für Bilder, Geräusche usw.) verstehen, dann stimme ich natürlich zu, daß so etwas die mentalen Fähigkeiten höherer Organismen nicht erklären kann. Wie das ganze Lebewesen, so lebt auch der Speicher. Er ist in ständiger Bewegung, es laufen irgendwelche physikalische, chemische und biologische Prozesse ab, Zellen und Gewebestrukturen werden ständig aufgebaut, verändert und vernichtet, elektrische Impulse erzeugt. Wie das Ganze zusammen funktioniert, weiß (noch) niemand. Aber, wenn Wissen und Motorik überhaupt nicht gespeichert würden, wäre es ein Wunder, warum wir uns unter gleichen Bedingungen immer wieder gleich verhalten (können). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.02.2023 um 07.46 Uhr |
|
Wieso denn? Das Lernen, also eine relativ dauerhafte Verhaltensänderung, beruht doch gerade auf Veränderungen jener "Matrix", also "Bahnung", wie man traditionell sagt und bei einfachen Lernvorgängen wie der Habituation auch physiologisch nachgewiesen hat (Eric Kandel). Treten die gleichen steuernden Faktoren wieder auf, wird auch das entsprechende Verhalten sich mehr oder weniger wahrscheinlich wieder einstellen. Anscheinend werden die Synapsen an den Enden der einschlägigen Nerven "durchlässiger", wenn die dadurch gesteuerte Reaktion erfolgreich war. Ich kann mir auch unter einem belebten Speicher nichts vorstellen. Ganz zu schweigen von den logischen Problemen, die ich früher immer wieder erwähnt habe: Wer sucht da eigentlich, und woher weiß er, wonach er suchen muß (schon von Platon im "Theaitetos" aufgeworfene Frage)? Und warum dauert die Suche nicht um so länger, je größer der Wortschatz wird? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.02.2023 um 07.59 Uhr |
|
Bei den flächendeckend verbreiteten Redeweisen von "Speicher" und "Wortwahl" denkt man immer: "Was denn sonst?" Ich habe nun versucht, diese Frage skizzenhaft zu beantworten: Es gibt eine Alternative. Natürlich ist mein kleines Modell spekulativ, weil ich kein Neurologe bin, es verwendet aber nur Begriffe, die physiologisch ratifizierbar sind, und vermeidet jene logischen Verknotungen, die ich sonst immer nur kritisiert habe. Die Wahlmodelle laufen immer auf einen Homunkulus hinaus, da ich als Person es ja nicht sein kann, der wählt. Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#29449 |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 27.02.2023 um 14.42 Uhr |
|
Vorhin nannten Sie den Speicher ein passives Lexikon, das es nicht gibt. Wenn Sie aber "Bahnungen" meinten, früher hatten Sie auch schon einmal das Bild von den sich eingrabenden Gebirgsbächen benutzt, dann ist dies genau der lebende Speicher, von dem ich meine, daß es ohne ihn nicht geht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.02.2023 um 17.32 Uhr |
|
Soweit einverstanden. Aber das ist ja selbstverständlich. Lernen ist als relativ überdauernde Verhaltensänderung definiert. Wenn ich heute ein neues Wort lerne (wie vor zehn Minuten das englisch fey), dann bleibt hoffentlich ein neuer "Pfad" erhalten, der auch morgen noch zu der Verhaltensoption fey führen wird. Danach wird aber nicht gesucht werden, es bildet sich eben unter passenden Kontingenzen sukzessive heraus und stellt sich am Ende als Artikulation ein. Ich hatte, wie mich erinnere, schon mal auf das Modell des "competitive queuing" bezogen (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1162#32454), als Lösung von Lashleys Problem. Auch Bernard Baars mit seinen "competing plans" lag richtig, wobei mich nur die intentionalistische Ausdrucksweise stört (und überhaupt die Polemik gegen den mißverstandenen Behaviorismus). |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 28.02.2023 um 12.29 Uhr |
|
Man baut doch bereits künstliche neuronale Netzwerke. Inwieweit wird da etwas gespeichert? Man könnte DNA-Stränge als Speicher bezeichnen. Was wäre die Entsprechung in einem neuronalen Netz? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.02.2023 um 17.32 Uhr |
|
Interessante Frage. In einem traditionellen Speicher ("spicarium") ist das, was man sucht, tatsächlich abgelegt und aufbewahrt, also z. B. das Getreide. Aus der dauerhaften Zustandsänderung in einem elektronischen (oder optischen) Medium muß das Gesuchte erst über mehrere Stufen zurückgewonnen werden. Einfacher, aber im Prinzip nicht anders, geht es mit einer Vinylplatte. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.02.2023 um 18.53 Uhr |
|
In einem elektronischen Medium sucht man natürlich keine Getreidekörner. Aber genauso, wie man im Getreidespeicher die Körner finden und herausholen kann, kann man in einem elektronischen Speichermedium die darin gespeicherte Information finden und herausholen, d. h. nutzbar machen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 01.03.2023 um 00.59 Uhr |
|
Ich meine, daß ein Speicher immer genau das enthält und wieder herausgibt, was hineingegeben wurde. Das ist sein Wesen. Alles andere wäre kein Speicher. Daß Information in unterschiedlichen, gleichwertigen Formen existiert, daß Energie in unterschiedlichen, gleichwertigen Formen existiert, hat mit dem Speicher nichts zu tun, sondern ist das Wesen von Information bzw. Energie. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.05.2023 um 03.34 Uhr |
|
Laut Bericht der SZ haben Neuropsychologen herausgefunden, wie lange es dauert, bis das Gehirn ein Wort im mentalen Lexikon herausgesucht hat (200 ms) und artikuliert (400 ms) usw. Aber woher weiß „das Gehirn“, welches Wort es suchen soll? (Im Grunde schon von Platon gegen die Speichermodelle des Gedächtnisses eingewandt, nur ohne Neurojargon.) Welcher Teil des Gehirns sucht in welchem anderen? Wie steht es mit dem Heraussuchen von nichtsprachlichen Verhaltenseinheiten? Soll ich noch einen Schluck Kaffee trinken oder aufstehen und zur Tür gehen? Das müßte das Gehirn auch heraussuchen usw. (Mit Hirnscans findet man auch Dinge, die es gar nicht gibt, man findet IMMER etwas und kann es auch messen. Dieses Problem wird selten gesehen, dazu ist der Glaube an die bunten Bildchen zu stark.) Wenn mir ein gesuchtes Wort nicht einfällt, dafür ein anderes Wort, und ich zugleich das Gefühl habe „Das ist es nicht“, dann muß ich, so sagen die naiven Psychologen, das Gesuchte mit dem Gefundenen verglichen haben. Aber wie kann ich etwas vergleichen, was gar nicht vorliegt? Na ja, sagen sie, nicht bewußt, sondern der Vergleich findet im Unbewußten statt. Dort sind alle Katzen grau. Wenn man keine Erklärung hat, soll man sich und anderen auch nicht vormachen, man hätte eine. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.05.2023 um 17.00 Uhr |
|
Sie werden halt eine Reaktionszeit oder Bedenkzeit gemessen haben, die Zeit, die man braucht, um auf ein bestimmtes Wort zu kommen. Manche Wörter fallen mir sofort ein, manche erst nach längerem Nachdenken. Eine Fünftelsekunde, das klingt für mich nicht nach dem Durchschnitt von allen, sondern nach dem Durchschnitt von sehr geläufigen, oft gebrauchten, einzelnen Wörtern. Im normalen Redefluß müßte es aber m. E. noch wesentlich schneller gehen, die einzelnen Wörter zu finden. Das mit dem mentalen Lexikon ist natürlich Unsinn, außer man nimmt es als bildhafte Beschreibung. Wie das Gedächtnis, das Erinnern, das Schlußfolgern, gezielte Bewegungen funktionieren und wo was im einzelnen abläuft, weiß bis jetzt noch niemand. Wir wissen nur, irgendwie muß es gehen, sonst könnten wir es nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.05.2023 um 17.40 Uhr |
|
Es ist paradox, daß man das Ersatzwort mit dem gesuchten Wort vergleichen soll, um festzustellen, daß es nicht das richtige ist. Es ist paradox, daß die Suche nach einem Wort nicht um so länger dauert, je größer der Wortschatz ist. Beides spricht gegen das Speichermodell. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.01.2024 um 17.50 Uhr |
|
Dean Burnett schreibt, jede Nervenzelle sei „a very small biological processor capable of receiving and generating information in the form of electrical activity across the cell membranes that give it structure...“ (Dean Burnett: The idiot brain. London 2017:38) „But for the translator the words and structure of the languages are already stored in long-term memory (the brain even has regions specifically dedicated to language, the Broca’s and Wernicke’s areas...“ (39) „When a specific synapse (or several synapses) becomes active, the brain interpretes this as a memory.“ (41) Ich halte das alles für Unsinn. Auf der Ebene der einzelnen Nervenzelle läßt sich der Informationsfluß mathematisch berechnen, aber in diesem Buch wird der technische Informationsbegriff nicht vom allgemeinsprachlichen semantischen unterschieden. Was soll es heißen, daß das Gehirn etwas „interpretiert“? Das Gehirn steuert u. a. Muskelbewegungen, auch sprachliche, und WIR interpretieren einiges davon als Erinnerungen. Oder eben als Wörter usw. – diese sind aber in keinem vernünftigen Sinn im Hirn gespeichert. Das Gehirn ist durch Lernvorgänge so verändert, daß es zusammen mit den ausführenden Organen Bewegungen steuert, die wir als Wörter erkennen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.01.2024 um 19.28 Uhr |
|
Auch die Londoner Taxifahrer mit ihrem vergrößerten Hippocampus kommen wieder vor. Ich erinnere an den naheliegenden Einwand: Nicht nur Taxifahren, sondern viele andere Fähigkeiten, auf die Menschen spezialisiert sind, beruhen auf Gedächtnisleistungen, müßten also ebenfalls zu einer Vergrößerung des Hippocampus führen. Gelehrsamkeit ist doch nicht auf die Kenntnis des Londoner Straßennetzes zu beschränken. Wie will man das Gehirn eines Taxifahrers vom Gehirn eines Schmetterlingssammlers oder eines Altphilologen unterscheiden?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.01.2024 um 06.17 Uhr |
|
Das naive Speichermodell trifft zusammen mit einer naiven Sprachauffassung: Wörterbuch und Grammatik sind demnach im Kopf gespeichert, und Sprechen ist eine Art Nachschlagen und Vorlesen. In Wirklichkeit muß ein Wort erst in einem Verstellungsverhalten aus dem funktionalen Sprachverhalten mit seinen Auftretensbedingungen (Kontingenzen) herausgelöst werden, damit man es als artikulierbare Wortform (seine Topographie) betrachten kann. Papageienhaft Wortformen nachsprechen ist eine Geräuscherzeugung, nicht Sprache. (Ich habe die Verhaltensbegriffe hinzugesetzt.) Das wird sofort klar, wenn wir eine der vieldiskutierten Synonymenscheidungen betrachten, also etwa das Paar Menschen/Leute. Die beiden Ausdrücke werden in unterscheidenden und nichtunterscheidenden Kontexten gebraucht: Du fragst nicht, was die Leute dazu sagen; denn du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. (Matthäus 22, 16, neue Genfer Übersetzung) Gerade „Leute, die stets das plebiszitäre Element stärken möchten“, wollten nun nicht hören, was die Menschen dazu sagen: „Man kann das Volk nicht nur dann befragen, wenn es einem in den Kram passt.“ (taz 13.10.04) In anderen Fällen bedeutet Leute immer noch das Gefolge, die Mitarbeiter usw.: Der König schickte am folgenden Morgen seine Leute aus, welche die Spur suchen sollten. (Grimms Märchen: Das blaue Licht) Der US-Geheimdienst schickt seine Leute für Entführungen quer durch Europa. (SZ 6.12.06) Eine Ersetzung durch Menschen wäre hier nicht möglich. Ein Spielfilm hieß „Leute sind auch Menschen“. Eberhard war bereits auf dem richtigen Weg: „Menschen (...) heißen die vernünftigen Bewohner unseres Planeten ihrer Natur und ihrem Wesen nach.“ während „das Wort Leute nur auf die Bezeichnung der Menschen in Gesellschaft und Verkehr hinzielt“ Das heißt: Mensch ist ein biologischer Begriff, Leute ein soziologischer. Und zwar bezeichnet Mensch eine Gattung, Leute dagegen eine Funktion, nämlich ein Kollektiv, das zu etwas anderem dazugehört. Der ursprüngliche Sinn „Gefolge“ wirkt noch nach. In Grimms Deutschem Wörtbuch heißt es: „die ursprüngliche bedeutung von leute, volksgenossen, glieder des volks tritt in der uralten allitterierenden formel land und leute für einen erdstrich und die ihn besetzt haltenden sehr lebendig hervor“ Darum heißt es Kleider machen Leute, weil es hier um den gesellschaftlichen Rang geht, und umgekehrt: Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein – wo Faust gerade die gesellschaftlichen Beschränkungen abwirft. Anders gesagt: Mensch ist ein Gattungsbegriff, Leute dagegen ein relationaler oder Zugehörigkeitsbegriff, der sich auf ein Bestandssystem bezieht. Die Unterscheidung löst sich heute auf, weil man von Politikern immer öfter hört, sie sprächen zu den Menschen, erreichten die Menschen nicht mehr o. ä. - wo mancher noch fragen möchte, ob sie selbst denn keine Menschen sind und deshalb das eigentlich erwartbare andere weglassen. Die Beherrschung solcher komplexen Gebrauchsbedingungen, die hier nur angedeutet werden konnten, ist in eine ganze geschichtlich gewachsene Kultur eingebettet und setzt sie voraus. Darum wäre eine genaue Beschreibung mehrere Druckseiten lang. Und dies soll „gespeichert“ sein? Das sind leere Worte, niemand kann damit einen neurologischen Sinn verbinden, der über die triviale Beobachtung hinausgeht, daß wir Menschen das eben können. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.01.2024 um 10.47 Uhr |
|
Burnetts Buch handelt wie tausend andere entgegen dem Titel nicht wirklich vom Gehirn, sondern von einem Konstrukt namens „brain“, in das logische bzw. wald-und-wiesen-psychologische Analysen projiziert werden. Die Darstellung ist voller undurchschauter Metaphern. Der Gedächtnismodell ist das übliche kognitivistische. Drei Stadien werden unterschieden: Enkodieren (encoding) Speichern (storing) Wiederaufsuchen (retrieval) Keiner dieser Schritte ist neurologisch ratifiziert, es gibt keinen Hinweis auf reale Vorgänge im Gehirn, sondern es bleibt bei der begrifflichen Analyse. Es muß doch etwas gespeichert sein, nicht wahr? Und man muß es doch wiederauffinden, oder? Muster ist eigentlich wie seit je eine Registratur, wozu inzwischen nur die elektronische Datenverarbeitung gekommen ist, ohne den begrifflichen Rahmen zu ändern. Die behavioristische Alternative wäre: Lernen erhöht die Wahrscheinlichkeit bestimmter Reaktionen, z. B. des Aussprechens eines Namens oder einer Telefonnummer. Auch damit ist nichts über Hirnvorgänge gesagt, es wird aber auch nicht prätendiert wie in diesem typischen Bestseller des „Guardian“-Autors. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 22.01.2024 um 11.43 Uhr |
|
Ich habe immer wieder den Eindruck, daß ich es letztlich genauso sehe wie Sie, nur daß Sie sich so sehr gegen den Begriff der Speicherung wenden. Dabei, denke ich, ist uns allen doch klar, daß ein Verhalten an materielle Strukturen gebunden ist, die beim Lernen ausgeformt werden. Genau das kann man m. E. Informationsspeicherung nennen. Sie denken bei Speicherung vielleicht zu sehr an konkrete und wohl auch streng voneinander abgegrenzte Speicherung aller möglichen kognitiven und motorischen Fähigkeiten (um mal noch ein anderes Wort für die gespeicherte Information zu benutzen). Was Sie hier über "Menschen und Leute" schreiben, finde ich sehr interessant. Aber natürlich haben Sie das alles irgendwo in Ihrem Körper gespeichert, wo hätten Sie es sonst hergeholt? Es ist nicht als Text, nicht als Bibliothek gespeichert, aber Ihr Verhalten muß irgendwo und irgendwie in Ihrem Körper eine materielle Grundlage haben. Dafür ausdrücklich den Begriff Speicherung abzulehnen, kann m. E. nicht mit einer materialistischen Grundhaltung in Einklang gebracht werden. Verhalten existiert doch nicht losgelöst von der stofflichen Welt. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 22.01.2024 um 12.25 Uhr |
|
Es muß wohl wirklich nur um ein begriffliches Problem gehen. Wenn wir einen ungeordneten Haufen roter und blauer Klötzchen haben und ordnen ihn, links alle blauen, rechts alle roten, dann erhalten wir einen geordneten Haufen. Sie sagen nun, wir haben damit nichts in dem Haufen gespeichert, nichts hineingebracht. Was passiert ist, nennen Sie anders. Ich meine hingegen, doch, wir haben darin jetzt eine Information gespeichert, eine Information hineingebracht. Ist das nicht reine Wortklauberei? Wir meinen im Grunde beide das gleiche. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.01.2024 um 12.27 Uhr |
|
Ich bin kein Materialist. Aber nicht weil ich etwas anderes wäre, sondern weil mir der Begriff nichts sagt. Und noch einmal: Mit "Speicher" muß doch etwas anderes und mehr gesagt sein als mit "Veränderung", sonst brauchte man doch keinen eigenen Begriff dafür. Und es ist ja auch mehr gemeint, so daß Ihre wohlwollende Deutung nicht zutrifft. Die Metapher oder das Modell, das ich aus dem besagten Buch zitiert habe, fügt sich keineswegs Ihrer harmlosen Lesart. Der Autor wäre verpflichtet, eine neuronale Verwirklichung seiner fiktiven Prozeduren (Enkodieren, Ablegen und Wiederhervorholen) zu liefern. Das tut er aber nicht und kann es auch gar nicht – niemand kann es. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.01.2024 um 12.29 Uhr |
|
(Mein Eintrag antwortet auf Ihren vorletzten; hat sich überschnitten.)
|
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 23.01.2024 um 00.21 Uhr |
|
Wenn’s gestattet ist, noch ein Nachtrag zum Thema Leute versus Menschen. Im Niederländischen gibt es die – formalen – Entsprechungen lui(den) und mensen. Auch hierzu könnte man eingehende synonymische Betrachtungen anstellen. Außerdem unterscheiden sich die beiden Wörter in ihrer Verwendung zum Teil von ihren scheinbaren deutschen Pendants. So spricht man zwar von jonge lui, also jungen Leuten, aber ein Satz wie Leute, wir müssen endlich mal zu Potte kommen! würde im Niederländischen mit Mensen beginnen. Als ich vor über dreißig Jahren als junger Übersetzer zum erstenmal vor der Frage stand, wie ich mensen in einem politischen Strategiepapier oder einer Ministerrede übersetzen sollte, empfahlen die Altvorderen je nach Kontext Leute oder Bürger, nur selten paßte Menschen. Das änderte sich nach meiner Erinnerung ungefähr ab Ende der neunziger Jahre. Franz Müntefering war einer der ersten Politiker, in deren Äußerungen es heftig menschelte: Politik für die Menschen usw. So tauchte nach und nach auch in unseren Übersetzungen immer häufiger Menschen auf, wo wir früher diese Lösung verworfen hätten. Das ist für mich übrigens echter Sprachwandel, egal ob ich diese Veränderung persönlich gut oder schlecht finde. Und natürlich sind auch Politiker Menschen. Mit Menschen meinen Politiker heutzutage eben die ganz normalen Leute, die einen Anspruch darauf haben, von den Politikern, also den Experten für Politik, gut regiert zu werden. Allerdings finde auch ich, daß diese Verwendung etwas allzu Joviales hat und einen Gegensatz verschärft, den Politiker sonst gern wegwischen möchten: hier die Politiker, dort die Menschen, also das Volk. Ob das denen, die so reden, bewußt ist? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.01.2024 um 12.43 Uhr |
|
Für "Leute" als Gefolgschaft hat Konrad Adam gerade einen auch inhaltlich originellen Beleg geliefert: Allein in Berlin dürften die drei Koalitionäre in ihren zwei Regierungsjahren an die zweitausend Stellen neu geschaffen und mit ihren Leuten besetzt haben. Was wohl heißen soll: Jeden Tag drei neue Beamte, und keiner von der AfD... |
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 24.01.2024 um 23.58 Uhr |
|
Zum Beitrag von Herrn Metz (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1626#52649): Ich bin kein ausgebildeter Übersetzer, meine aber, der niederländischen Sprache einigermaßen mächtig zu sein. Meiner Intuition und Hörerfahrung (Radio) nach würde ich die Übersetzung des umgangssprachlich formulierten Satzes Leute, wir müssen endlich mal zu Potte kommen! mit "Jongens" (i.S.v. "Kinder", nicht "Jungen") beginnen. Ähnliches gibt es meiner leidvollen Erfahrung in zu vielen langen und fruchtlosen Sitzungen nach auch im Deutschen, wenn jemand die Runde frustriert mit "Kinder", "Kinders" oder "Kinners" anredet. Für offizielle oder wenigstens offiziöse Dokumente mag das aber vielleicht nicht die richtige Wortwahl sein. |
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 25.01.2024 um 02.03 Uhr |
|
Ich selbst würde in so einem Fall auch eher jongens sagen, höre aber gelegentlich auch mensen. Es ist wohl eine Frage des Registers. Und vielleicht handelt es sich bei manchen Sprechern auch um einen PC-Ersatz für die saloppere Variante, die aber eben nicht nur Männer bezeichnet. Man wird von entsprechender Seite ja auch dazu angehalten, statt bemannen das Kunstwort bemensen zu gebrauchen. Denken Sie aber auch an Fälle wie Beste mensen oder Lieve mensen, in denen man im Deutschen nicht Liebe Menschen sagen würde, eventuell aber Liebe Leute (etwa auch in leicht ironischer Verwendung). Mit dem Verweis auf die scheinbare Entsprechung eines deutschen Begriffspaares im Niederländischen wollte ich zusätzlich verdeutlichen, wie vielfältig die synonymischen Beziehungen zwischen sich ähnelnden Wörtern sein können (Herr Ickler sprach von den »komplexen Gebrauchsbedingungen«).
|
Kommentar von Theodor Ickle, verfaßt am 25.01.2024 um 05.43 Uhr |
|
Abschließend zu dem Buch von Dean Burnett (The idiot brain): Es handelt sich um eine journalistisch flotte Aufbereitung bekannter Ein- und Ansichten der Psychologie und an keiner Stelle um Hirnforschung. Die Unzuverlässigkeit von Zeugenaussagen, vor Jahrzehnten von Elizabeth Loftus nachgewiesen, ist ein typischer Fall: reine Psychologie, keine Neurologie. Gelegentliche Erwähnung des Hippocampus (Londoner Taxifahrer...) macht ein solches Buch (man denke auch an unseren Manfred Spitzer) nicht zu einem neurologischen. Das Gehirn wird schon im Untertitel zum Kopf, man hätte auch gleich Geist sagen können, ist eh alles egal. Insgesamt eine Enttäuschung (aber was hatte ich denn erwartet?), und ich habe es gleich entsorgt.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.02.2024 um 06.28 Uhr |
|
Ein altes Problem der Sprachpsychologie: Die „Verarbeitung“ der Sprache (Produktion und Verstehen) geschieht „von links nach rechts“, aber z. B. zum Substantiv muß ich den passenden Artikel finden, der links davon steht. Ich muß mich also von rechts nach links zurückarbeiten. Ich habe das schon so analysiert, daß es ohne „Zwischenspeicher“ denkbar wird („competitive queuing“). Vor einer Stunde habe ich hier den Philosophen Gabriel erwähnt. Bei der Suche nach dem Vornamen fielen mir der Reihe nach ein: Sigmar, Markus. Den SPD-Mann habe ich gleich ausgeschlossen und war zu 99% sicher, daß Markus richtig ist. (Insgesamt würde ich den ganzen Namen am liebsten vergessen, aber das steht auf einem anderen Blatt, auch wenn es für das Erinnern nicht unwichtig ist.) Wesentlich ist, daß ich die Abfolge Gabriel-Markus niemals gehört oder gelesen habe. Das macht aber nichts. Im Modell der Aktualgenese stehen beide Wörter nebeneinander Schlange, und ich habe gelernt, daß normalerweise der Vorname vorgeht (sich vordrängeln darf) – wie auch immer das physiologisch realisiert wird. Aber unter anderen Umständen geht es auch umgekehrt. Auf Gabriel folgt dann Markus, und in einem zweiten Schritt stelle ich wieder die normale Reihenfolge her und schreibe sie nieder. Das Ganze geschieht ohne Wunder (ohne generative „Regeln“). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.09.2024 um 14.47 Uhr |
|
"Alaska" statt "Afghanistan" ist ein Versprecher, der dem Patholinguisten zu denken gibt. Man kann von einer Paraphasie sprechen und sollte den Fall weiter beobachten.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.04.2025 um 04.20 Uhr |
|
Noch einmal zum Speichermodell: Das gewöhnliche Bild ist so: Man macht eine Erfahrung und speichert das Wissen, so daß es u. U. wieder abgerufen, gleichsam hervorgeholt werden kann („Retrieval“ aus dem sogenannten Gedächtnis, nach dem Modell einer Registratur). Naturalistisch sieht es anders aus: Erfahrungen verändern das Verhalten, und zu diesen Veränderungen gehört u. a. gegebenenfalls das Hervorbringen von „Wissen“, eine Reaktion wie jede andere. Es gibt keinen Speicher, aus dem etwas hervorgeholt werden kann. Jemand nimmt einen bestimmten Umweg, weil er die Erfahrung gemacht hat, daß die Straße gesperrt ist. Das Umwegverhalten ist gleichartig mit dem Sprachverhalten, durch das er gegebenenfalls ein „Wissen“ von der Sperrung bekundet. Es ist überflüssig, das eine auf das andere zurückzuführen. (Man könnte sogar manchmal sagen: Das Wissen ist aus dem übrigen Verhalten abgeleitet. Ich kann starke Verben konjugieren, folglich muß ich wissen, welche Formen sie haben.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 01.04.2025 um 14.50 Uhr |
|
Die Änderung des Verhaltens ist nicht möglich, ohne daß seine neurologische Grundlage verändert wird. Aber damit haben wir schon die Speicherung! Das Wissen, z. B. über eine Straßensperrung, besteht natürlich nicht in der Speicherung eines entsprechenden Textes oder einer Landkarte im Gehirn. Das ist eine Trivialität, der kein Kognitivist ernsthaft anhängt, davon bin ich überzeugt, es sei denn, er meint es metaphorisch. Ich halte es durchaus für möglich, die Wissensspeicherung mit Hilfe des Verhaltens zu erklären, aber Verhalten beruht ja irgendwo auf körperlichen Ursachen. Verhalten "an sich" gibt es nicht, es ist kein stofflicher Gegenstand, sondern ein Abstraktum. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 02.04.2025 um 14.11 Uhr |
|
Wenn das Verhalten verändert wird, dann verändert sich ja nicht direkt das augenblickliche, gegenwärtige Verhalten, sondern das künftige entsprechende Verhalten unter den gleichen Umständen soll anders sein. Wie könnte man aber in die Zukunft eingreifen? Es muß etwas Gegenwärtiges, Substantielles sein, das geändert und so lange beibehalten wird, bis das zu verändernde Verhalten wieder ansteht und mit der angestrebten Änderung geschieht. Diese Änderung, die Speicherung, wird auf der aktuellen körperlichen Substanz ausgeführt, dem Speicher, und damit werden die Anlagen für das künftige veränderte Verhalten gesetzt. Das betrifft Wissensspeicher und Speicher für motorische Fertigkeiten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.04.2025 um 04.52 Uhr |
|
Durch Einwirkungen aller Art verändert sich der Organismus und verhält sich daher gegebenenfalls in Zukunft anders. Diese Wirkungen könnte man unverfänglich „Spuren“ nennen, aber mit „Repräsentation“ oder „Speicherung“ ist mehr behauptet, und es ist nicht gerechtfertigt, weil es vom Organismischen ins „Intentionale“ hinüberwechselt – mit den bekannten homunkulistischen Folgen. Man könnte auch von „Metaphysik“ sprechen, denn Intentionalität ist nicht von dieser Welt. Mit unserem heutigen Besteck (Evolution und Konditionierung, also Geschichte) können wir dieses Gespinst auflösen.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 15.04.2025 um 13.56 Uhr |
|
Eine Tierspur, die wir schon als Kinder deuten lernten: zwei Löcher neben- und zwei hintereinander, alles sich immer wiederholend. Ganz klar, hier ist ein Hase über den Schnee gelaufen. Was behaupten wir jetzt mehr als diesen klaren Fakt, wenn wir sagen, daß der Schnee die Spur eine Zeitlang speichert? Es bedeutet nur, daß wir auch morgen oder in einer Woche, je nach Wetter, noch sagen können, ein Hase sei dort langgelaufen. Mehr nicht. Das Geschehen spiegelt sich im Schnee wider, seine Spur ist vorläufig gespeichert und das Geschehen damit rekonstruierbar. Wir müssen ja nicht gleich auch das Intentionale aufrufen, das wäre erst der nächste Schritt. Wir könnten erst einmal auf der physischen Seite bleiben und festhalten, daß das gelernte Verhalten und andere Eindrücke [!], die die Beschaffenheit der Umwelt ständig widerspiegeln, im Organismus gespeichert werden. Ich wüßte nicht, wie man eine dauerhafte Spur sonst nennen soll, als einen Speicher. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.04.2025 um 14.32 Uhr |
|
Gegen diesen metaphorischen Alltagsgebrauch habe ich natürlich nichts einzuwenden. Übrigens ist das Geschehen (das Darüberlaufen eines Hasen) nur dann aus den Spuren erschließbar, wenn man schon einiges über den Zusammenhang weiß. Wie Dawkins sagt (s. Rezept vs. Blaupause): Aus dem Kuchen ist das Backen nicht rekonstruierbar. Ich würde gern den Nutzen von Begriffen wie Spur, Speicher, Veränderung usw. bewahren, indem ich Speicher und Spur NICHT gleichsetze. Ein spicarium war ja auch kein Hafen von Ähren, sondern ein angelegter Vorrat. (Vorrat ist schon eher = Speicher.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 15.04.2025 um 19.43 Uhr |
|
Ich wollte das Beispiel eigentlich nicht metaphorisch verstanden wissen, sondern wörtlich. Die Etymologie von Speicher ist dafür sicher interessant, kann uns dabei aber auch nicht viel weiter helfen. Ich denke, speichern heißt heute nur soviel wie lagern, bevorraten, aufheben, auf die Art des Gespeicherten kommt es nicht an. Warum muß das Gespeicherte also unbedingt eine Masse haben? Man kann Zahlen, Daten, Aussagen, Ideen, Beschreibungen, ganz allgemein Information ebenso lagern, aufheben, zum Gebrauch bereithalten wie Getreide, d.h. man kann das alles durchaus im wörtlichen Sinne speichern. Ich sehe keinen wesentlichen Unterschied. Ich setze Spur und Speicher auch nicht gleich. Eine Spur ist eine sehr spezielle Art der Speicherung. Jede Art von Information muß natürlich immer erst interpretiert werden, nicht nur die Spur oder ein Kuchen, und das ist immer nur möglich, wenn der Zusammenhang, also die Zeichen, bekannt sind. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.04.2025 um 03.18 Uhr |
|
"Lagern, Aufheben, Bevorraten" sind absichtliche Handlungen. Davon kann bei Hasenspuren im Schnee, Jahresringen in Bäumen usw. ja wohl keine Rede sein.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.04.2025 um 16.30 Uhr |
|
Es gibt aber auch Lagerstätten von Bodenschätzen. Legen Hamster ihren Wintervorrat absichtlich an? Bin nicht sicher. Im Permafrost soll viel Kohlendioxid gespeichert sein, und im Eis des Südpols 70% des Süßwassers der Erde (Wikipedia). Alles auch unabsichtlich. Ich denke, darauf kommt es nicht an, sondern auf das Faktum, daß etwas aufbewahrt wird, erhalten bleibt und sich daher auch später noch verwenden läßt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.06.2025 um 04.40 Uhr |
|
Der Ruf des Pirols ist nicht in seinem Körper "gespeichert". Wir wissen nicht, wie die Lauterzeugung gesteuert wird, aber die Rede vom Speicher bringt uns nicht weiter. Das ist bei menschlichen Fertigkeiten, zum Beispiel Wörtern, nicht anders. Lernen (Konditionierung) verändert das Gehirn, Evolution verändert das Genom. Die Metapher vom Speicher führt nicht weiter, sondern wirft unnötige Probleme wie die Frage nach dem Suchmechanismus auf. (Schon von Lashley erkannt und für ungelöst erklärt. Eigentlich schon von Platon aufgedeckt, wenn er die Suche nach dem Wissen als logisch unmöglich darstellt.)
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 03.06.2025 um 16.42 Uhr |
|
Bevor man sagt, etwas sei nicht gespeichert, müßte man wohl erst einmal sagen, was man überhaupt als "Speicherung" anerkennt. Daß man Vogelgezwitscher nicht wie Getreidekörner aus einem Säckchen herausnehmen kann, versteht sich ja von selbst. Also wäre die Frage, ob der Ruf des Pirols vielleicht in ähnlicher Weise wie analog auf einer Schallplatte oder digital auf einer CD gespeichert ist, was mit Hilfe eines Gerätes, welches die gespeicherte (?) Information interpretieren kann, hörbar gemacht wird. Erkennt man das als Speicherung an? Wenn nicht, dann braucht man nicht weiter darüber nachzudenken, das Problem wäre erledigt, noch bevor es überhaupt um Neurologisches geht. Erkennt man jedoch Schallplatte und CD als Speicher an, dann ist wiederum nicht einzusehen, weshalb das gleiche für ein Lebewesen nicht gelten soll. Natürlich ist die Bahnung im Körper bzw. Gehirn nicht genau identisch mit der Bahnung auf Schallplatte und CD, aber das Prinzip (Information, die vom Körper interpretiert wird, ebenso wie das Grammophon die Plattenrillen interpretiert) ist das gleiche. Das Suchen der Information hängt von der genauen Art der Speicherung ab. Daß wir die noch nicht kennen, beweist ja nicht, daß prinzipiell nichts gespeichert ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.06.2025 um 18.24 Uhr |
|
Im Abdruck von Hufeisen auf dem Waldweg ist die Information „gespeichert“, daß dort jemand geritten ist. In der kosmischen Hintergrundstrahlung ist Information über den Urknall oder gar dieser selbst „gespeichert“. Der gegenwärtige Zustand der Welt „speichert“ alle vergangenen und sogar die künftigen. Wir sind nicht nur von lauter Speichern umgeben, die Welt ist ein einziger Speicher. Spuren sollte man nicht als Speicher bezeichnen – wie Anzeichen nicht als Zeichen. Ein Haufen Kies sammelt sich in einer Flußbiegung; der Haufen ist kein Speicher. Aber wenn ein Steinschleuderer den Haufen angelegt hat, ist es ein Speicher. Der Hamster hamstert Körner; er legt einen Speicher an, aber ein vom Wind zusammengewehter Haufen Körner ist kein Speicher und wird auch nicht so genannt. („Absichten“ braucht man dazu nicht zu bemühen. Der Hamster legt einen Speicher an, weil Hamster, die keinen Speicher anlegen, nicht mehr existieren; davon weiß er aber nichts.) Man hebt hervor, daß im Computer im allgemeinen der Speicher von der Arbeitseinheit getrennt ist, im Gehirn nicht. Ich suche nach Wörtern, aber mein Gehirn sucht nicht. Dort stehen Impulse Schlange, und der stärkste kommt zum Zuge. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 03.06.2025 um 23.36 Uhr |
|
Ich möchte gern meine Thesen einmal zusammenfassen: Information existiert nur gespeichert. Es gibt keine Information, die nicht an einen (materiellen) Träger gebunden wäre. Es ist daher auch nicht verwunderlich, daß jeder objektiv reale Gegenstand der Welt Information enthält, d.h. speichert, daß mithin jeder objektiv reale Gegenstand ein Informationsspeicher (-träger) ist. Je komplexer ein Gegenstand aufgebaut ist, umso mehr Information enthält (speichert) er. Anzeichen und Zeichen sind auch nach meiner Auffassung nicht dasselbe. Aber Spuren nennt man deshalb so, weil sie Information darstellen. Nichts anderes bedeutet ein Informationsspeicher. Daß man nicht jede materielle Form eine Spur oder Information nennt, nicht jeden Gegenstand einen Informationsträger, das liegt einfach daran, daß nicht alles relevante Information ist. Aber sobald man auf eine bestimmte Information Bezug nimmt, wird ihr Träger natürlich zum Informationsträger (-speicher). Wissen ist prinzipiell das gleiche wie Information, und zwar diejenige, die einem Individuum subjektiv (ohne objektive Hilfsmittel), gespeichert im eigenen Körper, zugänglich ist. Da jede Information auf materiellen Formen beruht, kann man Wissen prinzipiell auch objektiv von außen feststellen. Wissen ist also ein Fakt, kein Konstrukt. Die Frage ist nur, wie weit die Neurologie in der Lage ist, materielle Strukturen im Gehirn bzw. im Körper zu lesen und zu verstehen (richtig zu interpretieren). Der Determinismus (außer in seiner strengsten Form) geht nicht so weit zu behaupten, daß die heutige Welt und die Welt in aller Zukunft bereits seit dem Urknall in allen Einzelheiten festgelegt ist. Im atomaren Bereich und darunter spielen Wahrscheinlichkeiten eine immer größere Rolle, und winzige Abweichungen können zu großen Unterschieden führen. Die Welt speichert also nicht sämtliche frühere und künftige Zustände. Entschuldigung, mir ist natürlich klar, daß diese Sätze mit dem von Ihnen verteidigten Behaviorismus schlecht vereinbar sind. Aber etwas anderes kann ich nicht sagen. Wenn das nicht diskutabel ist, tut es mir leid. Andererseits wäre ich schon sehr interessiert, meine Denkfehler zu erfahren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.06.2025 um 05.11 Uhr |
|
Vielen Dank für Ihre Zusammenfassung! Ich müßte nun ebenfalls alles noch einmal zusammensuchen, was ich hier in Hunderten von Einträgen verstreut dazu gesagt habe. Lassen Sie mich nur zweierlei bemerken: 1. Ihr Informationsbegriff stimmt nicht mit dem der "Erfinder" der Informationstheorie überein. Sie vermischen den semantischen (alltagssprachlichen) Begriff mit dem formalen (mathematischen), vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1570#51859 u. ö. 2. Ich möchte doch den Unterschied zwischen einer Spur (wie dem oft zitierten Bachbett oder den Jahresringen) und einem Speicher festhalten. Die jeweilige Geschichte, die hinter beidem steht, ist objektiv verschieden, und man bringt sich um eine Einsicht, wenn man beides vermischt. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 04.06.2025 um 11.36 Uhr |
|
Shannon und Weaver befassen sich mit Information im nachrichtentechnischen und kommunikativen Sinne. Das sind für physikalische und philosophische Zwecke viel zu spezielle Anwendungen. Information ist eine sehr allgemeine, grundlegende Eigenschaft der Materie, vergleichbar etwa mit Masse und Energie. Wir bemängeln ja auch nicht, die Äquivalenz von Masse und Energie komme in der Elektrotechnik nicht vor. Shannon/Weaver grenzen Information von Bedeutung ab. Im physikalischen und philosophischen Sinne gehört Bedeutung aber dazu. Information ist stets interpretationsbedürftig, abhängig von Vereinbarungen. (Den Hufeisenabdruck auf dem Waldweg könnte auch ein Bildhauer künstlich angefertigt haben, ohne daß da jemand geritten wäre. Trotzdem bleibt es Information.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 04.06.2025 um 13.41 Uhr |
|
Die sog. Informationstheorie ist also nur die Theorie einer speziellen Art von Information. Tatsächlich kommt die umgangssprachliche Verwendung von Information dem physikalischen, philosophischen Informationsbegriff näher.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.06.2025 um 07.22 Uhr |
|
Diese Diskusssion hatten wir schon, z. B. vor 5 Jahren unter "Das bilaterale Zeichen", und ich kann nichts Neues beitragen. Was der Kenner über das Alter eines Pferdes sagen kann, steckt nicht als Information in dessen Zähnen, sondern der Kenner weiß schon sehr viel über Pferde und baut die Zahndaten in seine Theorie ein. So auch der Astrophysiker, wenn er sich das Spektrum eines Sterns ansieht. Was die Gelehrten dann in ihre Bücher schreiben, ist Information für den Leser (im nichtmathematischen Sinn des Wortes).
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 05.06.2025 um 12.53 Uhr |
|
Man kommt natürlich leicht in Versuchung, sich zu wiederholen. Das Pirolbeispiel reiht sich da ja auch ein, andererseits bieten Wiederholungen die willkommene Chance, vielleicht mit etwas anderen Worten zu versuchen, besser anzukommen. Hat Information eigentlich einen mathematischen Sinn? Welchen mathematischen Sinn hat z. B. eine Wiese oder ein Wald? Man kann natürlich Mengen von Grashalmen oder Bäumen zusammenzählen oder fragen, wie weit man im Durchschnitt in einen Wald schießen kann, bevor die Kugel auf ein Hindernis trifft (Wahrscheinlichkeitsrechnung). Auf diese Weise kann man dann auch Information für mathematische Modelle benutzen. Aber ich würde Information keinen ursprünglichen mathematischen Sinn zuschreiben, wie etwa einer Zahl, Geraden, Menge, einem Grenzwert usw. Bei der Frage, was Information ist, bleibt Mathematik also außen vor. Das Wesen von Information ist meiner Ansicht nach physikalisch. |
