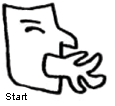


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
14.11.2013
Intentionalität und Sprache
Die Naturalisierung der Intentionalität durch Sprachkritik – eine Skizze
Der Ausdruck Intentionalität wird in der Philosophie hauptsächlich in zwei Bedeutungen verwendet:
1. als bildungssprachlicher Ausdruck (oder Anglizismus) für ‚Absichtlichkeit‘,
2. in einer Bedeutung, die man als die scholastisch-phänomenologische bezeichnen kann; sie läßt sich als ‚Gerichtetheit‘ oder ‚Bezüglichkeit‘ (engl. aboutness) umschreiben. Diese Bezüglichkeit wird einerseits sprachlichen Zeichen zugeschrieben, andererseits geistigen oder mentalen Vorgängen bzw. Akten.
In beiden Bedeutungen steht Intentionalität einer naturalistischen Auffassung entgegen, da es in einer Welt der Tatsachen weder Absichten und Ziele noch Gerichtetheit im phänomenologischen Sinne geben kann.
Gelegentlich wird behauptet, die beiden Bedeutungen hätten nichts miteinander zu tun:
„Der Begriff der Intentionalität wird in der Philosophie des Geistes in einem technischen Sinne gebraucht, der mit der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes ‚Intention‘ nichts zu tun hat. Wenn Philosophen von der Intentionalität des menschlichen Geistes sprechen, dann beziehen sie sich nicht auf den Umstand, daß wir Wesen sind, die Absichten verfolgen, sondern auf die Tatsache, daß viele mentale Zustände auf etwas gerichtet sind.“ (Wolfgang Barz)
Auch diese Behauptung ist zu überprüfen.
Intentionalität I: Wollen, Absicht
Statt einfach etwas zu tun, kann ein Mensch sagen, was er tun wird. Man kann ihn auch danach fragen, und dann wird er gewöhnlich sagen, er werde oder wolle dies oder jenes tun. „Unser Wollen ist ein Vorausverkünden dessen, was wir unter allen Umständen tun werden. Diese Umstände aber ergreifen uns auf ihre eigene Weise.“ (Goethe: DuW III, 11)
Eine solche Ankündigung hat mehrere Vorteile. Zunächst können sich die Gruppenmitglieder frühzeitig auf das angekündigte Verhalten einstellen. Auch bei Tieren hat man ein „Intentionsverhalten“ beobachtet, z. B. ein Flügelschlagen bei gesellig lebenden Vögeln als Anzeichen eines bevorstehenden Auffliegens. Der Schwarm fliegt gemeinsam auf, wenn das vorausgehende Verhalten eine gewisse Schwelle erreicht hat. Allerdings sind solche Ankündigungen bei Tieren auf das Hier und Jetzt beschränkt, nur der Mensch kann ausdrücken, was er morgen tun wird oder nur unter gewissen Bedingungen tun würde. Diese höhere Form der Handlungskoordination ist einer der Vorteile, um derentwillen sich die menschliche Sprache entwickelt haben dürfte. Weder die bisherige Erfahrung im Umgang mit einem Menschen noch die Zuschreibung bestimmter Charakterzüge ermöglichen es uns, das Verhalten dieses Menschen so sicher vorherzuwissen wie seine ausdrückliche Ankündigung dessen, was er tun wird oder will.
Die jeweiligen Umstände „ergreifen uns auf ihre eigene Weise“: Ein angekündigtes Verhalten kann zum Beispiel von den Mitgliedern der Gruppe vorab kommentiert werden. Die anderen können also zu- oder abraten und damit ihre eigene Erfahrung oder die Erfahrung Dritter zur Geltung bringen. Diese Erfahrung kann die Form aussprechbaren „Wissens“ angenommen haben oder in unbefragten Sitten, Gebräuchen und Tabus eingeschlossen sein. Unter geeigneten Umständen kann es zu handgreiflicher Verhinderung des Verhaltens kommen. Mit solchen Interventionen erspart die Gruppe es dem einzelnen, jede Erfahrung selbst zu machen, und trägt zur Vermehrung des gemeinschaftlichen „Wissens“ bei.
Die Situation, in der ein Verhalten angekündigt und damit dem möglichen Einspruch der Gruppe ausgesetzt wird, nenne ich „Deliberationssituation“ und das Gespräch, in dem über eine bevorstehende Handlung beraten wird, „Deliberationsdialog“. Nach Abschluß des Verhaltens ergibt sich möglicherweise eine Rechtfertigungssituation mit einem entsprechenden Rechtfertigungsdialog. Er rekonstruiert typischerweise die Deliberationssituation: Welche Gründe waren entscheidend? Wäre die Tat bei passender Beratung unterblieben? Beide Arten des Dialogs sind aus der klassischen Rhetorik, besonders der forensischen Rhetorik bekannt und werden hier in Anlehnung an diese Tradition benannt (Genus deliberativum bzw. iudiciale). (Zum Rechtfertigungsdialog als Ursprung von Selbstbeobachtung und Selbstbewußtsein s. Skinner: „Wissenschaft und menschliches Verhalten“ Kap. 18. - Wilfried Stroh meint, daß die Bezeichnung deliberativ als Übersetzung von symbuleutisch „fast unbegreilich“ scheint, „da sie sich ja auf die Tätigkeit des Redeadressaten, nicht des Redners bezieht“ [Die Macht der Rede. Berlin 2009:179]. Für unsere Zwecke paßt sie aber gut, da wir es mit dem dialogischen Erwägen von Handlungsoptionen zu tun haben.)
Soweit das angekündigte Verhalten in der Willensbekundung benannt wird, wirft es die Frage auf, wie ein noch gar nicht gegebener Stimulus das Sprachverhalten steuern kann. Diese Funktion übernehmen andere Reize, die in der gegebenen Situation mit dem eigentlich relevanten Reiz regelhaft verbunden sind. Skinner diskutiert einen solchen Fall:
„Nehmen wir an, daß ein Kind daran gewöhnt ist, auf dem Frühstückstisch eine Orange zu sehen. Fehlt die Orange eines Morgens, sagt das Kind schnell Orange. (...) Wieso konnte die Reaktion erfolgen, obwohl gar keine Orange als Reiz gewirkt hat? (...) Die Reaktion wird durch den Frühstückstisch mit allen seinen vertrauten Eigenschaften und durch andere zur Tageszeit passende Reize ausgelöst. Zu diesen Reizen gehörten oftmals Orangen, und die Reaktion Orange ist in ihrer Anwesenheit verstärkt worden.“ (Verbal behavior. Englewood Cliffs 1957:101; eigene Übersetzung)
Die Ankündigung eines Verhaltens ist die vorgeschaltete sprachliche Phase eines neuen Gesamtverhaltens. Die Gruppenmitglieder reagieren gegebenenfalls auf diese Anfangsphase wie auf jedes andere Verhalten in der gelernten Weise. Auch von jenen Vögeln sagen wir, das Flügelschlagen sei nicht die Bekundung der Absicht zu fliegen, sondern die Anfangsphase des Auffliegens selbst, und auf diese erste Phase können die anderen Mitglieder des Schwarms reagieren. So wird die intentionalistische Begrifflichkeit vermieden.
Goethes Formulierung sieht davon ab, das Wollen in eine verhaltensfremde „geistige“ Sphäre zu versetzen oder die Willensbekundung als Protokollaussage über mentale Prozesse zu deuten. Er beschränkt sich ausdrücklich auf das „Vorausverkünden“, also das Ankündigungsverhalten. Es handelt sich einfach um eine Verständigungstechnik: „Weil wir 'wollen' sagen können, glauben wir zu wollen.“ (Fritz Mauthner: Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Bd. 1. Frankfurt, Berlin 1906:67) Bemerkenswert ist auch, daß Goethe bereits die große Nähe von will tun und wird tun angedeutet hat. Oft fragen wir „Was wirst du tun?“ und meinen kaum etwas anderes als „Was willst du tun?“ Letzteres wird in herkömmlicher phänomenologischer Auffassung als Beschreibung eines mentalen Zustandes angesehen, ersteres nicht, obwohl es fast dasselbe bedeutet. Der Unterschied besteht darin, daß werden die Unabänderlichkeit hervorhebt, wollen die Offenheit für Einspruch. Es handelt sich also um einen Unterschied der Funktion im Dialog und nicht um einen psychologischen.
Im Deutschen hat sich das Hilfsverb werden als Futur-Periphrase erst spät (um 1700) vollständig aus der Konkurrenz der Modalverben sollen, wollen, müssen gelöst (Polenz II:262) – ebenfalls ein Hinweis auf die semantische Nähe. Da es keinen Infinitiv des Futurs gibt, behilft man sich oft mit wollen:
Bei ihren Beratungen hat sich die Freisinger Bischofskonferenz mit der Frage des Rechts zur Mitwirkung an der Besetzung der außerhalb der Katholisch-Theologischen Fakultäten bestehenden Konkordatslehrstühle auseinandergesetzt und beschlossen, auf die Ausübung dieses Rechts aus dem Bayerischen Konkordat verzichten zu wollen. (Erklärung der Freisinger Bischofskonferenz, Frühjahrsvollversammlung der bayerischen Bischöfe in Waldsassen am 30. und 31. Januar 2013)
Man kann eigentlich nicht beschließen, etwas tun zu wollen. Das Modalverb steht hier im Sinne von werden. (Zum Futur gibt es keinen Infinitiv.)
Das Konstrukt des Wollens ist in Wortschatz und Grammatik der Sprache fest verankert. Dazu einige Beispiele:
Die anderen Modalverben, also können, mögen, dürfen, müssen, sollen lassen sich nicht definieren, ohne daß man sich auf wollen bezieht. können, mögen werden verwendet, wenn dem eigenen Wollen kein Hindernis entgegensteht, wobei dürfen zusätzlich angibt, daß auch fremdes Wollen kein Hindernis darstellt („nihil obstat“); müssen, wenn das eigene Wollen durch fremden Zwang eingeschränkt wird; sollen, wenn dieser Zwang auf fremdem Willen beruht.
schaffen, gelingen und ähnliche Verben setzen wollen voraus.
In viele Gegenstandsbezeichnungen ist der Zweck eingebaut, z. B. lassen sich Schlüssel, Henkel, Haus, Nest, Falle, Weg usw. gar nicht ohne Funktionsbestimmung definieren.
Verben wie geben und schenken setzen ein Haben voraus, das seinerseits auf gesellschaftliche Verhältnisse verweist, unter denen es so etwas wie Besitzansprüche gibt, d. h. ein Verfügenwollen.
Faktitive und kausative Verben wie leeren, fetten, heizen, glätten, ölen, kürzen, brühen, wärmen, fällen, füttern bezeichnen ein zweckgerichtetes Verhalten, ebenso die privativen „Küchenverben“ wie schuppen, köpfen, häuten, schälen.
Finalsätze drücken einen Zweck oder ein Ziel aus, nehmen also auf Absichten Bezug.
Bezug auf ein Wollen steckt in Konstruktionen wie das ist ihm zu schwer = das ist schwerer, als er will.
Das Handlungsschema wird in Vorrichtungen hineingearbeitet, die man als teleologische Maschinen bezeichnen kann. Einfache Beispiele wären der Fliehkraftregler, der Füllmechanismus der Wasserspülung usw.
Wie gezeigt, hat das Wollen seinen Platz in bestimmten Dialogspielen. Wir neigen jedoch dazu, das Handlungsschema, also die Verbindung von Absicht und Ausführung, auch in die nichtmenschliche Natur zu projizieren, weil sich mit diesem Modell die Fälle von Anpassung bequem erklären, d. h. in ein vertrautes und bewährtes Schema einfügen lassen. Ist der Mechanismus der Evolution einmal klar, haben Biologen keine Bedenken, intentionalistische Metaphern auf die Phylogenese anzuwenden, zum Beispiel den Finalsatz:
Um eine Kolonie lose miteinander assoziierter Einzelzellen in einen integrierten Organismus zu verwandeln, bedurfte es zunächst eines neuen Selektionskriteriums(Wolfgang Wieser, Hg.: Evolution der Evolution. Heidelberg 1994:34)
Auch das konkrete Verhalten der Tiere wird, obwohl instinktgesteuert, gern so dargestellt: Moskitoweibchen trinken Blut, um Proteine zur Produktion von Eiern zur Verfügung zu haben (SZ 4.1.08). Hierher gehört auch die Personifizierung der „Natur“:
Die Natur bildet eine Ganzheit. Sie löst ihre langfristigen Probleme immer auf optimale Weise. (Lorenz und die Folgen. Zürich 1978:1089)
Auch kulturgeschichtliche Entwicklungen werden gern als zielgerichtete Handlungen dargestellt:
(Die Menschheit brauchte 3000 Jahre, um das Problem zu lösen,) die potentiell unendliche Vielfalt des menschlichen Denkens in einer potentiell ebenso großen, aber dabei immer auch geistig beherrschbaren Vielfalt von Zeichen auszudrücken (Friedhart Klix: Erwachendes Denken. Berlin 1985:187).
Ebenso:
Die Entwicklung der Schrift geschieht in einem mehrere Tausend Jahre beanspruchenden Problemlösungsprozeß. (Wolfgang Schnotz: Aufbau von Wissensstrukturen. Weinheim 1994:10)
Dieses Problem hat es nie gegeben; die Alphabetschrift erscheint nur im Rückblick als seine Lösung. Darauf paßt die Bemerkung Skinners:
„People do not observe particular practices in order that the group will be more likely to survive; they observe them because groups which induced their members to do so survived and transmitted them.“ (In Catania/Harnad [Hg.] 1988:15. Vgl. Skinner ebd. 219 zum „Problemlösen“ nach Thorndike.)
Solche „ptolemäischen Redensarten“ (wie die Allgemeine Semantik die sprachlichen Relikte überholter Weltbilder kritisch zu nennen pflegte) sind heute harmlose Spielformen. Psychologen sehen jedoch in der „Hypertrophie sozialer Wahrnehmung“ auch die Grundlage animistischer und vieler religiöser Überzeugungen.
Der Fehler, das Wollen als ein mentales Ereignis oder einen Zustand zu verstehen, führt zu unlösbaren Problemen:
„Wie geschieht es, dass unser Körper in aller Regel unserem Willen gehorcht, dass etwa, wenn ich trinken will, sich meine Hände so bewegen, dass sie tatsächlich die Tasse ergreifen und zum Munde führen?“ (Joachim Hoffmann u. a.: „Spekulationen zur Struktur ideo-motorischer Beziehungen“, Zeitschrift für Sportpsychologie 14/3, 2007, 95-103, S. 95)
Man wird schwerlich bestreiten, daß der Körper dem Willen gehorcht, und doch hat die Ausdrucksweise etwas Schiefes. Natürlicher wäre es zu sagen, daß ich meistens, aber nicht immer tun kann, was ich will. Nimmt man die philosophische Rede von „meinem“ Willen und „meinem“ Körper wörtlich, ergibt sich die weitere Frage, was denn dieses Ich ist, dem beides zugehört usw.
Das lösbare Problem besteht darin, unwillkürliche von willkürlichen, d. h. kommunikativ steuerbaren Bewegungen zu unterscheiden und die Steuerung selbst zu erklären.
Intentionalität II: Gerichtetheit, Aboutness
Gerichtetheit des Mentalen
Gerichtetheit wird sowohl bestimmten „geistigen Akten“ zugeschrieben als auch sprachlichen Handlungen, und zwischen beidem sollen Verbindungen existieren, die das ganze Problem sehr kompliziert erscheinen lassen. Die Diskussion muß sich auf einige exemplarische Fassungen beschränken. Das bekannteste Dokument der phänomenologischen Richtung ist folgende Stelle von Franz Brentano:
„Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisiert, was die Scholastiker des Mittelalters die intentionale (auch wohl mentale) Inexistenz des Gegenstandes genannt haben, und was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt (worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist), oder die immanente Gegenständlichkeit nennen würden. Jedes enthält etwas als Objekt in sich, obwohl nicht jedes in gleicher Weise. In der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urteil etwas erkannt oder verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehaßt, in dem Begehren begehrt usw.
Diese intentionale Inexistenz ist den psychischen Phänomenen ausschließlich eigentümlich. Kein physisches Phänomen zeigt etwas Ähnliches. Und somit können wir die psychischen Phänomene definieren, indem wir sagen, sie seien solche Phänomene, welche intentional einen Gegenstand in sich enthalten.“ (Franz Brentano: Psychologie vom empirischen Standpunkt. Leipzig 1924:24, zuerst 1874)
Die umfangreiche Literatur seit Brentano hat sich zunächst vor allem mit der Frage beschäftigt, ob Intentionalität ein notwendiges, hinreichendes und ausschließliches Kriterium des Psychischen oder, wie man heute meist sagt, „mentaler Phänomene“ ist. Seltener wird die Voraussetzung in Zweifel gezogen, daß es mentale Phänomene überhaupt gibt bzw., sprachanalytisch ausgedrückt, daß die Rede von mentalen Phänomenen sinnvoll ist und welchen Sinn sie allenfalls haben könnte. Wie schon das Brentano-Zitat erkennen läßt, sind die mentalen Phänomene etwas, was sich der Naturalisierung zu entziehen scheint. Ihre Analyse ist daher eine Hauptaufgabe der naturalistischen Philosophie.
Die – im weiteren Sinne – phänomenologisch orientierte Philosophie beruft sich auf die Existenz des Mentalen als letzte Gewißheit.
Ein Verhaltensforscher hat kein Bedürfnis, sich der Existenz seines Forschungsgegenstandes zu versichern. Traditionelle mentalistische Psychologen beginnen ihre Einführungswerke aber gern mit solchen Letztbegründungen. Es sind verschiedene, aber miteinander zusammenhängende „Phänomene“, deren Existenz als evidente, unbezweifelbare Grundlage des psychologischen Unterfangens dargestellt werden: die „Innenwelt“ oder der „Geist“ bzw. das „Mentale“ schlechthin, dann auch dessen Inhalte in mehr oder weniger eingehender Bestimmtheit, wie die „Gerichtetheit“ („Intentionalität“) psychischer Phänomene.
Die Gewißheit dieser Grundlagen wird auf zwei Wegen begründet: entweder durch Überlegung oder durch Appell an die Erlebnisse und Erfahrungen des Lesers. Man könnte in einem weiteren Sinne von logischer vs. phänomenologischer Argumentation sprechen.
Descartes stellte sich die heute fast unverständliche Frage, ob es einen Beweis für seine Existenz gebe, und er fand ihn im „Cogito ergo sum“: Wenn ich zweifle, ob es mich gibt oder ob ein böser Geist mich täuscht, dann muß es mich als Zweifelnden doch wenigstens geben. Diese Schlußfolgerung wird heute als logisch ungültig angesehen (was der Mathematiker Descartes gewußt haben dürfte) oder auf andere Weise sprachkritisch demontiert.
Gelegentlich findet sich auch unter Psychologen noch die räsonierende Denkfigur Descartes’:
„Modern philosophy began with what I think is the valid insight that consciousness is the most certain thing in the world. (...) You cannot coherently doubt that you are conscious, for to doubt it is to be conscious; you establish the fact of consciousness in the very act of doubting it.“ (Brand Blanshard: „The Problem of Consciousness: A Debate with B. F. Skinner. Opening Remarks“. Philosophy and Phenomenological Research 27/3, 1967:317-337, S. 317)
Ähnlich in traditionellen Psychologie-Lehrbüchern:
„Es gibt in der ganzen Natur nichts, an dessen Existenz wir weniger zweifeln könnten als an dem, was sich in uns selbst an seelisch-geistigen Vorgängen abspielt. Wer daran zweifeln wollte, ist durch seinen eigenen Zweifel widerlegt, denn auch dieser ist ein bewußtes Erleben.“ (Hubert Rohracher: Einführung in die Psychologie. 10. Aufl. 1971:3)
Eines phänomenologischen Appells hingegen bedienen sich die meisten Philosophen und auch Psychologen mit Ausnahme der Behavioristen:
„Every one agrees that we there discover states of consciousness. (...) I regard this belief as the most fundamental of all the postulates of Psychology, and shall discard all curious inquiries about its certainty as too metaphysical for the scope of this book.“ (William James: Principles of Psychology. New York 1890:185).
„The Fundamental Fact. - The first and foremost concrete fact which every one will affirm to belong to his inner experience is the fact that consciousness of some sort goes on. 'States of mind' succeed each other in him. If we could say in English 'it thinks,' as we say 'it rains' or 'it blows,' we should be stating the fact most simply and with the minimum of assumption. As we cannot, we must simply say that thought goes on.“ (Ebd. 153)
„Ausschließlich in der inneren Erfahrung, in den Tatsachen des Bewußtseins, fand ich einen festen Ankergrund für mein Denken.“ (Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften, Leipzig/Berlin 1923:XVII)
„Bewußtsein wird von uns als ständiger Begleitumstand von Wahrnehmen, Erkennen, Vorstellen, Erinnern und Handeln empfunden. Bei allem, was ich tue und erlebe, habe ich das Gefühl, daß ich es bin, der etwas tut oder erlebt, daß ich wach und 'bei Bewußtsein' bin.“ (Gerhard Roth in Wulf Schiefenhövel u. a.: Vom Affen zum Halbgott. Stuttgart 1994:141)
„Es besteht kein Zweifel, daß wir uns selbst einer Außenwelt gegenüberstehend erleben.“ (Johannes Engelkamp/Thomas Pechmann: „Kritische Anmerkungen zum Begriff der mentalen Repräsentation“. Sprache & Kognition 7, 1988:2-11, S. 3)
In der eigentümlichen Metaphorik der Phänomenologen heißt es:
„Jedes intellektive Erlebnis und jedes Erlebnis überhaupt, indem es vollzogen wird, kann zum Gegenstand eines reinen Schauens und Fassens gemacht werden, und in diesem Schauen ist es absolute Gegebenheit. Es ist gegeben als ein Seiendes, als ein Dies-da, dessen Sein zu bezweifeln gar keinen Sinn gibt.“ (Edmund Husserl: Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen. Haag 1958:31)
Dieses so sichere Bewußtsein wird erst neuerdings in einer Weise definiert, die auf Thomas Nagel zurückgeht und von beinahe jeder inhaltlichen Bestimmung wie „Bewußtseinsstrom“ usw. absieht:
„An organism has conscious mental states if and only if there is something that it is to be that organism—something it is like for the organism.“ („What is it like to be a bat?“ The Philosophical Review 83/4, 1974:435-450, S. 435).
„Eine Entität hat 'Bewußtsein', wenn es für diese Entität irgendwie ist, diese Entität in dieser oder jener Weise zu sein.“ (Martin Kurthen in Sybille Krämer, Hg.: Bewußtsein. Philosophische Beiträge. Frankfurt 1996:17)
„To say one has an experience that is conscious (in the phenomenal sense) is to say that one is in a state of its seeming to one some way. In another formulation, to say experience is conscious is to say that there is something it's like for one to have it.“ („Consciousness“ in: Stanford Encyclopedia of Philosophy)
„The idea of phenomenal consciousness is the idea of ‘something that it is like’ to which Thomas Nagel directed our attention (1979, p. 166): ‚an organism has conscious mental states if and only if there is something that it is like to be that organism – something it is like for the organism.‘ We can say that a system is phenomenally conscious just in case there is something that it is like to be that system, and that a state of a system is a phenomenally conscious state if and only if there is something that it is like, for the system, to be in that state.“ (Martin Davies: „Consciousness and the Varieties of Aboutness“. In: In Cynthia Macdonald/Graham Macdonald (Hg.): Philosophy of Psychology: Debates on Psychological Explanation. Oxford 1995: 356–392)
„Wenn jemand Schmerz empfindet, dann ist es für ihn irgendwie, Schmerzen zu haben. (...) Es wäre absurd anzunehmen, daß es für einen Hund nicht irgendwie ist, an seinem Lieblingsknochen zu nagen.“ (...) (Michael Tye in Thomas Metzinger, Hg.: Bewußtsein. Beiträge aus der Gegenwartsphilosophie. 2. Aufl. Paderborn u.a. 1996:108f.)
„Wenn sich ein Mensch durch eine verächtliche Bemerkung 'beleidigt fühlt', wenn er in Zorn gerät, wenn er nach Gerechtigkeit verlangt, wenn er sich 'für ein Ideal begeistert', wenn er nach Wissen strebt und ihm Erkenntnis wird, wenn er den 'Biß des Gewissens' oder den 'Schmerz der Reue' durchmacht, wenn er Neid und Eifersucht erlebt, wenn er nach Erfolg und Macht strebt, - in allen diesen Fällen, die mitten aus unserer Lebenserfahrung gegriffen sind und als Erlebnistatsachen so gesichert dastehen, wie nur irgendeine physikalische Tatsache gesichert sein kann, in allen diesen Fällen wäre ein Zweifel, ob es sich dabei nicht dennoch um rein körperliche und nicht um psychische Tatsachen handelt, schlechthin undurchführbar: so klar tritt hier das psychische Bewußtseinsgeschehen in seiner Eigenart gegenüber dem physikalischen Geschehen hervor.
Unbezweifelbare Tatsache ist, daß es ein psychisches Sein und Geschehen gibt und daß eine Welt des Lebens und Erlebens 'neben' der wahrgenommenen Welt 'physikalischen Geschehens' besteht.“ (Theodor Erismann: Allgemeine Psychologie I, Berlin 1965:7)
„...anyone who is honest and not anaesthesized knows perfectly well that he/she experiences and can introspect actual inner mental episodes or occurences, that are neither actually accompanied by characteristic behavior nor are merely static hypothetical facts of how he/she would behave if subjected to such-and-such a stimulation.“ (William Lycan in ders., Hg.: Mind and Cognition. Cambridge, Mass. 1990:5)
„Festzustellen ist nur, daß es eine elementare Tatsache des Seelischen ist, daß alle beseelten Lebewesen mit Hilfe bestimmter psychischer Prozesse mit ihrer Umgebung Kontakt gewinnen, daß sie in erlebende und praktische Kommunikation und in Wechselverkehr mit ihr treten, daß sie auf ein Außen sich beziehen, auf ein Anderes sich hinwenden, irgendeinem Anderen und Äußeren zugewandt und auf dieses bezogen sind, und so zu mehr oder weniger primitiven Formen des ‚Habens‘ von gegenständlichen Erlebnissen, des ‚Wissens‘ von Etwas, des Gewahrens von Etwas, der Kenntnisnahme gelangen, d.h. daß sie perzeptive Prozesse vollziehen.“ (Erich Rothacker: Die Schichten der Persönlichkeit. 5. Aufl. Bonn 1952:9)
„Ich kann klar feststellen, daß ich jetzt diese Empfindung, diese Wahrnehmung, diesen Gedanken habe. Mir sind diese Zustände so gegeben, daß es absurd erscheint, an ihrem Vorhandensein zu zweifeln. Dies heißt aber nichts anderes, als daß sie erfahren werden und daß man diese Erfahrung als Grund dafür anerkennt, sie als vorhanden anzunehmen.“ (Volker Gadenne/Margit E. Oswald: Kognition und Bewußtsein. Berlin u.a. 1991:23)
In ähnlicher Weise sagt man auch, es fühle sich jeweils anders an, Rot zu sehen, eine Symphonie zu hören oder ein Bier zu trinken. Diese besonderen Empfindungen seien auf nichts anderes reduzierbar, gleichsam Urgegebenheiten von „Qualia“, wie man auch gern sagt (traditionell "Erlebnisgehalt"). Jeder Versuch der Naturalisierung finde hier seine Grenze, niemand könne erklären, wie aus den materiellen Strukturen des Körpers solche Qualia-Erfahrungen entstehen, anders gesagt: wie aus Materie Bewußtsein entstehe (die „Erklärungslücke“).
Andreas Kemmerling läßt offen, ob er durch einen „Schluß“ oder durch die behauptete Evidenz oder durch beides zum „Geist, wie er uns vertraut ist“, kommt:
„Mentale Repräsentation findet statt, wann immer wahrgenommen oder gedacht, gewollt oder gefühlt wird. Denn all dies sind geistige Phänomene, und sie alle haben einen Inhalt; jedes von ihnen allein reicht aus, um den Schluß zu ziehen: Es gibt mentale Repräsentation. Jeder beliebige geistige Zustand, Vorgang oder Akt mit einem intentionalen Gehalt bezeugt unmittelbar das Phänomen der mentalen Repräsentation. Mentale Repräsentation, als Singulare tantum, leugnen, hieße den Geist, wie er uns vertraut ist, selbst leugnen. (...) Mentale Repräsentation gibt es, das ist unbestritten.“ (Andreas Kemmerling in Kognitionswissenschaft 1, 1992:47f. )
Der letzte Satz erinnert an den triumphierenden Ton, in dem John Searle die „Wiederkehr des Geistes“ verkündet.
„Wenn aus einer Theorie die Nichtexistenz von Bewußtsein folgt, dann ist dies meines Erachtens eine schlichte reductio ad absurdum der Theorie.“ (John Searle: Die Wiederentdeckung des Geistes. München 1993:23)
In Wirklichkeit wird mentale Repräsentation von namhaften Philosophen wie Peter Hacker und von den Behavioristen bestritten. Skinner kommentiert:
„The battle cry of the cognitive revolution is 'Mind is back!' A 'great new science of mind' is born. Behaviorism nearly destroyed our concern for it, but behaviorism has been overthrown, and we can take up again where the philosophers and early psychologists left off.” (Recent Issues in the Analysis of Behavior. Columbus 1989:22)
Begriffliche Schwierigkeiten mit „Aboutness“
Die Intentionalität im phänomenologischen Sinn wird heute oft auf eine Weise formuliert, die für Nichtmentalisten geradezu unverständlich ist:
„Some things in the world - for example, pictures, names, maps, utterances, certain mental states - represent, or stand for, or are about other things.“ (Robert C. Stalnaker: Inquiry. Cambridge, Mass./London 1984:6)
„Something has an intentional property if it has propositional content, or if it is about something.“ (Rosenthal in Ders. [hg.]:463)
„Intentionality is aboutness. Some things are about other things: a belief can be about icebergs, but an iceberg is not about anything; an idea can be about the number 7, but the number 7 is not about anything; a book or a film can be about Paris, but Paris is not about anything.“ (Daniel Dennett: Intentionality (with John Haugeland), in R. L. Gregory, ed., The Oxford Companion to the Mind. Oxford 1987)
„Intentionality is the power of minds to be about, to represent, or to stand for, things, properties and states of affairs.“ (Jacob: Intentionality. Stanford Encyclopedia of Philosophy)
Die „über“-Beziehung ist uns von Verben des Sprechens und Denkens bekannt, die mit einem Präpositionalobjekt über x verbunden werden: sprechen, nachdenken usw. über etwas (aber bemerkenswerterweise nicht denken allein). Diese Verben können auch als Abstrakta substantiviert werden und erben dann die Valenz des Verbs: eine Rede (ein Vortrag, ein Buch usw.) über etwas. Eine philosophische Abstraktion ist die „Proposition“. Darin ist substantiviert, daß jemand etwas sagt. Auch Buch und Text werden nicht als „Gegenstände“, sondern als Abstraktionen zu Verba dicendi bzw. Synonyme davon mit "über" konstruiert. Dinge und Zustände können im eigentlichen Sinn nicht „über“ etwas sein. So zerfällt auch die Welt nicht in Gegenstände, die über etwas sind, und solche, die nicht über etwas sind. Das ist keine sachliche Feststellung, sondern eine begriffliche, sprachkritische. Ich frage mich, wie ein so scharfsinniger Denker sagen kann, manche Dinge (!) seien "über" etwas. Dennett ist hier ebenso naiv wie Searle.
Manchmal werden die „Dinge“ zu „Entitäten“ verfremdet, damit die Unbegreiflichkeit der Aboutness nicht so auffällt. Das ändert natürlich nichts an der Kritikwürdigkeit. Neuerdings hat man die Intentionalität in den Jargon der Neurologie gepackt und fragt danach, wie neuronale Prozesse sich auf etwas beziehen können. Sie steuern das Verhalten, darunter das Sprachverhalten, aber als reale Vorgänge können sie sich schon begrifflich nicht auf etwas „beziehen“, und der Neurologe wird auch bei genauester Beobachtung nichts dergleichen finden.
| Kommentare zu »Intentionalität und Sprache« |
| Kommentar schreiben | älteste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.10.2025 um 06.50 Uhr |
|
Wir reden zwar selbst von folk psychology usw., aber eigentlich treibt jemand, der einem anderen Absichten und Ansichten zuschreibt, keine Psychologie. Die mentalen (intentionalen) Ausdrücke haben eine andere Funktion im alltäglichen Sprechen. Wie mit Goethes treffender Analyse gezeigt, ist „ich will das tun“ eigentlich „ich werde das tun, wenn nichts dagegen einzuwenden ist“ o . ä., und da ist nichts von Intentionalität mehr zu erkennen. Es ist gar keine Psychologie im Spiel, auch keine folksige. Das legen erst die Philosophen hinein. Darum brauchen wir auch weder „Gedankenlesen“ noch eine „Theorie des Geistes“, um solche Verständigungsweisen zu verstehen und uns daran zu beteiligen. – Auch „stell dir vor“ ist nicht unbedingt im psychologischen Sinn als Aufforderung zu einer geistigen Handlung zu verstehen, sondern etwa als Aufforderung, die weitere Rede so zu formen, als ob sie von bestimmten Kontingenzen gesteuert würde. Es ist also eine Art Verstellungsspiel. Das ist der unpsychologische Sinn der Psychologie.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.10.2025 um 05.56 Uhr |
|
Unter dem Einfluß der Phänomenologie würden heute viele Philosophen diesen Fundamentalsatz unterschreiben: „Heute gibt es auf der Erde Lebewesen, die intentionale Zustände haben.“ (Geert Keil/Herbert Schnädelbach: „Naturalismus“ in Dies., Hg.: Naturalismus. Frankfurt 2000:7-45, S. 17) Man sieht den Grundfehler in reinster Form. „Intentionale Zustände“ ist eine irreführende, gelehrt klingende Neuformulierung von „Absichten“. Und Absichten existieren nicht einfach „heute auf der Erde“, sind keine „biologischen Phänomene“, wie Searle behauptet, sondern werden im Rahmen einer naiven Psychologie zugeschrieben. Was es wirklich auf der Erde gibt, sind sprachfähige Lebewesen, die vorab und nachträglich über ihr Verhalten diskutieren, es also ankündigen und rechtfertigen. Diese Fähigkeit muß und kann erklärt werden. Zugleich muß immer wieder die Redeweise von „intentionalen“ oder „gerichteten Zuständen“ als sprachwidrig und sinnlos entlarvt werden. Ein Zustand kann nicht gerichtet sein; er kann ja auch nicht grün sein. Die fachsprachliche Verfremdung einfacher folkpsychologischer Ausdrücke trägt wesentlich zur Verhüllung der Sinnlosigkeit bei. Searle behauptet, „die abgeleitete Intentionalität sprachlicher Elemente“ (d. h. deren Bedeutung) beruhe „auf der biologisch grundlegenderen intrinsischen Intentionalität des Geistes/Hirns“ (Die Wiederentdeckung des Geistes. München 1993:9; vgl. ders.: Intentionalität. Frankfurt 1983:60) Schon der „Geist“ ist kein „biologisches Phänomen“, erste recht nicht dessen Gerichtetheit. Wie kann man einen solchen Unsinn verbreiten? (Ganz abgesehen von der Monstrosität „Geist/Hirn“. Der Geist mag Absichten und Gerichtetheit haben, das gehört zum Konstrukt, aber das Hirn? Da kann man lange suchen.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.08.2025 um 04.34 Uhr |
|
Trotzdem ist es so. Anpassung beginnt mit Zufallstreffern. Darauf folgt die "Verstärkung" – phylogenetisch durch den Fortpflanzungserfolg.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 30.08.2025 um 02.19 Uhr |
|
Ja, wenn man den ersten Schuß, der überhaupt irgendwo im Weißen der Scheibe gelandet ist, schon als Treffer bezeichnet und spätere Verbesserungen bis in die Mitte des Schwarzen hinein nur als Zielen, dann kommt tatsächlich das Treffen vor dem Zielen. Das finde ich aber doch recht trickreich ausgedrückt.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 29.08.2025 um 14.06 Uhr |
|
Schon, aber wo ist die paradoxe Reihenfolge? Die fleißige Biene ist ja auch erst im Zusammenhang mit der attraktiven Blüte entstanden. Eine wechselseitige Verstärkung.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.08.2025 um 12.30 Uhr |
|
"Blind variation and selective retention" (wie schon oft zitiert und ausgeführt. Das ist durchaus nicht so wie mit Henne und Ei. Zuerst findet die Biene die Blüte aus irgendeinem Grund attraktiv, dann wird die Blüte aus ebendiesem Grund immer attraktiver. (Die anderen Blüten werden nicht so oft angeflogen.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 29.08.2025 um 11.37 Uhr |
|
zu #56116: Das hat etwas von der Geschichte mit der Henne und dem Ei. "Erst entgeht das zufällig veränderte Insekt dem Vogel, dann entwickelt es die Mimikry." Kam nicht vor dem Entgehen noch die zufällige Veränderung, also zumindest ein Ansatz von Mimikry? "Erst zieht die Pflanze den Bestäuber an, dann bildet sie die Blüten aus, die ihn anziehen." Womit hat sie ihn den erst angezogen? "Erst bekommt das Kind etwas, dann will es haben." Das ist (wegen des Passivs) nicht ganz das gleiche wie in den anderen Beispielen. Entsprechender wäre: Erst hat das Kind etwas, dann will es haben. Dem ersten Haben liegt auch schon eine Art Besitzergreifung (Wollen) zugrunde. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.08.2025 um 05.10 Uhr |
|
Warum gibt es Filme „über“ den Bürgerkrieg, aber keine Bilder? Gegen Dennett und die anderen zitierten Autoren sind Bilder eben keine „things about things“. Der Grund muß sein, daß Filme etwas mitteilen (eine wahrheitsfähige Aussage machen), Bilder aber nicht. Vgl. Wittgensteins Abbildung eines Mannes in Boxerpose: Zeigt es, was man tun soll, was man nicht tun soll, was jemand getan hat...? Ein Film über den Bürgerkrieg behauptet (zeigt), wie es gewesen ist. Er kann also wahr oder unwahr sein. Fiktionale Filme (über Odysseus) werfen nur das Problem des Verstellungsspiels auf, aber innerhalb dieses Spiels gilt das gleiche. (Ich weiß nicht mehr, ob Nelson Goodman das berücksichtigt.)
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.08.2025 um 04.51 Uhr |
|
Paradox, aber wahr: Das Treffen kommt vor dem Zielen. Das Erreichen des Ziels geht genetisch und lerngeschichtlich dem Zielen voraus. Erst bekommt das Kind etwas, dann will es haben. Die Wunscherfüllung geht dem Wunsch vorher. Phylogenetisch: Erst zieht die Pflanze den Bestäuber an, dann bildet sie die Blüten aus, die ihn anziehen. Erst entgeht das zufällig veränderte Insekt dem Vogel, dann entwickelt es die Mimikry. Der Zufallserfolg wirkt auf das Subjekt zurück, vgl. den ersten Satz von Skinners „Verbal behavior“. So geht auch das Verstehen dem Meinen voraus: Wir fangen an, etwas zu meinen, nachdem wir die Erfahrung gemacht haben, daß andere uns verstehen. Weil wir planen, gibt es Zukunft. Es scheint uns andersherum zu sein. Diese Erlebnisperspektive ist nicht falsch im gewöhnlichen Sinn, sie hat sogar ihren guten Sinn. Man darf sie bloß nicht für die Wissenschaft reklamieren. Durch die Umkehrung der Perspektive verschwindet die Metaphysik der Intentionalität (Referenz, Repräsentation). |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 25.08.2025 um 22.45 Uhr |
|
Dann habe ich den Scholastikern wohl unrecht getan, aber Brentano ansonsten wohl schon richtig verstanden. Ich denke, er versteht unter immanenter Existenz jedenfalls etwas anderes als reale, stoffliche Existenz. Letztlich ist das dann eine Frage der Formulierung. Anstatt das Denken, Gedanken über Intentionalität (Liebe/Haß/... beziehen sich auf etwas/ein Objekt) zu erklären, kann man m. E. all dies auch als Aussagen verstehen. Denken ist doch im Grunde leises Sprechen, jedes Gefühl, jeder Gedanke eine Aussage.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.08.2025 um 18.59 Uhr |
|
Brentano meint In-Existenz als Darin-Sein, nicht als Negation von Existenz. Die Wortbildung ist unglücklich, stammt aber von den Scholastikern, auf die er sich ausdrücklich beruft.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 25.08.2025 um 13.15 Uhr |
|
Es mutet mich seltsam an, von einem Ding, das nicht existiert, zu sagen, auf welche Weise es nicht existiert. "Intentionale (mentale) Inexistenz" meint also eigentlich "intentionale (mentale) Existenz", nämlich eine andere Art von Existenz. Brentano nennt es deshalb lieber eine "immanente" Gegenständlichkeit, ein "immanentes" Etwas, d.h. er meint letztlich auch eine andere, "immanente" Art von Existenz. Ich finde, daß er damit zwar im Grunde recht hat, würde aber statt von Intentionalität, immanenten Etwassen eher von logischen Aussagen sprechen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.08.2025 um 05.52 Uhr |
|
Ob jemand für die phänomenologische Verführung anfällig ist, entscheidet sich an seiner Stellung zu Brentanos klassischer Formulierung: „Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisiert, was die Scholastiker des Mittelalters die intentionale (auch wohl mentale) Inexistenz des Gegenstandes genannt haben, und was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt (worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist), oder die immanente Gegenständlichkeit nennen würden. Jedes enthält etwas als Objekt in sich, obwohl nicht jedes in gleicher Weise. In der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urteil etwas erkannt oder verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehaßt, in dem Begehren begehrt usw.“ Evidente Wahrheit oder kompletter Unsinn? Darum dreht sich letzten Endes alles, Kognitivismus vs. Naturalismus usw. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 17.07.2025 um 09.17 Uhr |
|
Wie kann ein Physiologe etwas Nicht-Physisches wie Schmerz erklären? Sie sagen nur, Schmerz ist nicht objektiv, damit befasse ich mich nicht, fertig. Das ist mir zu einfach, es erklärt nichts. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.07.2025 um 04.11 Uhr |
|
Daß ein "physikalischer Körper auf Schmerz reagiert", ist Ihre Aufgabenstellung. Ich würde das nie so ausdrücken und muß es auch nicht erklären. Flucht- und Vermeidungsreaktionen gibt es im ganzen Tierreich. Die Physiologen werden das erklären, es ist nicht meine Aufgabe. Organismen in psychologischen Begriffen zu beschreiben ist Panpsychismus, und das ist kein Scherz. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.07.2025 um 22.21 Uhr |
|
Steckt in Ihrer Bemerkung "Panpsychismus oder was?" evtl. auch ein wenig Spott? Ja, der Name ist denkbar unvorteilhaft gewählt. Er hört sich eher nach einer religiösen Sekte an als nach einer ernstzunehmenden materialistischen Theorie. Wie erklären Sie denn das Vermeidungsverhalten von Lebewesen, also physikalischer Körper, auf Schmerz?
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.07.2025 um 17.37 Uhr |
|
M. W. ist noch nicht geklärt, wie ein geistiges Prinzip (nur subjektiv wahrnehmbarer Schmerz) eine physikalische Wirkung (Ausweichen) entfaltet. Ohne Schmerz gibt es die physische Reaktion i. a. nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.07.2025 um 16.14 Uhr |
|
Panpsychismus oder was? Aus meinen bescheidenen Kenntnissen der Physik ist mir nichts davon in Erinnerung.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.07.2025 um 14.15 Uhr |
|
Vielleicht ist es ja ein Fehler, vielleicht gehört Willen zur Physik? Auch Schmerz gehört angeblich nicht zur Physik, trotzdem dient er Lebewesen als Warnsignal vor Verletzungen. Materie weicht Schmerz aus. Wie macht sie das, wenn Schmerz nichts Physikalisches ist? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.07.2025 um 12.48 Uhr |
|
„In einer determinierten Welt gäbe es womöglich keinen freien Willen.“ (Aus einem Beitrag über Quantenmechanik, SZ 16.7.25) Das ist keine Tatsachenfrage, weil in der Physik der Begriff des Willens nicht vorkommt. Man redet immer noch aneinander vorbei. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.07.2025 um 12.00 Uhr |
|
Mir scheint, daß man etwas ankündigt, das mit großer Sicherheit feststeht, z. B. weil man es weiß oder selbst in der Hand hat, während man etwas voraussagt, wenn es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit behaftet ist, oder wenn die Kenntnis davon so erstaunlich ist, daß es mit einer übernatürlichen Fähigkeit zusammenzuhängen scheint. Ankündigen ist also eher etwas mehr, sicherer als voraussagen. So gesehen ist die Formulierung "nur ankündigen, nicht voraussagen" gerade verkehrtherum. Mein eigenes Verhalten habe ich natürlich im Griff, es erstaunt niemanden, daß ich schon vorher weiß, was ich tue, tun will. Deshalb wäre es allenfalls ein Scherz, es vorauszusagen. Daß ich mein eigenes Verhalten nicht beobachten kann, trifft m. E. nicht zu. Es ist lediglich zu trivial, es so zu nennen, da ich mir ja in jedem Moment sowieso meines Tuns bewußt bin. Die eigene Beobachtung ist sozusagen implizit, automatisch immer gegeben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.07.2025 um 03.56 Uhr |
|
Zum vorigen: "Ankündigung" (s. Goethes "Vorausverkünden" im Haupteintrag u. ö.) und "Voraussage" beziehen sich beide auf künftiges Geschen und werden auch austauschbar gebraucht, aber wenn es auf den Unterschied ankommt (im unterscheidenden Kontext), könnte man differenzieren: Eigenes Verhalten kann man nur ankündigen, nicht voraussagen, und damit wird es beeinflußbar durch Zustimmung oder Einspruch des Gesprächspartners (Handlungsspiel). Das Wetter kann man in diesem Sinn nur voraussagen, nicht ankündigen. Im vorigen Eintrag habe ich im Zusammenhang damit gesagt, daß man sein eigenes Verhalten nicht objektiv beobachten kann wie irgendein Ereignis und daher auch nicht physikalistisch von sich selbst reden kann. Diese Implikationen werden im "Gott-Spielen" zu einem komischen Effekt genutzt: "Schönes Wetter heute!" – "Danke!" |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.07.2025 um 05.00 Uhr |
|
Als Dialogpartner kann ich auf das intentionale Idiom ("ich will" usw.) nicht verzichten, darum kann ich mich auch nicht objektiv beobachten wie einen fremden Organismus, und das gleiche gilt für mein Verhältnis zum Gegenüber. Wir können unserem Verhalten nicht zusehen wie dem eines anderen Tieres, sondern sind beide für unser Handeln, und zwar zunächst schon für das Sprechen, „verantwortlich“ (ein nicht-physischer Begriff). Wir stehen uns als „Personen“ gegenüber, und Personen sind keine natürlichen Objekte. Das bedeutet nicht die Existenz einer zweiten, nicht-empirischen („intelligiblen“) Welt, in der es Personen gibt, sondern einfach zwei verschiedene Arten der sprachlichen Orientierung und Verhaltenskoordination. Skinner mußte immer wieder darauf hinweisen, daß er als Mensch unter Menschen nicht die Sprache der strikten Verhaltensanalyse sprach, was aber keine Widerlegung des Behaviorismus sei. Mit dieser Trennung von Alltags- und Wissenschaftssprache ließ er es bewenden. Philosophen wie die Churchlands haben die „Eliminierung“ des intentionalen Idioms für möglich und wünschenswert gehalten. (S. https://de.wikipedia.org/wiki/Eliminativer_Materialismus) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.06.2025 um 05.53 Uhr |
|
Descartes’ Dualismus (res extensa – res cogitans) vergegenständlicht die beiden Weisen der Orientierung und des Umgangs, in die jeder Mensch hineinwächst: Hantieren vs. Kommunizieren. Der Mensch braucht nicht als „natural born dualist“ (Paul Bloom) angesehen zu werden, er wird unweigerlich zu einem solchen. Das ist leicht zu beobachten. Achten Sie mal darauf, wenn das nächste Kind oder Enkelkind geboren wird! Je hilfloser der Nesthocker, desto mehr Kommunikation ist zum Überleben notwendig.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.06.2025 um 04.37 Uhr |
|
Ist das „Prinzip der natürlichen Auslese“ ein „kausales Prinzip“? So behauptet es Gerhard Vollmer (in Geert Keil/Herbert Schnädelbach, Hg.: Naturalismus: Philosophische Beiträge. Frankfurt 2000:49) Ich sehe nicht recht, was „kausal“ hier bedeutet und was es zur Beschreibung des Vorgangs hinzufügt. Die besser angepaßte Variante vermehrt sich stärker und „erobert“ damit ihre ökologische Nische. Das ist Statistik, nicht Kausalität. S. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#35023 und die Diskussion dort. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.06.2025 um 05.53 Uhr |
|
Es gibt aus sprachlichen Gründen keine „Dinge über Dinge“ (things about things, nach Dennett und anderen). Es gibt Aussagen über etwas, aber Aussagen sind keine Dinge. „Rede“ ist ein Abstraktum, d. h. die Substantivierung von „daß/wie/wenn jemand redet“. Aber wer über etwas redet, stellt dabei kein Ding über etwas her, er stellt überhaupt nichts her. (Die Produktmetapher für Rede macht sich wieder störend bemerkbar.) Wie ist es möglich, daß belesene und geistvolle Menschen wie Dennett das nicht durchschauen? Die ganze Lehre von der Intentionalität hängt daran, samt „Philosophie des Geistes“. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.06.2025 um 08.27 Uhr |
|
Nehmen wir uns noch einmal Brentanos Locus classicus vor: „Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisiert, was die Scholastiker des Mittelalters die intentionale (auch wohl mentale) Inexistenz des Gegenstandes genannt haben, und was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt (worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist), oder die immanente Gegenständlichkeit nennen würden. Jedes enthält etwas als Objekt in sich, obwohl nicht jedes in gleicher Weise. In der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urteil etwas erkannt oder verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehaßt, in dem Begehren begehrt usw. Diese intentionale Inexistenz ist den psychischen Phänomenen ausschließlich eigentümlich. Kein physisches Phänomen zeigt etwas Ähnliches. Und somit können wir die psychischen Phänomene definieren, indem wir sagen, sie seien solche Phänomene, welche intentional einen Gegenstand in sich enthalten.“ Das Unglück beginnt schon dann, wenn man die begriffliche Monstrosität hinnimmt. „Richtung“ und „Inhalt“ sind miteinander unvereinbare Bilder, aber eben dadurch als nur bildhaft gekennzeichnet, so daß als unverstellte Wirklichkeit nur die Transitivität gewisser Verben übrig bleibt. Davon hat sich der Verfasser zu seiner Konstruktion verführen lassen, und der ganz Troß der Phänomenologen trottet hinterher – bis zu den heutigen Mentalisten, die immer noch von „intentionalen Phänomenen“ reden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.06.2025 um 06.32 Uhr |
|
Der Standpunkt von Keil/Schnädelbach und vielen anderen würde dazu führen, die Entstehung der Sprache bis hin zu ihren Metaphern, transgressiven Übertragungen und geschichtlich späten Konstrukten nicht für einen natürlichen Vorgang zu halten. Die behavioristisch disziplinierte, experimentelle Verhaltensanalyse ist zweifellos eine biologische Teilwissenschaft, ebenso wie die eher beobachtende Ethologie in der Tradition von Tinbergen und Lorenz. Das Verhalten der Organismen ist ebenso Teil der Natur wie ihre Anatomie und Physiologie. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.06.2025 um 04.10 Uhr |
|
Keil sagt in einem gleichzeitig erschienenen Buch: „Unter einer naturalistischen Theorie verstehe ich eine solche, die in nichtintentionalem Vokabular formulierte hinreichende Bedingungen für das Vorliegen eines intentionalen Phänomens angibt.“ (Geert Keil: Handeln und Verursachen. Frankfurt 2000:4) Auch hier werden also die „intentionalen Phänomene“ schlicht vorausgesetzt. Ich nenne das naiv. Für die Verfasser dieser Literatur ergibt sich die Frage aller Fragen: Wie kommt Intentionalität in die Welt? (Gleichbedeutend: Wie hat sich der Geist entwickelt? Usw.) Sie kommt gar nicht in die Welt, weil der Begriff von vornherein den falschen Ort zugewiesen bekommen hat. Es gibt keine "intentionalen Phänomene", "intentionalen Zustände" usw. Näheres im Haupteintrag. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.06.2025 um 18.50 Uhr |
|
„Manche von uns können auch komponieren, Schach spielen oder philosophische Aufsätze schreiben. Daß Menschen diese Dinge können, ist eine harte Tatsache. Es ist aber keine Naturtatsache, denn diese Fähigkeiten sind in der Menschheitsgeschichte bei weitgehend unveränderter genetischer Ausstattung ausgebildet worden.“ (Geert Keil/Herbert Schnädelbach: „Naturalismus“. In dies., Hg.: Naturalismus: Philosophische Beiträge. Frankfurt 2000:7-45, S. 18) Man beachte, wie unterderhand „natürlich“ gegen „genetisch“ ausgetauscht wird. Später heißt es mehrmals, bei solchen kulturellen Fähigkeiten handele es sich nicht um „biologische“. Kulturelle Fähigkeiten gehörten „nicht zur natürlichen, biologischen Ausstattung des Menschen“ (S. 19). Ich halte dies für unzulässige Subreptionen. Kulturelle Fähigkeiten werden durch Lernen und Lehren, d. h. durch Nachahmen, Vormachen und Shaping weitergegeben und akkumuliert, und die Verhaltensforschung, die solche Vorgänge untersucht, gehört durchaus zur Biologie. Geschichte ist ein Teil der Natur, auch wenn es nicht zweckmäßig ist, sie mit genetischen, chemischen oder physikalischen Methoden zu untersuchen. (Mit der These „Alles ist Chemie“ hat Hubert Markl einst für Aufregung gesorgt („Die Natürlichkeit der Chemie“ ZEIT 6.12.91). Es ging ihm allerdings nur um „das modische Mißtrauen in die Chemie und die Sehnsucht nach sanfter Natürlichkeit“, so der Untertitel. Daß die Chemie den Spracherwerb, die Popmusik oder den Dreißigjährigen Krieg erklären könne, wollte er nicht behaupten.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.06.2025 um 18.01 Uhr |
|
Zum vorigen: Wenn „Naturalismus“ so vieldeutig, eigentlich ungreifbar ist, wie die Verfasser zutreffend darlegen, fragt man sich allerdings, welchem Gegenstand ihre einleitend bekundete geringe Sympathie (S. 7) und Keils umfangreiche „Kritik des Naturalismus“ (in seinem gleichnamigen Buch von 1983) eigentlich gelten. Ich halte mich lieber an einzelne Thesen wie die zitierte von der Gegebenheit intentionaler Zustände auf der Erde, die meiner Ansicht nach weder für Naturalisten noch für ihre Kritiker einen gemeinsamen Boden abgibt. Sie ist wie Dennetts „things about things“ eine Fehlkonstruktion und Mystifikation. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.06.2025 um 16.46 Uhr |
|
„Heute gibt es auf der Erde Lebewesen, die intentionale Zustände haben.“ (Geert Keil/Herbert Schnädelbach: „Naturalismus“. In dies., Hg.: Naturalismus: Philosophische Beiträge. Frankfurt 2000:7-45, S. 17) Diesen ohne Diskussion vorausgesetzten Satz bestreite ich, und zwar nicht, weil er nicht wahr ist, sondern weil ich dem Begriff „intentionaler Zustände“ jeden Sinn abspreche. Der Begriff der „Absicht“, der sich darin verbirgt, ist mißverstanden, wenn man ihn als Zustand versteht. Unter „Naturalisierung der Intentionalität“ zeige ich, welchen Ort der Begriff der „Absicht“ in Wirklichkeit hat. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.05.2025 um 04.18 Uhr |
|
Evolutionslehre und Behaviorismus helfen uns, den Begriff der Intentionalität aus der Wissenschaft zu eliminieren. Leicht ist es nicht nachzuvollziehen, weil „wollen“ sehr tief in unserer Alltagskommunikation verankert ist (s. Naturalisierung der Intentionalität). Noch schwerer ist es, auch das „Wissen“ aufzulösen. Daß die Bohnenranke nichts weiß, würden heute die meisten zugeben, aber wie steht es mit den Bienen, Bibern, Brieftauben? Tiere lernen etwas, also werden sie wohl auch etwas wissen... Am überzeugendsten ist vielleicht der Nachweis, daß die Verhaltensbiologie den Begriff nicht braucht. Er ist überflüssig. Philosophierende Biologen verfahren oft umgekehrt, indem sie z. B. behaupten, auch die Stammesgeschichte habe den Lebewesen ein Wissen eingepflanzt. Organismen wissen nichts, weil „wissen“ nur von Personen ausgesagt werden kann. Es ist ein Mittel zur Organisation von Dialogen. Ohne Sprache kein Wissen – aus begrifflichen Gründen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.04.2025 um 04.52 Uhr |
|
Man sagt, die Wahrnehmung sei kein passives Abbilden, sondern ein aktives Konstruieren. 1. Die Einzelheiten, die wir in der Ferne erkennen, werden durch komplizierte Schaltungen aus dem sehr unvollkommenen Netzhautbild gewonnen, ebenso die Gehörseindrücke aus fragmentarischen Schallereignissen. 2. Wir können eine ruhende Umgebung nur sehen, weil der Augapfel ständig eine zitternde Bewegung ausführt. Fixiert man ihn, tritt wegen der Ermüdung der Sehzellen eine Art Blindheit ein. (Ein Frosch nimmt tatsächlich nur bewegte Gegenstände wahr, „verrechnet“ aber die Eigenbewegung mit der wahrgenommenen Umwelt.) In diesem Zustand werden dann schemenhaft Formen gesehen, die nur auf früherer Erfahrung beruhen können. So auch bei der Wiedergewinnung von Gehörseindrücken aus den scheppernden Geräuschen, die ein Cochleaimplantat erzeugt. Es ist müßig zu fragen, ob diese Vorgänge „aktiv“ oder „passiv“ sind. Sie spielen sich unterhalb der Handlungsebene („Intentionalität“) ab. In der Natur gibt es solche gesellschaftlichen Unterscheidungen nicht. In biologischen Texten sollten solche Begriffe gar nicht vorkommen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.01.2025 um 15.28 Uhr |
|
Auch Max Planck hat sich zur Willensfreiheit geäußert. Nach längeren Ausführungen sagt er: „Nach dem Ergebnis unserer Untersuchung ist der Gegensatz zwischen strenger Kausalität und Willensfreiheit nur ein scheinbarer, die Schwierigkeit liegt lediglich in der sinngemäßen Formulierung des Problems. Denn die Antwort auf die Frage, ob der Wille kausal gebunden ist oder nicht, lautet verschieden, je nach dem Standort, der für die Betrachtung gewählt wird. Von außen, objektiv betrachtet, ist der Wille kausal gebunden; von innen, subjektiv betrachtet, ist der Wille frei. Oder anders gefaßt: Fremder Wille ist kausal gebunden, jede Willenshandlung eines andern Menschen läßt sich, wenigstens grundsätzlich, bei hinreichend genauer Kenntnis der Vorbedingungen, als notwendige Folge aus dem Kausalgesetz verstehen und in allen Einzelheiten vorausbestimmen. Inwieweit das praktisch geschehen kann, ist lediglich eine Frage der Intelligenz des Beobachters. Der eigene Wille dagegen ist nur für vergangene Handlungen kausal verständlich, für zukünftige Handlungen ist er frei, eine eigene zukünftige Willenshandlung läßt sich unmöglich, auch bei noch so hoch ausgebildeter Intelligenz, rein verstandesmäßig aus demgegenwärtigen Zustand und den Einflüssen der Umwelt ableiten.“ (1936; es gibt verschiedene Formulierungen, die aber alle das gleiche sagen.) Ich würde sagen: Von außen betrachtet gibt es überhaupt keinen Willen; der Wille und die Motive usw., von denen Planck spricht, sind gar keine Beobachtungstatsachen. Der Ort solcher Ausdrücke in der Verständigungspraxis ist nicht richtig bestimmt (s. Haupteintrag). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.01.2025 um 17.04 Uhr |
|
Schmerz ist das meistdiskutierte, aber vielleicht nicht das beste Beispiel. Man sollte auch an Angst, Sorge, Heimweh und Liebeskummer denken. Schmerz ist kein Gegenstand, den man beobachtet und dann in Worten beschreibt oder benennt. Sachverhalte oder Gegenstände wie Jahresringe oder Wolken kann man betrachten und sich nach Belieben auch von ihnen abwenden. Von solcher Art ist Schmerz nicht. Ablenkung ist in gewissen Grenzen möglich. Wittgenstein versucht, die Bekundung von Schmerz als Teil des Schmerzverhaltens zu verstehen. Warum Schmerz kein unproblematisches Beispiel ist, will ich mit einigen Anmerkungen belegen. Schmerz wird sehr ungleich empfunden. Was wir tagsüber kaum wahrnehmen, kann nachts ein Riesending werden. Dann die Beobachtung, daß schon kleine Kinder mit ein und derselben Verletzung (einem "Aua") ganz verschieden umgehen. Ein Kind fällt im Eifer des Spiels hin, schlägt sich das Knie auf, läuft weiter, als wäre nichts geschehen. Dieselbe Verletzung führt zu endlosem Geschrei, wenn das Kind sie auf eine ungerechte Behandlung zurückführt; da kommt die "Empörung" hinzu (auch eine ziemlich komplexe Angelegenheit). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.01.2025 um 16.54 Uhr |
|
„Uns allen, Menschen, Hunden etc. bis hin zu Schlangen und vielleicht auch Würmern ist der Begriff Schmerz angeboren, wie man den bei allen Arten sehr ähnlichen Reaktionen entnehmen kann. Auch Hunger ist ein Begriff, den alle kennen, vielleicht auch Wut, Müdigkeit und manches andere. (Valentin Braitenberg: Das Bild der Welt im Kopf: Eine Naturgeschichte des Geistes.“ Stuttgart 2009) Vermeidungs- und Fluchtverhalten sind bei allen Tieren ähnlich, aber das berechtigt uns nicht dazu, sprachlosen Tieren „Begriffe“ zuzuschreiben und eine folkpsychologische Redeweise auf sie anzuwenden. Wenn ich einen Regenwurm piekse, krümmt er sich zusammen, andere Tiere laufen weg. Es bringt nichts, wenn ich den Tieren zusätzlich zum Vermeidungsverhalten noch "Schmerz" zuschreibe. Beim erwähnten dekapitierten Frosch wird es geradezu absurd. Wikipedia definiert: „Als Masochismus wird eine Persönlichkeitseigenschaft bezeichnet, bei der ein Mensch positive Emotionen daraus zieht, dass man ihm Schmerzen zufügt und/oder ihn demütigt.“ „Das Gegenstück zum Masochismus ist der Sadismus.“ Wieso? Man könnte als Gegenstück doch auch das Vermeiden von Schmerz ansehen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.01.2025 um 03.21 Uhr |
|
Ich glaube, es war hier: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1572#53588, Sie nannten Schmerzen bei Tieren eine überflüssige und irritierende Redeweise, also schon ähnlich wie müßig. Ich kann das schon bei Tieren nicht verstehen, und das würde ja nach Ihren Worten hier auch auf Menschen zutreffen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.01.2025 um 02.37 Uhr |
|
Ich habe jetzt übersehen, daß Sie hier nicht von einem lebenden Tier sprachen. Aber ich glaube mich zu erinnern, kann es nur leider im Moment nicht finden, daß Sie früher über das Schmerzempfinden von lebenden Tieren ähnlich geschrieben haben.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 15.01.2025 um 20.05 Uhr |
|
Dann wäre die Frage, ob der Mensch Schmerz empfindet, auch eine müßige Frage. Heißt das, die Antwort ist egal, sehen Sie Schmerz auch als bloßes Konstrukt wie das Denken an? Aber das kann doch wohl nicht sein. Ohne Schmerz (und damit natürlich auch ohne alle anderen Wahrnehmungen und Gefühle) wäre das Verhalten von Mensch und Tieren ein ganz anderes. Ich kann mir nicht vorstellen, daß es höher entwickeltes Leben überhaupt gäbe. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.01.2025 um 17.39 Uhr |
|
Ich meine es so, wie zum Beispiel Volker Sommer gefordert hat, den Menschen zu zoomorphisieren: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#52980 Das größte Hindernis ist die Sprache. Die muß man erst mal konsequent als Verhalten analysieren, also aufhören, sie zu verstehen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 15.01.2025 um 16.55 Uhr |
|
"Der Mensch als Frosch – das ist das Ziel", ist das eine Polemik gegen das Ihrer Meinung nach von Kognitivisten anvisierte Ziel, oder ist das Ihr Ziel? Wie meinen Sie den Satz? Sich selbst erfahren, damit meine ich, durch den Schmerz (bzw. auch durch andere Wahrnehmungen) die eigene Individualität, den eigenen Körper erkennen, ein ICH-Gefühl gegenüber der Außenwelt bis hin zum (Selbst-)Bewußtsein entwickeln. Der Schmerz bin ICH. Ich habe Schmerzen, also bin und denke ich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.01.2025 um 07.43 Uhr |
|
Die Botschaft hör ich wohl, aber ich verstehe sie nicht (weil ich sie nicht verstehen will, zugegeben!). "Sich selbst erfahren" – was ist denn das? Der geköpfte Frosch versucht immer noch, mit dem Bein einen Säurefleck auf seiner Haut zu entfernen, notfalls sogar mit dem kontralateralen. Empfindet er Schmerz? Müßige Frage. Der Mensch als Frosch – das ist das Ziel. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 15.01.2025 um 00.39 Uhr |
|
Was war zuerst da, der Schmerz oder der Schrei (die Empfindung oder das Verhalten)? Der Schrei ist kein erworbenes, sondern völlig unkontrolliertes Verhalten infolge eines Schmerzes. Man kann jemandem, der einen hinreichend starken Schmerz empfindet, nicht beibringen oder sagen, stell dich mal nicht so an, verhalte dich einfach vernünftig, der Schmerz ist nur ein Konstrukt. Ich meine damit, daß Menschen und Tiere vor jedem Verhalten erst einmal private Empfindungen haben. Durch die Empfindungen erfahren sie sich selbst. Daraus entwickelt sich schließlich ein (Selbst-)Bewußtsein und ein (Selbstschutz-)Verhalten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.01.2025 um 18.02 Uhr |
|
Dazu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1370#45433 http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1370#47018 http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1370#50055 und weitere Einträge. Nur daß ich damit das Problem nicht schaffen, sondern lösen will. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 14.01.2025 um 16.22 Uhr |
|
»Weder „Wille“ noch „Freiheit“ sind naturwissenschaftliche Begriffe, darum sind solche Texte von vornherein verfehlt.« Werden nicht solche Begriffe erst dadurch zu naturwissenschaftlichen, daß sie in den Naturwissenschaften definiert und benutzt werden? Das Problem kommt wohl eher daher, daß Sie die gesamte Psychologie nicht als Naturwissenschaft anerkennen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.01.2025 um 14.33 Uhr |
|
Immer wieder äußern sich Neurophysiologen zur Frage nach der Willensfreiheit. Weder „Wille“ noch „Freiheit“ sind naturwissenschaftliche Begriffe, darum sind solche Texte von vornherein verfehlt. Der neueste ist: „Ist das freiwillig?“ im Magazin „Max Planck Forschung“ (https://www.mpg.de/23933667/MPF_2024_4.pdf) (Libet wird erwähnt, aber er war nicht der erste mit solchen Versuchen und hat seinerseits Kornhuber anerkannt; ich will das nicht noch einmal ausbreiten.) Vgl. dagegen meinen brillanten Text: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587 samt anschließender Diskussion! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.01.2025 um 05.16 Uhr |
|
Jespersen teilt den Spracherwerb in drei Hauptphasen ein: Schreien, Babbeln, Sprechen; das Sprechen wiederum in kindliches und standardsprachliches. Das Schreien ist zunächst unwillkürlich, wird aber durch die Reaktion der Eltern intentional: „A child’s scream is not uttered primarily as a means of conveying anything to others, and so far is not properly to be called speech. But if from the child’s side a scream is not a way of telling anything, its elders may still read something in it and hurry to relieve the trouble. And if the child comes to remark—as it soon will—that whenever it cries someone comes and brings it something pleasant, if only company, it will not be long till it makes use of this instrument whenever it is uneasy or wants something. The scream, which was at first a reflex action, is now a voluntary action.“ (103) Das entspricht beinahe der behavioristischen Herleitung der Intentionalität. Es fehlt nur der Verzicht auf ein planvoll handelndes Subjekt, also hier das Kind als Agens, das einen Zusammenhang beobachtet und sein Verhalten danach einrichtet. (Was Jespersen anschließend empfiehlt – das Kind "brutally" schreien zu lassen, damit es sich nicht zum Tyrannen entwickelt –, entspricht nicht unbedingt der heutigen Auffassung.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 27.11.2024 um 23.08 Uhr |
|
Ja, woher will man’s wissen. Auch Nagel hält sich ja nicht allzu lange bei der Frage nach dem Wie auf, sondern kommt zu dem Schluß, daß das Wie nicht beantwortbar ist, daß es subjektiv und eine Sache der Perspektive ist. Es geht ihm also gar nicht um die Frage, wie es genau ist, sondern vor allem darum, daß es "irgendwie" ist. Dieses "irgendwie" sehe ich wie Prof. Ickler (s. #46096) als Platzhalter, aber es hat nur eine grammatische Funktion, ähnlich wie die drei unpersönlichen "es" in meinem vorigen Satz. Ich sehe "irgendwie" nicht als Leerstelle im Sinne einer Vorlage für eine noch zu vervollständigende Aussage, sondern die Aussage ist bereits vollständig: Ein Organismus hat nach Nagel genau dann Bewußtsein ("conscious experience", "conscious mental states"), wenn es irgendwie für ihn ist, dieser Organismus zu sein. Das heißt m. E., wenn er etwas fühlt. Ich halte das, wie gesagt, nicht für eine Erklärung des Bewußtseins bzw. von Empfindungen, Wahrnehmungen, Gefühlen, sondern nur für eine andere Formulierung. |
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 26.11.2024 um 23.12 Uhr |
|
Woher will man wissen, wie ein Hund so drauf ist? Man versteht es ja schon bei den Menschen kaum. Ich habe vorhin ein paar Sekunden auf den PC-Bildschirm gestarrt und dabei rein gar nichts empfunden. Auf holländisch sagt man »Verstand op nul, blik op oneindig«. Das war für mich nicht irgendwie. Es sei denn, man betrachtete ein Nicht-Irgendwie als Variante des Irgendwie. Aber wäre man dann nicht auf der Ebene von Sätzen wie »Nachts ist es kälter als draußen« angelangt? Irgendwie schon, oder?
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 26.11.2024 um 12.37 Uhr |
|
Allenfalls kann ich dieses "irgendwie für jemanden/ein Tier Sein" als einen anderen Ausdruck für Wahrnehmung, Empfindung, Bewußtheit verstehen. Es wird nicht gesagt, wie, sondern nur daß etwas ist, aber auch dieses Etwas bleibt unklar. Der Versuch, das Bewußtsein zu erklären, kommt damit leider nicht weiter. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.11.2024 um 09.36 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#46096 Noch einmal: „Es wäre absurd anzunehmen, daß es für einen Hund nicht irgendwie ist, an seinem Lieblingsknochen zu nagen.“ (Michael Tye in Thomas Metzinger, Hg.: Bewußtsein. Beiträge aus der Gegenwartsphilosophie. 2. Aufl. Paderborn u. a. 1996:108f.) Das kann man für eine unumstößliche Wahrheit oder für kompletten Unsinn halten – es macht keinen Unterschied, weil so oder so nichts daraus folgt. Und das ist die eigentliche Einsicht, gegen die die Philosophie des Geistes sich sperrt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.10.2024 um 11.45 Uhr |
|
Was ist der „semantische Gehalt eines mentalen Zustands“? Solche Wendungen kommen in neueren philosophischen Texten (hier von Geert Keil) ständig vor, werden aber nicht erklärt. Ich kann mir unter dem Gehalt eines Zustandes nichts vorstellen; es paßt schon rein sprachlich nicht. Unter „semantischem Gehalt“ verstehe ich normalerweise die Bedeutung. Ich weiß, daß es im Zitat um die „Bezüglichkeit“ oder „Gerichtetheit“ („Intentionalität“ im phänomenologischen Sinn) geht, aber gerade das ist das Problem: Wie kann sich ein Zustand auf etwas richten? Die Phänomenologen antworten: Das kann er tatsächlich nicht – mit Ausnahme der „mentalen Zustände“ oder „psychischen Phänomene“, die sind eben einzigartig, mit nichts vergleichbar. Das Ganze ist ein Mysterium, man kann es nicht erklären, sondern Brentanos Mantra nur wiederholen – wie es denn auch bis heute geschieht.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.10.2024 um 05.01 Uhr |
|
Zweimal Clifford Geertz: „Der Kulturbegriff, den ich verwende, [...] bezeichnet ein historisch überliefertes System von Bedeutungen, die in symbolischer Gestalt auftreten, ein System überkommener Vorstellungen, die sich in symbolischen Formen ausdrücken, ein System, mit dessen Hilfe die Menschen ihr Wissen vom Leben und ihre Einstellungen zum Leben mitteilen, erhalten und weiterentwickeln.“ „Eine Religion ist ein Symbolsystem, das darauf zielt, starke, umfassende und dauerhafte Stimmungen und Motivationen in den Menschen zu schaffen, indem es Vorstellungen einer allgemeinen Seinsordnung formuliert und diese Vorstellungen mit einer solchen Aura von Faktizität umgibt, daß die Stimmungen und Motivationen völlig der Wirklichkeit zu entsprechen scheinen.“ Beide Definitionen machen Gebrauch von alltagspsychologischen Begriffen – man könnte sagen: von eben den „überkommenen Vorstellungen“, die Geertz untersuchen will („from the native’ s point of view“, mit Malinowski, den Geertz in einem so betitelten Aufsatz kritisiert). Übrigens müßte die vermutete Systemhaftigkeit, die hier schon in die Definitionen aufgenommen ist, erst durch die Forschung festgestellt werden. Das entspricht der Vorwegnahme in der beliebten Definition der Sprache als Zeichensystem. Tatsächlich will Geertz ja Kultur und Religion „als Texte lesen“. Sein Symbolbegriff ist nicht sehr genau definiert, entspricht aber ungefähr dem Begriff des Zeichens, weshalb der ganze Ansatz der verstehenden Kulturanthropologie auch „semiotisch“ heißt. „Geertz zufolge muss man nicht denken, fühlen und wahrnehmen wie ein Einheimischer, um zu wissen, wie Einheimische denken, fühlen und wahrnehmen; man muss – mit anderenWorten – kein Eingeborener sein, um über Eingeborene Bescheid zu wissen. Es ist gar nicht notwendig, ihre Auffassungen zu teilen und ihre Überzeugungen zu übernehmen, um sie in Erfahrung zu bringen. Man muss – bezogen auf das genannte ethnographische Fallbeispiel – kein Hahnenkämpfer werden, um einen balinesischen Hahnenkämpfer zu verstehen, ja, man muss Hahnenkämpfe noch nicht einmal gut finden, um nachzuvollziehen, was sie für die Balinesen bedeuten. Geertz sucht demnach weder eine geistige Korrespondenz noch eine mystische Kommunion mit den Einheimischen, sondern beschränkt sich darauf, ihr Selbstverständnis in Erfahrung bringen zu wollen: ,Es geht vielmehr darum herauszufinden, wie sie sich überhaupt selber verstehen.“ (Volker Gottowik: „Clifford Geertz und der Verstehensbegriff der interpretativen Anthropologie“. In Hans-Martin Gerlach/Andreas Hüting/Oliver Immel, Hg.: Symbol, Existenz, Lebenswelt. Kulturphilosophische Zugänge zur Interkulturalität. Frankfurt 2004:154-167.) Aber was heißt „sich selber verstehen“? Menschen kommentieren (sei es auch erst auf Befragen) ihr eigenes Verhalten, aber solche Kommentare sind für den Beobachter Material wie das kommentierte Verhalten selbst, und kein theoretischer Beitrag dazu. Soziologen und Ethnologen verstehen zwar ebenso wie Sprachwissenschaftler die Sprache ihrer Objekte, aber das ist nur ein Notbehelf angesichts der enormen Komplexität und Historizität des Gegenstandes und ändert nichts am Objektivitätsziel der Verhaltensanalyse. Geertz schließt sich ausdrücklich der deutschen hermeneutischen Tradition an, ohne deren dogmatische Ausrichtung (theologisch bei Bultmann, kunstreligiös bei Gadamer) zu übernehmen. Diese Trennung von „Bedeutung“ und „Geltung“ scheint Gottowik ihm vorzuwerfen: „Wie dagegen die zunächst voneinander getrennten Bedeutungs- und Geltungsfragen wieder zusammengeführt werden können, um sich der Herausforderung anderer Lebensformen und Weltbilder in einem radikalen Sinne zu stellen ist methodologisch und erkenntnistheoretisch bislang ungeklärt. Unter diesem Gesichtspunkt bleibt die interkulturelle Hermeneutik ein Desiderat.“ (S. 167) Aber woher kommt die „Herausforderung“? Das scheint so willkürlich wie der von Gadamer verfochtene „Geltungsanspruch“, die „Verbindlichkeit“. Die kritisierte stärkere Anlehnung an Max Weber betrachte ich gerade als Fortschritt. Am „hermeneutischen Zirkel“ hält er fest und schließt sich ausdrücklich Dilthey an. Der Ethnologe will die Einheimischen besser verstehen, als sie sich selbst verstehen – das ist allerdings das traditionelle Ziel aller Soziologie, sonst braucht sie gar nicht erst anzutreten. Geertz’ theoretische Texte wären verständlicher, wenn die Sprachwissenschaft sich gründlicher mit der Position des Mithörers befaßt hätte. Wenn wir versuchen, zum Beispiel das Oktoberfest oder die immer noch weit verbreitete Konfirmation zu verstehen, können wir die Teilnehmer befragen und ihr ganzes übriges Verhalten einbeziehen, aber ohne die Geschichte wird es Stückwerk bleiben. Die Begründung des hermeneutischen Vorgehens stützt sich bekanntlich gleich in der programmatischen Schrift über „dichte Beschreibung“ auf den Schöpfer dieses Begriffs, Gilbert Ryle, und teilt dessen falsches Bild von einem Behaviorismus, der angeblich nur die Form des Verhaltens und nicht die Bedeutung erfassen könne. Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#54009 |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.10.2024 um 04.22 Uhr |
|
Der intentionale "Blickstrahl" des Phänomenologen zielt nicht mehr auf die als seiend aufgefaßten Gegenstände, sondern auf die Gegenstände im Wie ihres unthematischen Erscheinens und auf die Einbettung dieses Erscheinens ins Horizontbewußtsein. Der Blickstrahl ist so zurückgebogen auf das Subjektive des Vollzugs der Gegebenheitsweisen und des horizonthaften Verweisungsbewußtseins. Kurz: die phänomenologische Analyse hat den Charakter der Reflexion. (Klaus Held in Edmund Husserl: Die phänomenologische Methode. Ausgewählte Texte I. Hg. von Klaus Held. Stuttgart 1990:35) Fasse ich die Blätter auf dem Waldweg als seiend auf, wie es meiner naiven vortheoretischen Einstellung entsprechen soll? Schwer zu sagen, weil ich mich nicht erinnern kann, sie überhaupt irgendwie „aufzufassen“. Ich sehe mich ein wenig vor, auf dem feuchten Herbstlaub nicht auszurutschen, aber sonst? Husserl will meine angebliche vortheoretische Einstellung doch wieder theoretisieren, indem er sie satzförmig ausdrückt. Auch Tiere hätten dann diese Einstellung zu ihrer Umgebung. Die Behauptungen über das Bewußtsein des Unbeachteten und das Horizontbewußtsein sind bloße Appelle – man kann zustimmen oder auch nicht. Ich soll außerdem so tun, als „erscheine“ mir das Herbstlaub irgendwie, je nach der „Einstellung“, für die ich mich entscheide. Dazu dienen die yogaähnlichen Operationen der „Reduktion“, eine gedankliche Entwirklichung. Alles extrem plausibel und extrem sinnlos. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.10.2024 um 04.47 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#53907 Ryle bespricht 1968 den Unterschied zwischen einer willkürlichen und einer unwillkürlichen Bewegung, z. B. einem Lidschluß mit und ohne Absicht (wink vs. twitch), und kommt so zu seinem Begriff der „dichten Beschreibung“, die Clifford Geertz wenige Jahre später (1975) aufgreifen und weltbekannt machen sollte. Aus behavioristischer Sicht besteht der Unterschied nicht in inneren Zuständen, sondern in der Einbeziehung der Umstände und der Konditionierungsgeschichte, also der „Kontingenzen“, in die ein „topographisch“ gleiches Verhalten eingebettet ist. (Das sind die beiden hier einschlägigen Begriffe der Verhaltensanalyse.) Im vorigen Eintrag zum Thema hatte ich den Wiederabdruck von Ryles Aufsatz zitiert, aber wegen Geertz und der Chronologie will ich das hier zurechtrücken. Geertz finde ich übrigens sehr problematisch, aber das würde hier zu weit führen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.09.2024 um 05.45 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#43111 Warum die Einstellungen zu Propositionen ebenfalls die „Form“ von Propositionen (also Sätzen) haben sollen, fragt man wohl besser nicht. Auch ist ein Glaube, ein Wunsch nicht dasselbe wie dessen Beschreibung. Es wäre allerdings vergeblich, Licht in dieses Dunkel zu bringen. Die Philosophen spielen sich die Bälle zu wie seit je. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.09.2024 um 04.39 Uhr |
|
Die Inkommensurabilität der verschiedenen Psychologien ist ein Hauptthema der „Ethnopsychologie“. Der Psychologe Kurt Danziger berichtet über Schwierigkeiten der Verständigung mit Kollegen während einer Gastprofessur in Indonesien, weil schon über den Gegenstand der Psychologie und ihre Grundbegriffe („Motivation“, „Intelligenz“) im indo-chinesischen Kulturkreis Vorstellungen herrschen, die mit den westlichen unvereinbar und unvergleichbar sind. Zwischen kulturräumlicher und historischer Distanz besteht methodisch kein Unterschied. So stellen sich auch einer modernen Übersetzung von Aristoteles’ „Über die Seele“ unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen, obwohl von der griechischen Philosophie eine ununterbrochene Überlieferungskette bis zur heutigen akademischen Psychologie reicht. Man hat oft bemerkt, daß sich der scharfe Dualismus der cartesianischen Tradition bei Aristoteles noch nicht (und der platonische Dualismus nicht mehr) findet. Bei ihm ist Psyche beinahe ein Synonym für Leben oder Belebtheit, darum haben auch Pflanzen eine Seele. Zur Ernährung und Fortpflanzung kommen bei Tieren Empfindung und Bewegung, beim Menschen das Denken (die Sprache) hinzu. (Vgl. Richard Sorabji: „Body and soul in Aristotle“. Philosophy 49/1974:63-89; dort auch über die Schwierigkeit, antike Seelenmodelle auf moderne abzubilden.) Keinesfalls darf Psyche mit Geist oder mind übersetzt werden, weil dies die Funktion der Seele zu sehr auf intellektuelle Fähigkeiten einengen würde. Der Seelenbegriff des Biologen Aristoteles hat also nichts mit Descartes’ res cogitans zu tun und ist nicht durch logisches Räsonieren oder Meditieren gewonnen, sondern durch Beobachtung der lebenden Organismen. Die würden nicht existieren, wenn sie nicht auf das Leben hin angelegt wären; es ist ihre „Entelechie“ – ein Begriff, der heute bis zu einem gewissen Grad in Evolutionsbegriffen rekonstruiert werden kann. Ein menschlicher Leichnam z. B. kann nach Aristoteles nur „homonym“ noch als Mensch bezeichnet werden; er hat mit dem Leben sein definitionsgemäßes Wesen eingebüßt. Ebenso sind die Hände eines Leichnams so wenig Hände im eigentlichen Sinn wie die einer Statue.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.09.2024 um 04.37 Uhr |
|
Die Lehre von der Intentionalität im Sinne von Gerichtetheit ist einerseits – als Ausdeutung transitiver Verben – sprachverführt, andererseits verstößt sie immer wieder gegen die sprachlichen Konventionen. Zustände können nicht „gerichtet“ sein – das ist keine Tatsachenfrage, sondern eine begriffliche Unmöglichkeit. John Searle behauptet trotzdem: „Wir können einen Geisteszustand auf einen anderen richten...“ (Die Wiederentdeckung des Geistes. München 1993:1365) Hier kommt noch die Schwierigkeit hinzu, daß „wir“ – offenbar als Personen – die Akteure sein sollen. Wie richtet man einen Zustand? Die Psychologen Volker Gadenne und Margit E. Oswald behaupten sogar, jeder mentale Zustand könne auf sich selbst und ein Hintergrundzustand könne auf einen Vordergrundzustand gerichtet sein (Kognition und Bewußtsein. Berlin u. a. 1991:23f.). Auch daß Zustände einen „Inhalt“ haben können, wird dem Leser zugemutet, ohne daß die Metapher, falls es eine sein soll, je eingelöst würde: „Bewußtseinszustände haben immer einen Inhalt“ (ebd. 103; vgl. auch die schon zitierten „content-full mental states“). Zustände haben nach den Regeln der deutschen Sprache weder einen Inhalt noch eine Richtung. Die sprachliche Abweichung wird, soweit ich sehe, niemals gerechtfertigt, der Leser vielmehr mit einer sinnlosen Wortkombination allein gelassen, und dies durch die gesamte einschlägige Literatur zur "Philosophie des Geistes" und leider auch in der Sprachwissenschaft - letztlich ein Erbe der phänomenologischen Verirrung (Brentanos und Husserls).
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.09.2024 um 04.50 Uhr |
|
Dem Behavioristen wird unterstellt, er könne nicht erklären, warum wir uns gegen einen Fremden wehren, der uns eine Nadel in den Oberarm stößt, nicht aber gegen den Arzt, der das gleiche mit seiner Impfnadel tut. Formal gleiche Ereignisse (mit gleicher „Topographie“, wie Skinner sagt) sollten die gleiche natürliche oder konditionierte Reaktion hervorrufen (Wes Sharrock/Jeff Coulter in Ivan Leudar/Alan Costall, Hg.: Against theory of mind. London 2009:67f.). Das gleiche Mißverständnis zeigt sich sogar bei Ryle: „We ask the Behaviourist, ‘what is the difference between sloping arms in obedience to an order and just sloping arms?’ The Behaviourist peers and listens and finds no behavioural difference, so he plays the Reductionist trick. He says, ‘Obeying the order to slope arms is Nothing but sloping arms. There isn’t something else that the soldier does as well.’ So there is no such thing as obeying or disobeying – which is rubbish. (Gilbert Ryle: On Thinking. Oxford 1979:18) Das ist aber niemals die behavioristische Sicht gewesen. Die ärztliche Maßnahme geht mit weiteren Daten einher, die den Patienten zum Stillhalten veranlassen. Kinder müssen lernen, ihr Verhalten durch Reize von größerem „Format“ steuern zu lassen. Der Hund, dem man versehentlich auf die Pfote tritt, leitet daraus keine ewige Feindschaft ab; er unterscheidet sehr wohl zwischen absichtlichen und unabsichtlichen aversiven Reizen („Schmerz“), und dazu braucht er kein Gedankenlesen und keine „Theorie des Geistes“ (Premack). Die Daten sind vollständig gegeben und beobachtbar. Der Zirkuslöwe springt durch den brennenden Reifen; niemand unterstellt ihm eine Theorie des Geistes, weil der gesamte Hergang der Dressur bekannt ist. Umgangssprachlich gesagt: Erziehung besteht darin, uns zu etwas zu veranlassen, was wir eigentlich nicht wollen, in einem umfassenderen Zusammenhang aber doch wollen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 14.09.2024 um 22.38 Uhr |
|
"Statt einfach etwas zu tun, kann ein Mensch sagen, was er tun wird." (Haupteintrag) Natürlich kann er das. Aber er muß sein Wollen nicht ankündigen, er kann es auch einfach tun. Hat er es dann nicht gewollt? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.08.2024 um 07.01 Uhr |
|
Auch die sonderbarsten Gestalten der Fantasy-Literatur und -Filmerei sind viel zu menschenähnlich. Man könnte sich einen Multimedia-Film aus der Perspektive eines Hundes vorstellen, mit sehr interessanten Spuren von Pisse und Kacke anstelle von Zeitung und Fernsehen. So ein „Uexküllsches“ Drama würde uns immerhin veranschaulichen, wie fremd Aliens uns wirklich sein dürften. Eine nachfühlbare Handlung käme aber wohl nicht zustande.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.06.2024 um 04.22 Uhr |
|
„Unter Handlungen werden Segmente menschlichen (oder natürlich auch tierischen) Verhaltens verstanden, die auf ein bestimmtes Ziel hin organisiert sind und zu dessen Verwirklichung beitragen. (...) Handlungen sind also bestimmte Ausschnitte aus dem fortlaufenden Verhalten der Lebewesen – dem sogenannten Verhaltensstrom –, und sie sind ausgeschnitten und zusammengebunden nach dem Kriterium des gemeinsamen Ziels.“ (Jochen Müsseler/Gisa AschersIeben/Wolfgang Prinz in Gerhard Roth/Wolfgang Prinz, Hg.: Kopf-Arbeit. Gehirnfunktionen und kognitive Leistungen. Heidelberg u. a. 1996:309; korrigiert) Handeln wird also als Problemlösen definiert. Da es in der Natur, wenn man sich nicht mit anthropomorphisierenden Metaphern begnügen will, keine Ziele und keine Probleme gibt, sind solche Darstellungen in neurologisch orientierten Werken nicht interpretierbar. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.03.2024 um 05.45 Uhr |
|
Meinen ist ein Vorschlagen: Ich meine x = Ich schlage vor, daß wir unser (Sprach)verhalten von x steuern lassen (direkt oder innersprachlich vermittelt). Es ist also auf das Handlungsschema bezogen. Tiere können darum nichts meinen. Sie können ja auch nichts wollen. Skinner gibt den Interpretationsrahmen: „Einige Autoklitika zeigen dem Hörer an, daß der Sprecher etwas sagen will, was dieselbe Funktion hat wie etwas zuvor Gesagtes (das heißt, mit anderen Worten, ich meine ...) Ein anderes übliches Autoklitikum zeigt an, daß die folgende Äußerung ein Sonderfall von etwas zuvor Gesagtem ist (zum Beispiel).“ (Verbal behavior 318)
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.01.2024 um 06.54 Uhr |
|
Searle und andere haben versucht, der offensichtlichen Absurdität von „gerichteten Zuständen“ durch die Paraphrase „Erfüllungsbedingungen von Zuständen“ zu entgehen. Es ist aber ebenso unverständlich, und wenn man das Ausweichmanöver durchschaut hat, wird man sich nicht weiter damit beschäftigen. Es ist immer die gleiche mentalistische Philosophie aus den Zeiten vor der behavioristischen Aufklärung. Der sophistische Trugschluß geht ungefähr so: 1. Man kann seine Aufmerksamkeit auf etwas richten. 2. Aufmerksamkeit ist ein Zustand. 3. Zustände können auf etwas gerichtet sein. Oder so: 1. Es gibt Bücher über die Französische Revolution. 2. Bücher sind Gegenstände. 3. Es gibt Gegenstände über etwas. (Dennett: Things about things) Wie dumm ist das denn? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.01.2024 um 05.39 Uhr |
|
Ich begrüße die zweijährige Enkelin an der Haustür. Sie späht in den Hausflur und sagt Oma. Diese sprachliche Reaktion kann nicht durch die – nicht anwesende – Oma ausgelöst sein, aber das ist aus behavioristischer Sicht kein Problem: „Nehmen wir an, daß ein Kind daran gewöhnt ist, auf dem Frühstückstisch eine Orange zu sehen. Fehlt die Orange eines Morgens, sagt das Kind schnell Orange. (...) Wieso konnte die Reaktion erfolgen, obwohl gar keine Orange als Reiz gewirkt hat? (...) Die Reaktion wird durch den Frühstückstisch mit allen seinen vertrauten Eigenschaften und durch andere zur Tageszeit passende Reize ausgelöst. Zu diesen Reizen gehörten oftmals Orangen, und die Reaktion Orange ist in ihrer Anwesenheit verstärkt worden.“ (Skinner: Verbal behavior S. 101; schon im Haupteintrag) So wird es auch von den Erwachsenen intuitiv verstanden. Umgekehrt ist die Anwesenheit der Oma kein Grund für das Kind, ununterbrochen Oma zu sagen (Chomskys törichter Einwand). Das ist alles sehr einfach, fast primitiv, aber so muß man anfangen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.01.2024 um 05.33 Uhr |
|
Die Erfindung des Rades (als Transportmittel, nicht als Rolle) setzt etwas anderes voraus, was es in der Natur nicht gibt: Straßen oder Bahnen, auf denen man mit einem Wagen besser vorankommt als auf seinen vier Beinen. Der Bau von Straßen hat jedoch aus biologischer Sicht etwas Paradoxes: Straßen kommen auch dem Rivalen oder Feind zugute, der ihre Vorteile nutzt, ohne Zeit und Energie für ihren Bau aufzuwenden. Er kann sich unterdessen mehr der Fortpflanzung widmen und würde daher den ungewollt „altruistischen“ Straßenbauer bald ausgerottet haben. (Richard Dawkins: The ancestor’s tale. London 2004:546f.; das Kapitel gilt eigentlich dem einzigen natürlichen Vorkommen frei rotierender Räder bei einzelligen Flagellaten. – Spinnen, die sich kugelig zusammenziehen und davonrollen, sowie die Pillendreher unter den Käfern kommen für die Naturgeschichte des Rades nicht in Betracht. Bei größeren Tieren als den Bakterien ist ein Rad als Körperteil wegen der Versorgungsleitungen nicht möglich.) Es bedarf einer hochentwickelten Sozialstruktur, um Pläne, Verhandlungen und schließlich die Verwirklichung von solchen altruistischen Neuerungen zu ermöglichen, die erst durch ihren Nutzen für die Gruppe auch dem einzelnen nützen. Ohne Deliberationsdialog, also Sprache, ist das nicht denkbar. Das gilt selbst für die Despotien, aus denen die großen Gemeinschaftsprojekte stammen, deren Reste (Straßen, Pyramiden, Befestigungsanlagen) wir noch sehen. Alles Nachhaltige muß geplant werden, oder es bleibt starren Erbkoordinationen überlassen wie die Vorratshaltung der Bienen, Eichhörnchen usw., die „nicht wissen, was sie tun“. Hierher gehören auch Tiere, die sich für andere (d. h. für ihre eigenen Gene in anderen Organismen) „opfern“. Wie man oft gesagt hat, muß die Diskussion über „Egoismus“ und „Altruismus“ in der Natur zunächst in biologische Begriffe überführt werden, wenn sie zu brauchbaren Erkenntnissen führen soll. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.12.2023 um 06.19 Uhr |
|
„For obviously what we want is to understand how such nonphysical things as purposes, deliberations, plans, decisions, theories, intentions, and values, can play a part in bringing about physical changes in the physical world.“ (Karl Popper: Of clouds and clocks. St. Louis 1966:15) Wenn man die Herkunft solcher Redeweisen aufdeckt, verschwinden die „nonphysical things“, und zurück bleibt – eben die Redeweise. Das bedeutet nicht, daß Menschen sich nicht wirklich entscheiden, etwas wollen usw. Am ehesten kann man sich wohl darauf verständigen, daß Absichten und Werte keine Gegenstände sind, pace N. Hartmann usw. Aber noch immer gibt es Psychologen und Philosophen, die von der „Absicht I“ sprechen (für „Intention“). Das Popper-Zitat bespricht Skinner in „Beyond freedom and dignity“ (der Titel ist natürlich eine Anspielung auf Nietzsche und Freud). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.12.2023 um 07.09 Uhr |
|
Das Aneinandervorbeireden ist eigentlich der Normalzustand. Philosophen reden sowieso ausnahmslos aneinander vorbei. Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1531#30285. Eine scheinbare Ausnahme bilden die Nachplapperer, aber Nachplappern ist auch eine Art Mißverständnis. Ist das nun ein Trost oder ein Grund zur Verzweiflung? (Wenn ich zur Zeit wieder mal so tief in Skinners Schriften versunken bin, will ich auch nachtragen, daß der große Mann und überaus klare Schriftsteller ganz durchdrungen war von dem Eindruck, daß keiner den anderen versteht. Während die Philosophiehistoriker mühsam herauszufinden versuchen, wo und wie Herr X Herrn Y mißverstanden hat, ist das bei der eigenen Lehre jedem ganz klar: Niemand versteht mich! Nicht einmal meine treuesten Schüler! "Koestler, Lorenz and their ilk" (Skinner) waren doch keine dummen Menschen, aber für Skinner zum Haareraufen, was ihr Bild vom Behaviorismus angeht. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 01.12.2023 um 06.16 Uhr |
|
Danke, daß Sie das noch mal so versöhnlich formuliert haben, Herr Wrase! Ich hoffe auch, daß Herr Ickler mit seinen Beiträgen im Forum so weitermacht. Ich werde nun auch nicht dickköpfig sein und hier gar nichts mehr zum Thema Behaviorismus/Philosophie sagen, sondern nur öfters Unnötiges weglassen oder gern auch mal von dem E-Mail-Angebot Gebrauch machen. Übrigens täuscht es, wenn es so aussieht, als hätte ich grundsätzlich etwas auszusetzen. Aber da, wo mir die Theorie einleuchtet, lohnt sich halt für mich keine Gegenrede. Ich habe in diesem Forum schon unendlich viel gelernt. Sollte es mir z.B. eher peinlich sein oder kann ich sogar stolz darauf sein, daß ich bis vor kurzem (vor Herrn Schaefers Hinweis http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=783#52072) den Unterschied von Straf- und Zivilrecht noch gar nicht kannte? Immerhin weiß ich es dank der Diskussion jetzt. |
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 01.12.2023 um 05.49 Uhr |
|
Was mir noch einfiel: Ob das nun ein versteckter Hinweis war oder nicht, man könnte natürlich die einfachste Lösung darin sehen, daß ich die Beiträge von Herr Riemer beim Lesen übergehe. Vielleicht würden das andere so machen, aber mir würde das gegen den Strich gehen. Ich möchte eigentlich alles lesen, was Sie uns mitteilen, und wenn es Antworten sind, dann sollte ich zuvor den jeweiligen Bezugsbeitrag lesen, jedenfalls empfinde ich das so. Herr Riemer hat jetzt nicht nur von meiner, sondern auch von Ihrer Seite die Rückmeldung bekommen, daß es da wohl ein Zuviel gab. Ich würde jetzt abwarten, was sich daraus ergibt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.12.2023 um 05.23 Uhr |
|
Schon recht, ich werde aber weiterhin hier meinen logorrhöischen Anfällen freien Lauf lassen und immer wieder mal neue Gesichtspunkte oder interessante Fundstücke zum besten geben.
|
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 01.12.2023 um 04.16 Uhr |
|
Vielen Dank für die freundlichen Rückmeldungen, die mein miesepetriger Beitrag eigentlich nicht verdient hat. Also wenn ich mir nun vorstelle, daß Sie, Herr Ickler und Herr Riemer, zu zweit per E-Mail diskutieren werden statt an dieser Stelle, würde das bedeuten, daß nur noch Herr Riemer die Beiträge von Herrn Ickler, dann als E-Mails, lesen würde. Dann hätten Sie, lieber Herr Ickler, viel weniger Leser bei derselben Mühe. Und es gibt ja Leute, die lesen wollen, was Sie zu sagen haben, Sie haben selbst im letzten Beitrag darauf verwiesen. Ich kann es bestätigen, ich bin ja einer von diesen Interessierten. Somit bin ich nicht wirklich glücklich mit Ihrem rücksichtsvollen Vorschlag. Übrigens hatte ich auch schon gedacht, worauf Herr Riemer mit Recht hinweist: Gerade in Antworten auf Gegenreden werden die Standpunkte klarer, insofern hatte und hat sein Widerspruch etwas Gutes. Wie schon gesagt, stört mich der kontroverse Austausch wegen der großen Zahl der entsprechenden Beiträge. Auf Dauer steckt mir da zu viel Wiederholung drin. Weil es standardmäßig zwischen Ihnen keine Einigung gibt, wächst der unangenehme Eindruck des Aneinandervorbeiredens. Deshalb dachte ich, eine Reduzierung sei die einfachste Lösung. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.11.2023 um 12.16 Uhr |
|
Ich bin ja gewissermaßen selbst schuld, wenn ich hier immer wieder jenen Kampf der Götter und Titanen (Empiristen und Mentalisten) aufgreife, an dem sich nur wenige beteiligen wollen. Allerdings weiß ich aus persönlichen Zuschriften, daß manche Menschen sich für meine Ansichten interessieren, ohne sich öffentlich dazu äußern zu wollen.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 30.11.2023 um 08.21 Uhr |
|
Ja, ich verstehe Herrn Wrase auch, hatte ähnliches auch schon befürchtet. Ich bin andererseits davon ausgegangen, daß Diskussion, gerade auch kontrovers, wenn es sich so ergibt, erwünscht ist, aber zu bestimmten Themen von Prof. Ickler hat leider außer mir kaum jemand mal Interesse geäußert. Ich setze nochmal meine E-Mail-Adresse hier ein, nehme gern auch persönliche Kritik an. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.11.2023 um 05.34 Uhr |
|
Liebe Freunde, ich verstehe den Unwillen von Herrn Wrase und kann ihm schwerlich raten, diesen Teil unserer Diskussion, der ja wirklich nicht zu einer Einigung oder auch nur Verständigung führen kann, einfach zu überblättern. Darum schlage ich vor, daß Sie, lieber Herr Riemer, und ich unsere philosophische Diskussion (wieder) in unseren E-Mail-Kontakt verlegen. Das würde es mir auch ersparen, mich im Tagebuch unermüdlich zu wiederholen. Ich habe zwar die Gelegenheit genutzt, um meinen radikal naturalistischen Standpunkt zu klären, aber genug ist genug, da haben Sie recht, lieber Herr Wrase.
|
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 29.11.2023 um 22.25 Uhr |
|
Hallo Herr Riemer, ehrlich gesagt stört mich auf Dauer die Unzahl der Beiträge in dieser und in anderen Abteilungen der Diskussion, in denen Sie wieder und wieder und wieder und wieder, fast wie ein Automat, Herrn Ickler widersprechen. Aus meiner Sicht ist das Tagebuch in erster Linie dazu da, daß wir anderen die Gedanken von Herrn Ickler kennenlernen und von ihnen profitieren können. Ich hätte nichts dagegen, wenn Sie sehr viel weniger Beiträge der genannten Art schreiben würden. Die Abneigung gegen die Masse Ihrer Beiträge hängt damit zusammen, daß ich sehr oft den Eindruck habe, daß Sie nicht verstehen, was Herr Ickler sagen möchte, oder aber Sie verstehen etwas, wollen aber auch dann widersprechen, weil seine Auffassung nicht mit Ihrer eigenen Gedankenwelt übereinstimmt. Es ist unangenehm, permanent ein Aneinandervorbeireden der einen oder anderen Art mitzuerleben. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.11.2023 um 15.09 Uhr |
|
Vielleicht bin ich bzgl. Einheit und Gegensatz von Inhalt und Form vor allem von der Hegelschen Dialektik beeinflußt. Ich fand diese Erklärung des Materiebegriffs immer recht einleuchtend. Ansonsten habe ich nicht nachgeforscht, ob es ähnliche Formulierungen gibt und von wem sie ggf. sind. Den Ausdruck "reale Existenz" finde ich zugegeben auch ein bißchen doppelt gemoppelt. Aber bei Ideen wird halt auch sehr oft bildhaft von Existenz gesprochen, z. B. sagt man, daß zwischen zwei benachbarten geraden ganzen Zahlen immer genau eine ungerade "existiert" usw. Um die eigentliche von der bildhaften Existenz zu unterscheiden, verwende ich eben notfalls den Zusatz real. Und dann gibt es eben auch innerhalb der Realität noch den Unterschied, daß man sich an einigen Dingen, den materiellen, stofflichen, richtig den Kopf stoßen kann, während andere, z. B. die Rotationsachse, Äquator, die Pole, Umlaufbahnen, Massenschwerpunkte von Planeten, die zwar genauso real, unabhängig vom Beobachter (um jetzt mal das Wort Bewußtsein zu vermeiden) vorhanden, jedoch nicht greifbar sind. Sie haben nur einen konkreten Ort, keinen Inhalt. Daraus ergeben sich für mich die beiden verschiedenen realen Existenzarten: inhaltsgebunden (oder inhaltsbezogen, -basiert, -basierend?) real und formgebunden (-bezogen, ...) real. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.11.2023 um 12.06 Uhr |
|
"Formgebundene reale Existenz" scheint aus einer bestimmten Philosophie zu stammen? Zunächst verstehe ich es erst mal nicht, vor allem die "Formgebundenheit", trotz des Anklanges an Aristoteles. To be assumed as an entity is, purely and simply, to be reckoned as the value of a variable. In terms of the categories of traditional grammar, this amounts roughly to saying that to be is to be in the range of reference of a pronoun. (Quine) Pronomina sind deiktisch. Also ist das Verweisen oder Zeigen die letzte Ressource. Zeigen gibt es nur im Bestandssystem von Sprecher und Hörer. Das nennt man auch "die Welt". |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.11.2023 um 09.48 Uhr |
|
Ich sehe im ersten Fall kein Beispiel materieller Existenz. Ein (weiterer) Planet ist ein Universalium, der Erdmittelpunkt ist ebenfalls nicht materiell, sondern gehört zum Kontext der formgebundenen realen Existenz (funktionelle Konstrukte nennen Sie es wohl). Ein materielles Beispiel wäre: Untersuchen wir, ob es die Erde/den Mt. Everest gibt. Wobei Sie das, wenn ich den Sinn der Beispiele richtig verstehe, wohl mit * schreiben würden? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.11.2023 um 04.32 Uhr |
|
Der irrigste und schädlichste Text der Philosophiegeschichte ist wohl jener locus classicus, den ich im Haupteintrag schon zitiert habe und den Franz Brentano in aller Unschuld (Naivität) formulierte: „Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisiert, was die Scholastiker des Mittelalters die intentionale (auch wohl mentale) Inexistenz des Gegenstandes genannt haben, und was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt (worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist), oder die immanente Gegenständlichkeit nennen würden. Jedes enthält etwas als Objekt in sich, obwohl nicht jedes in gleicher Weise. In der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urteil etwas erkannt oder verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehaßt, in dem Begehren begehrt usw. Diese intentionale Inexistenz ist den psychischen Phänomenen ausschließlich eigentümlich. Kein physisches Phänomen zeigt etwas Ähnliches. Und somit können wir die psychischen Phänomene definieren, indem wir sagen, sie seien solche Phänomene, welche intentional einen Gegenstand in sich enthalten.“ (Franz Brentano: Psychologie vom empirischen Standpunkt. Leipzig 1924:24, zuerst 1874) Man sieht überdeutlich, wie eine ganze Welt von Pseudogegenständen aus der Sprache herausgesponnen wird. Dann kam der verhängnisvolle Husserl und verhexte (Wittgenstein) die Menschen noch weiter. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.11.2023 um 03.57 Uhr |
|
Das sind wieder viele Themen, ich will aber nur kurz noch einmal verdeutlichen, was ich meine: Untersuchen wir, ob es einen weiteren Planeten gibt! *Untersuchen wir, ob die Erde einen Mittelpunkt hat/ob ein Dreieck drei Seitenhalbierende hat! Untersuchen wir, ob X und Y verheiratet sind! *Untersuchen wir, ob es die Ehe gibt! (Zum ersten Fall habe ich absichtlich die Erde und das Dreieck untergebracht, um zu zeigen, daß es auf den Gegensatz materiell/ideell nicht ankommt.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 27.11.2023 um 18.59 Uhr |
|
Sie bringen hier wie auch schon in #52288 ein subjektives und historisches Moment ein, welches m. E. nichts mit Existenz zu tun hat. Die Existenz eines Planeten oder eines Pols hängt nicht davon ab, wie wir ihn von vornherein oder im nachhinein bezeichnen, ob wir ihn betrachten oder noch näher betrachten, nicht davon, ob wir uns irgendwann oder von Anfang an darüber geirrt haben, nicht von einer Sprachanalyse, nicht von Vermutungen und Hypothesen. Die Gegenstände existieren, oder sie existieren nicht, völlig unabhängig von uns als Betrachter! Ich halte das für eine Selbstverständlichkeit für einen Naturwissenschaftler. Einen Kategorienfehler begeht man NICHT [!], indem man z. B. für den Planeten Erde, einen Pol, ein Einhorn, eine Universalie oder eine Zahl irgendeine Bezeichnung wählt und sagt, daß sie (jeweils für sich) entweder existiert oder nicht existiert, und zwar jeder Gegenstand innerhalb seiner Kategorie, seinem Kontext, seiner Ebene. Einen Kategorienfehler begeht man, wenn man Gegenstände verschiedener Kategorien/Kontexte/Ebenen miteinander vergleicht und z. B. sagt oder stillschweigend unterstellt, sie existierten beide auf die gleiche Weise, d. h. im gleichen Kontext. In der Umgangssprache wie auch in den Fachsprachen macht die gleiche Bezeichnung als "Existenz" überhaupt keine Probleme, darum ist sie auch überall so präsent. Sie wird erst dann zum Problem, wenn es ins Philosophische geht und man dann nicht zwischen den Kategorien/Kontexten/Ebenen unterscheidet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.11.2023 um 14.02 Uhr |
|
So pessimistisch bin ich da nicht. Es gibt eben Ausdrücke, die wie Bezeichungen von etwas ("Gegenständen") aussehen, bei näherer Betrachtung aber keine sind. Aber nicht weil die Gegenstände nicht existieren (wie die Einhörner), sondern weil es von Anfang verfehlt war, darin überhaupt Gegenstandsbezeichungen zu sehen. Das war ein "Kategorienfehler", wie Ryle es nannte, ein Irrtum semiotischer Art. Wir Nominalisten sehen viele solcher Kategorienfehler, die dann auch zur Ideenlehre führen usw. Die sprachanalytische Wende der Philosophie hat daher viele "Scheinprobleme" (Carnap) entlarvt und erledigt. Also, um Ihnen etwas entgegenzukommen: Die vermeintlichen Gegenstände existieren nicht. ABER: Nicht weil man ihre Nichtexistenz herausgefunden hat, sondern weil es von vornherein verfehlt war, ihre Existenz für logisch/semantisch möglich zu halten. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 27.11.2023 um 08.10 Uhr |
|
Es ist in der Tat schwer zu verstehen, daß hier der alte Shakespearesche Grundsatz "Sein oder Nichtsein" nicht zutreffen soll. Wenn der Redegegenstand kein Gegenstand ist, nun, dann ist er eben keiner, d.h. dann existiert er nicht. Wenn ein Redegegenstand nicht objektiv real, kein Teil der Wirklichkeit ist, also nicht ist, wenn es ihn nicht gibt, dann existiert er eben nicht, dann gibt es ihn nicht. Die Behauptung, man könne die Frage, ob er existiert oder nicht existiert, schlicht für unzulässig erklären, ist für mich wiederum ein unzulässiger Trick. So kann man die Existenzfrage nicht lösen. Sie ist immer zulässig. Gut, das ist halt meine Meinung. Wir werden uns hierin offenbar nicht einigen können. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.11.2023 um 04.59 Uhr |
|
Sie unterstellen mir immer wieder, daß ich die Nichtexistenz von Konstrukten behaupte, während ich doch immer wieder sage, daß man bei Konstrukten nicht von Existenz und Nichtexistenz reden kann. Vielleicht habe ich mich manchmal nachlässig ausgedrückt, aber in den Grundzügen glaube ich es doch oft gesagt zu haben. Anders gesagt: Nicht alle Redegegenstände sind Gegenstände. Ich würde nie (höchstens aus Versehen) sagen, daß es den Südpol nicht gibt, weil er "nur" (wie Sie sagen) ein Konstrukt ist. Niemand hat ihn allerdings "entdeckt", weil immer klar war, daß es ihn gibt. Das ist in der Tat trivial (aber nicht irrelevant). Amundsen hat ihn erreicht, das ist etwas anderes. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 26.11.2023 um 21.56 Uhr |
|
Da eine mathematische Kugel einen Mittelpunkt hat, kann man natürlich nicht herausfinden, daß sie keinen hat. Dasselbe gilt für eine wirkliche Kugel in bezug auf ihren "funktionellen" Mittelpunkt. In diesen beiden Fällen ist die Aussage, daß man "keinen Mittelpunkt" nicht herausfinden kann, eine Trivialität. Wenn man aber unter einem möglichen wirklichen Objekt nur einen dreidimensionalen Körper versteht, dann ist dieselbe Aussage sogar falsch, denn auch ohne Tiefenbohrung wissen wir schon, daß ein dimensionsloser Punkt dafür niemals in Frage kommen kann, d. h. wir haben "keinen Mittelpunkt" bereits herausgefunden. Letztlich geht es aber wohl nur um einen begrifflichen Unterschied, wenn Sie etwas ein (funktionelles) Konstrukt nennen, während ich formgebundene reale Existenz (im Gegensatz zur inhaltsgebundenen realen Existenz) sage. Es wird nun mal überall von Existenz gesprochen, auch im Falle dieser Konstrukte. Ich glaube, Amundsen würde aus seinem nassen unbekannten Grab in der Barentssee auftauchen, wenn er hörte, daß der Südpol gar nicht existiert, sondern nur ein Konstrukt sei. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.11.2023 um 14.45 Uhr |
|
Weder bei einer mathematischen Kugel noch bei einer wirklichen Kugel (Murmel, Fußball) kann man herausfinden, daß sie keinen Mittelpunkt haben. Bei den Konstrukten kann man eben, wie ich schon oft gesagt habe, nicht sinnvoll fragen, ob sie existieren oder nicht. Sie erfüllen eine Funktion, als "nützliche Fiktionen" (aber das ist schon fast zuviel gesagt). "Idealisierungen" träfe es auch manchmal. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 26.11.2023 um 13.13 Uhr |
|
"Der Äquator, der Schwerpunkt einer Figur" sind leider für mich auch unklar. Was meinen Sie mit einer Figur? Einen realen Körper wie z. B. einen Planeten, oder ein geometrisches Gebilde wie eine Kugel oder ein Dreieck? Genauso wie reale Körper etwas anderes sind als mathematische Gebilde, ist natürlich auch der Schwerpunkt eines Planeten noch etwas anderes als der Schwerpunkt eines Dreiecks oder einer Kugel. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 26.11.2023 um 09.31 Uhr |
|
Da weiß ich nun nicht, wie Sie das meinen. Existieren diese Konstrukte also nicht, im Unterschied zu den Planeten, oder existieren sie eben doch, im Unterschied zu den Fiktionen? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.11.2023 um 08.03 Uhr |
|
Noch einmal zur „Existenz“: Die Existenz von Neptun und Pluto wurde vermutet, später wurden sie gefunden. Es waren also „hypothetische Einheiten“ im Sinne Theo Herrmanns. Später kamen z. B. die Neutrinos auf, die ebenfalls aufgrund von Berechnungen an beobachtbaren Vorgängen postuliert wurden, aber schwer nachweisbar waren. Schwer, aber nicht grundsätzlich unmöglich. Man wußte auch, welche Art von Detektoren zu ihrem Nachweis gebaut werden mußten, hat sie gebaut und die Neutrinos beobachtet. Das gleiche bei den Gravitationswellen. Zur Zeit spielen Dunkle Materie und Dunkle Energie diese Rolle. Neu ist, daß es sich nicht wie bei den Planeten einfach um „mehr vom selben“ handeln kann, sondern zugleich um etwas völlig Neuartiges. Der Äquator, der Schwerpunkt einer Figur oder die Seitenhalbierende in einem Dreieck sind keine hypothetischen Einheiten, die möglichweise auch nicht existieren. Man nennt so etwas Konstrukte, zur Unterscheidung von Fiktionen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 25.11.2023 um 10.01 Uhr |
|
Zu Wikipedia, Philosophie der Mathematik: Na ja, die Philosophen haben manchmal recht originelle Ideen, und manchmal verklären sie auch die Welt. Hat man einen Satz schon mathematisch exakt bewiesen, wird es für den Philosophen erst interessant. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.11.2023 um 03.30 Uhr |
|
Das Problem mit dem „Gegebensein“ des eigenen Tuns stellt sich schon bei Husserl an der schon mehrmals zitierten Stelle: „Jedes intellektive Erlebnis und jedes Erlebnis überhaupt, indem es vollzogen wird, kann zum Gegenstand eines reinen Schauens und Fassens gemacht werden, und in diesem Schauen ist es absolute Gegebenheit. Es ist gegeben als ein Seiendes, als ein Dies-da, dessen Sein zu bezweifeln gar keinen Sinn gibt.“ (Edmund Husserl: Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen. Haag 1958:31) Ich könnte schlicht dagegensetzen, daß das doch gar nicht stimmt: Ich kann mein Denken, Vorstellen usw. nicht „schauen“, und es ist mir auch nicht „gegeben“, sondern ich tue es. Mein Tun ist mir nicht gegeben, steht mir nicht in irgendeinem Sinn gegenüber; ich beobachte mich nicht dabei usw. Mehr als ein Appell ist hier natürlich nicht möglich, Behauptung steht gegen Behauptung. (Daß Erlebnisse nach deutschem Sprachgebrauch nicht „vollzogen“ werden, habe ich schon anderswo zu bedenken gegeben. Der Phänomenologe ist in den Galimathias so eingeübt, daß er diese Verstöße nicht mehr bemerkt.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.11.2023 um 03.10 Uhr |
|
Das ist eine mögliche Deutung, aber in der Philosophie der Mathematik gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Sehr knapp: https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie_der_Mathematik Ich habe mich während meines Studiums ein wenig damit beschäftigt, aber dann gefunden, daß ich dazu nichts beitragen kann. Hier in Erlangen bin ich dann nochmals darauf gestoßen "Erlanger Schule" der Logik, Wissenschaftstheorie, Mathematik, nach Paul Lorenzen dann Christian Thiel und seine Schüler. Zweifellos interessant, aber nichts für mich. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 24.11.2023 um 21.48 Uhr |
|
Die mathematische/logische Existenz ist eine Metapher. Mathematiker sagen, etwas existiert, wenn sie eigentlich nur meinen, es paßt, es ist stimmig, und das Gegenteil paßt nicht bzw. ist nicht stimmig. Die Metapher ist allgemein, aber besonders in der Geometrie, sehr anschaulich.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.11.2023 um 17.21 Uhr |
|
Über mathematische Themen äußere ich mich ungern, wie schon gesagt. Die Mathematiker sind frei, ihre Gegenstände zu definieren. Es gibt ja noch die Idealisierungen und nützlichen Fiktionen. Man kann oft fragen: Wozu braucht man x? Wozu "konstruiert" man x? Ob es den Erdmittelpunkt gibt, ist keine Tatsachenfrage. Kein Forscher kann herausfinden, daß es ihn nicht gibt. Auch die Tangentialebene (sagt man so?) durch den Ort Spardorf gibt es in diesem Sinn; man kann nichts anderes herausfinden, weil es mit der Kugel (na ja, dem Rotationsellipsoid) schon gegeben ist. Astronomisch braucht man den Erdmittelpunkt, weil man idealisierend so tun kann, als sei die ganze Masse dort versammelt. (Ist der Massenmittelpunkt überhaupt der geometrische? Keine Ahnung.) Usw., Sie verstehen bestimmt, worauf ich hinauswill. Man "findet" den Mittelpunkt nicht durch eine Expedition oder Tiefenbohrung, sondern indem man ihn "konstruiert", also berechnet. Das Rechnen ist nach behavioristischer Auffassung ein spezielles Sprachverhalten, aber darüber gehen die Ansichten auseinander. Idealisieren ist wie Abstrahieren eine Redeweise, nicht die Entdeckung einer idealen Welt. Der ideale Kreis ist ein Kreis unter Nichtberücksichtigung der Unsauberkeiten, die auch mit dem saubersten Zirkel verbunden sind. Ein Riesenproblem für Platon, aber das muß nicht sein. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 24.11.2023 um 16.59 Uhr |
|
Wenn ich es richtig verstehe, können Sie so zwar das Universalienproblem (Tischbeispiel) lösen, aber bei anderen konkreten Dingen wie z. B. dem Mittelpunkt oder dem Erdäquator oder der Zahl 5 bestimmt doch wohl nicht die Redeweise darüber, ob es sich um einen greifbaren Gegenstand oder nicht handelt?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.11.2023 um 12.28 Uhr |
|
Zu Ihrem zweiten Eintrag: Ich unterscheide nicht zwischen konkreten und abstrakten Gegenständen, sondern zwischen konkreten und abstrakten Redeweisen über die Gegenstände. Gegenstände können auch fingiert oder bloß angenommen werden, aber das bedeutet keine weiteren Welten von nichtexistenten oder möglichen Gegenständen. Das konkrete Sprechen wird letzten Endes immer durch deiktische Mittel in der Wirklichkeit verankert. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.11.2023 um 12.23 Uhr |
|
Das war nur eine Anspielung auf Uexküll und bedeutet den Teil der Umwelt, auf den ein Lebewesen wirken kann, keine zweite Welt neben der Merkwelt (das ist der komplementäre Begriff).
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 24.11.2023 um 10.46 Uhr |
|
Da bräuchten Sie sich ja nur zu vergegenwärtigen, daß z. B. der Tisch, an dem Sie sitzen, solch ein greifbarer Gegenstand ist, der Mittelpunkt der Tischplatte oder das universelle Wort "Tisch" jedoch nicht (auch nicht referentiell).
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 24.11.2023 um 10.30 Uhr |
|
Aber Sie schreiben dennoch von der greifbaren Welt der Gegenstände, der „Wirkwelt“ (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1540#52211). Ist das nicht Ihre Materiedefinition bzw. materielle Welt? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.11.2023 um 07.23 Uhr |
|
Eingeübte Routinen wie etwa beim Sport oder beim Musizieren lassen sich nur als ganze, aber nicht in den Einzelheiten als Handlung aneignen: Wir tun etwas, können aber keine Rechenschaft davon ablegen. Andererseits wäre es unpassend, von einem Geschehen zu sprechen, das wir nur beobachten wie etwas Gegebenes. Meine Hände laufen über die Klaviatur, aber ich sehe ihnen nicht zu wie zwei Tieren, sondern bin es immer noch selbst, der das tut. Jedes Handeln besteht im einzelnen aus nicht (mehr) überlegten oder geplanten Schritten, Geschicklichkeitsübungen, deren Entstehung wie beim Kind verfolgen können. Die Rechenschaft gilt molaren Einheiten des Verhaltens, die durch gesellschaftliche Konvention abgegrenzt werden (z. B. als "Sprechakttypen"). Ethnologen berichten, daß es in manchen Kulturen unüblich ist, sich zu bedanken, weil die Vorstellung einer Zurechnung fehlt: Alles geschieht, wie es geschehen muß. Niemand „kann etwas dafür“, nämlich für das, was er tut. Wir erleben etwas ähnliches beim Umgang mit kleinen Kindern: Man kann zornig werden wegen eines unartigen Benehmens, man kann aber auch denken, daß es sich um eine normale Entwicklung des Kindes handelt. Das Schreien eines Babys bringt manche Leute auf die Palme (Hotels werben damit, daß sie keine Kinder aufnehmen), während Mütter wissen, daß das Schreien die natürliche und einzige Sprache des Kindes ist. Und der Verhaltensforscher weiß außerdem: Das Unangenehme, Alarmierende des Säuglingsschreiens ist gerade sein evolutionärer Sinn. Noch leichter fällt es bei Tieren: Ist die Fliege wirklich frech, oder folgt sie einfach ihrer Natur? Der Psychologe oder Psychiater beobachtet jedes Verhalten seines Probanden oder Patienten, ohne ihn dafür zur Verantwortung zu ziehen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.11.2023 um 04.51 Uhr |
|
"Materiell" – was mag das bedeuten? Unterscheidet es etwas, und wovon? "Mental" – dito. Ich kann dazu inhaltlich nichts sagen, weil ich es nicht verstehe. „Ich weiß also nicht, ob es Geister gebe, ja, was noch mehr ist, ich weiß nicht einmal, was das Wort Geist bedeute.“ (Kant) In diesem Sinne meine ich es. Kant wußte natürlich sehr wohl, was "Geist" bedeutet, aber für die Zwecke seiner Argumentation wußte er es nicht. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 24.11.2023 um 01.10 Uhr |
|
Sich seiner Gedanken bewußt zu sein, ist auch nur ein Gedanke, der bereits im allgemeinen Plural Gedanken enthalten ist. Die endlose Rekursion bringt also nichts Neues, sie ergibt keinen Sinn.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 23.11.2023 um 23.17 Uhr |
|
Das Aufbrühen eines Kaffees ist ja keine vorrangig mentale oder kognitive Tätigkeit, kein Wunder, daß die Aussage, es sei jemandem gegeben, schräg klingt. Ihre Aussage zur Existenz verstehe ich nicht. Sie müssen doch auch sehen, daß der Tisch, an dem Sie sitzen, etwas materiell Existierendes ist, während ein allgemeiner Tisch nirgendwo steht, nur eine abstrakte Idee ist, Trotzdem würde jeder die Frage, ob Tische existieren, mit ja beantworten. Das sind doch schon zwei Arten der Existenz. Ebenso der Mittelpunkt der Tischplatte, der weder materiell existiert noch eine reine Idee ist, man kann seine Lage ja genau angeben. Das wäre die dritte Art. Kann man diese unterschiedlichen Aspekte der Existenz ernsthaft bezweifeln? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.11.2023 um 07.48 Uhr |
|
Wir können uns nicht vorstellen, wie es wäre, keine Sprache zu haben, nicht ständig stumm vor uns hinzusprechen usw. Nur eine Ahnung davon haben wir, wenn wir „gedankenverloren“ etwas getan haben, dabei aber durchaus geschickt und zweckmäßig. Manchmal bin ich unsicher, welchen der beiden Wege, die ich täglich entlanggehe, ich heute genommen habe: es ist alles so gleichförmig, daß es keinen Unterschied macht. Und ich habe im Gehen über XY nachgedacht und nicht auf den Weg geachtet; es ist mir auch nichts Denkwürdiges aufgefallen. Also wo bin ich gegangen? Vielleicht kennen Sie das auch? Mehr als dieser Appell ist nicht möglich, weil man nichts beschreiben kann, was man gedankenlos, also ohne Aufmerksamkeit getan hat. Problematisch wird es vor Gericht, wo vom Täter oder Zeugen erwartet wird, daß er sich alles, was er getan hat, als Handlung zu eigen macht. „Sie müssen doch wissen, ob Sie mit dem rechten oder dem linken Fuß zuerst aufgestanden sind!“ Nein, ich weiß es nicht, ich muß es aus meinen Gewohnheiten rekonstruieren. Ich weiß auch nicht, wie viele Stufen die Treppe hat, aber meine Beine wissen es, so daß ich auch im stockdunklen Treppenhaus nicht fehltrete. „Sie müssen doch wissen, warum Sie das getan haben!“ Das nun schon gar nicht, das weiß eigentlich niemand. Man legt sich bloß was zurecht, was auf Anerkennung rechnen darf. Vielleicht haben die Menschen die größte Zeit ihrer Geschichte sich so verhalten, wie es wohl auch die Tiere tun: ohne „Bewußtsein“ das angeborene und gelernte Verhalten ausgeübt. Julian Jaynes versucht diesen Zustand in Worte zu fassen. Daniel Dennett hat ihm als einer von wenigen Respekt gezollt für seinen kühnen Versuch, auch wenn einige Thesen keinen Bestand haben sollten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.11.2023 um 06.26 Uhr |
|
Ich brühe mir einen Becher Kaffee auf. Das Aufbrühen ist mir gegeben... Was soll das? Schräge Ausdrucksweisen lassen zu viel offen. Ich kann mit einer zweiten, dritten und erst recht vierten Art von Existenz nichts anfangen. Übrigens: Ich bin mir meiner Gedanken bewußt, und ich bin mir bewußt, daß ich mir meiner Gedanken bewußt bin, und ich bin mir auch bewußt, daß ich mir des Bewußtseins meiner Gedanken bewußt bin, und... |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 23.11.2023 um 01.28 Uhr |
|
Mit Zustand werden hier die vorgenannten Begriffe Empfindungen, Wahrnehmungen, Gedanken zusammengefaßt. Für manches davon paßt es besser (Angstzustand, Schmerz), für manches (Gedanken) weniger. Ich denke, es ist einfach als ein Oberbegriff ohne spezielle Absicht gemeint. Gegeben sein wird als Synonym für haben, erfahren werden, vorhanden sein im gleichen Zitat auch benutzt, also ebenfalls ohne speziellen Hintergedanken, z. B. an ein Hinnehmen. Das letztere erinnert an das Problem der Existenz. Schmerzen, Gefühle usw. existieren natürlich weder physisch noch sind sie Information, und mit logischer Existenz haben sie auch nichts zu tun. Aber wer, der schon einmal mit dem Hammer den falschen Nagel getroffen hat, wollte bestreiten, daß Schmerzen tatsächlich ganz real und in der Wirklichkeit vorhanden sind? Muß man also evtl. doch noch eine vierte Art von Existenz, eine mit Bewußtheit identische reale Existenz von Empfindungen und Wahrnehmungen annehmen? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.11.2023 um 17.42 Uhr |
|
Aus dem Haupteintrag: „Ich kann klar feststellen, daß ich jetzt diese Empfindung, diese Wahrnehmung, diesen Gedanken habe. Mir sind diese Zustände so gegeben, daß es absurd erscheint, an ihrem Vorhandensein zu zweifeln. (Volker Gadenne/Margit E. Oswald: Kognition und Bewußtsein. Berlin u. a. 1991:23) Ich hatte schon auf die Problematik der deiktischen Elemente (diese) in diesem scheinbar privaten "Erlebnisbericht" hingewiesen, will aber noch etwas anderes kommentieren. Das kommt alles so elementar und plausibel daher, aber ist es überhaupt angemessen ausgedrückt? Daß ich etwas denke, heißt nicht unbedingt, daß mir damit ein bestimmter „Zustand gegeben“ ist. Was ich selbst gerade tue, ist mir eigentlich nicht „gegeben“. Dem Gegebensein entspricht üblicherweise ein Hinnehmen, aber das trifft beim eigenen Denken gerade nicht zu, denn ich tue es ja. „Mein Denken ist mir gegeben“ wäre eine eigentümlich verfremdete Ausdrucksweise, und als „Zustand“ würde man sein Denken auch nicht ohne weiteres bezeichnen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.11.2023 um 05.52 Uhr |
|
Logiker konstruieren gern „Orthosprachen“ (unter welchem Namen auch immer: Logikkalküle usw.). aber sind es wirklich Sprachen? Bedeutung kommt nur einmal in die Welt, durch Semantisierung in der Geschichte und auch nachvollziehend bei jedem Kind (das auch mehrere Sprachen als Muttersprachen lernen kann). Konstruierte und vereinbarte Sprachen können Zuordnungen festlegen, aber immer auf der Grundlage einer bereits semantisierten Erstsprache, mit deren Hilfe konstruiert und vereinbart wird. Das geht nicht über Regeln für die Kombination von Legosteinen hinaus. Es bleibt meist verborgen, wieviel Kulturspezifisches in den „Sprachspielen“ steckt, die den Rahmen der primären Semantisierung bilden. Was alles im ersten „Nein“ des Kindes vorausgesetzt wird, was im „Ab!“ (für „ausziehen“ usw.)! Ich kann einem Legostein die Bedeutung „ausziehen“ zuordnen, aber was „ausziehen“ eigentlich bedeutet, läßt sich nur unter Heranziehung von „Intentionalität“ und damit einer Gemeinschaft, in der es Handlungsdialoge gibt, erklären. „Absichten“ gibt es ja nicht von Natur. Am Beispiel von „ausziehen“ kann man noch weiter gehen: Nur wo es schon die Sitte des Bekleidens gibt, haben Wörter wie „an-“ und „ausziehen“ einen Sinn. (Das vergessen Affenforscher, wenn sie einem Schimpansen beibringen, sich an- und auszuziehen. Das Ergebnis sieht aus wie bei Kindern, ist aber etwas völlig anderes, nämlich ein belohntes Zirkuskunststück wie jedes andere. Affen können aus begrifflichen Gründen nicht nackt sein. Kühe sind es ja auch nicht.)
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.10.2023 um 05.57 Uhr |
|
Vor einiger Zeit hat Heinz Schlaffer einen sehr schönen Artikel über Schopenhauer veröffentlicht. Er schließt so: „Vielleicht würden heute Schopenhauers bedenkenswerte, manchmal bedenkliche Gedankengänge häufiger gelesen, wenn er für sie nicht eine so vollkommene Sprache gefunden hätte.“ (https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article9705161/Arthur-Schopenhauer-war-ein-Darwinist-vor-Darwin.html) Schlaffer charakterisiert ihn als Weisheitslehrer ohne Weisheit (im persönlichen Leben), Darwinisten ohne Darwin. Dazu möchte ich zitieren: „Aber ohne Mythos und Symbol bezeugt die Heftigkeit des Geschlechtstriebes, der rege Eifer und der tiefe Ernst, mit welchem jedes Thier, und eben so der Mensch, die Angelegenheiten desselben betreibt, daß durch die ihm dienende Funktion das Thier Dem angehört, worin eigentlich und hauptsächlich sein wahres Wesen liegt, nämlich der Gattung.“ (Schopenhauer: WW II, Kapitel 42: Leben der Gattung) Dawkins würde sagen, daß es sich um die Rücksichtslosigkeit des egoistischen Gens handelt. Der Ernst von Geburt und Tod ist aus dem Ernst der Fortpflanzung abgeleitet, das einzige, was die Lebewesen „interessiert“. Auch alles Wollen, das Sein und das Haben betreffend, geht darauf zurück. Das Metaphorische der Darstellung löst sich auf, wenn man den evolutionstheoretischen Zusammenhang berücksichtigt. Schopenhauer, obwohl in großer Distanz zu Darwin, hat es intuitiv erfaßt und zum Kern seiner Philosophie gemacht wie sonst niemand. Durch den ersten Band von „Welt als Wille und Vorstellung“, auf den Schopenhauer besonders stolz war, weil er darin in jungen Jahren schon alles erfaßt hatte, was er später nur noch ausschmücken sollte, braucht man sich nicht durchzuquälen. Der zweite ist viel besser, und dann natürlich die beiden Bände mit dem „abschreckenden Titel“ (Schlaffer) „Parerga und Paralipomena“. Schopenhauer ist wohl der einzige, dem man die demonstrative Arroganz verzeiht, die sich schon im Buchtitel ausdrückt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.10.2023 um 05.14 Uhr |
|
„Most strikingly, nonhuman primates do not point or gesture to outside objects or events for others, they do not hold up objects to show them to others, and they do not even hold out objects to offer them to others.“ (Michael Tomasello: Constructing a language. Cambridge, Mass. u. London 2003:10f.) Es geht also um eine Form des Sozialverhaltens, die sich beim Menschen, aber nicht bei Affen entwickelt hat. Auf dieser Linie muß eine Verhaltensanalyse weiterarbeiten: Einem anderen etwas anbieten bedeutet, ihn wählen zu lassen. Es ist, auch in der wortlosen Form, ein Vorschlag, der angenommen oder zurückgewiesen werden kann, also gewissermaßen zur Diskussion gestellt wird, und gehört damit in die gleiche Klasse wie das Ankündigen, das wir als Wollen interpretieren (s. Naturalisierung der Intentionalität). So kommt man zu den wirklichen, operational definierbaren Verhaltenselementen. Ein Irrweg ist es, biologische Beobachtungsdaten mit den traditionellen mentalistischen Begriffen ("Gedankenlesen" usw., wie bei Tomasello) zu mystifizieren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.10.2023 um 05.01 Uhr |
|
Im Spinnennetz ist die Fliege repräsentiert... Es ist der Spinnenforscher, der die Nachricht über Spinnennetze und Fliegen formuliert und damit auch die Information (im nichtmathematischen Sinn) erzeugt. Er hat seine Erkenntnis nicht „aus“ dem Spinnennetz gewonnen, als hätte sie schon daringesteckt. Man könnte sehr weitreichend sagen: Das Erkennen der Funktion von Spinnennetzen ist eine Anpassung des Menschen an Spinnen, Netze, Fliegen usw. „Erkenntnis als Anpassung“ ist ein radikal pragmatisches Konzept und liegt auch dem radikalen Behaviorismus zugrunde. Diese Anschlußfähigkeit macht einen Teil seiner Anziehungskraft aus. Kürzeste Darstellung: Ich kann mich an Pilze anpassen, indem ich lerne, die giftigen zu meiden (falls ich dazu noch Gelegenheit habe...). Ich kann mich aber auch an Pilze anpassen, indem ich der Mitteilung eines anderen Menschen folge, der mich vor den giftigen warnt. Dieser Umweg über Sprache, Kommunikation, Information ist „Kultur“, aber, wie man am einfachsten Beispiel sieht, nicht wesentlich verschieden von der primären, natürlichen Anpassung durch Lernen und auch durch genetische Veränderung. Sprache macht den ganzen Unterschied, darum gibt es sie. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.10.2023 um 03.49 Uhr |
|
Zur „Intentionalität“ (im phänomenologischen Sinn von Gerichtetheit): „ich mag es“ scheint auszudrücken, daß mein mentaler Zustand (das „Mögen“) auf etwas gerichtet ist. Das gleichbedeutende „es gefällt mir“ läßt diese scheinevidente Deutung sofort verschwinden. Ebenso to like vs. to please usw. Wenn es sich um eine Sachverhaltsanalyse handelte, wie die Phänomenologen meinen, könnte die bloße Umformulierung nicht diesen Effekt haben. Diese ganze Richtung ist eben bloß ein sprachverführtes Gerede. Man darf sich von den gravitätischen Umschreibungen etwa bei Husserl nicht beeindrucken lassen. Die geradezu kindliche Naivität kommt in Brentanos locus classicus („Jedes psychische Phänomen...“) klarer zum Ausdruck. Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#50832 – wo die falsche Herleitung belegt und durch die richtige ersetzt ist.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.06.2023 um 07.34 Uhr |
|
Katzen – von der Hauskatze bis zu Löwe und Tiger – ducken sich gern hinter Sichtschutz, um von ihrer möglichen Beute nicht gesehen zu werden. Der finale Infinitiv drückt Absicht aus, sollte aber funktional gelesen werden. Das Verhalten ist angeboren. Das einzelne Tier hat keine Absicht und überprüft nicht, ob und wie weit der Zweck des Versteckens erreicht ist. Es kann sich gar nicht anders verhalten, und damit hat es Erfolg. Das "Lernen" liegt in der Stammesgeschichte und hatte Millionen Jahre Zeit. Je besser versteckt, desto erfolgreicher. In der Anpassung steckt die Zweckmäßigkeit, die wir als Absichtlichkeit mißverstehen. Hunde kommen uns intelligenter ("humanintelligenter" könnte man sagen) vor, als sie sind.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.05.2023 um 06.18 Uhr |
|
Adam Smith hat seine weit über die Nationalökonomie hinausreichende Lehre bekanntlich schon auf die Sprache angewendet, Hayek und dann Rudi Keller haben daran angeknüpft. Daher könnte ein Aufsatz interessieren, in dem Gavin Kennedy vor einigen Jahren die vielzitierte "unsichtbare Hand" zu einer bloß illustrativen Metapher zurückgestuft hat: (Gavin Kennedy: „Adam Smith and the Invisible Hand: From Metaphor to Myth“. Econ Journal Watch 6/2009:239-262). Dort auch die weitere Diskussion.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.04.2023 um 05.43 Uhr |
|
(Teilweise neu gefaßt:) „Die Intentionalität des menschlichen Geistes ist die primäre Intentionalitätsquelle in der Welt, aus der sich alle anderen Intentionalitätszuschreibungen speisen. (...) Der intentionale Gehalt sprachlicher Repräsentationen ist ebenfalls von der Intentionalität des Geistes abgeleitet, denn er wird den Symbolketten vom Sprecher bzw. von der Sprechergemeinschaft verliehen.“ (Geert Keil: Kritik des Naturalismus. Heidelberg 1993:355.) „Gedanken, Meinungen und Wünsche (generisch: intentionale Zustände) besitzen immer einen Gehalt. Das spiegelt sich darin wider, daß die Verben für Einstellungen (erwarten, hoffen, befürchten, zweifeln, erinnern etc.) mit einem grammatischen Objekt auftreten, typischerweise mit nominalisierten Sätzen, also sprachlichen Ausdrücken der Form daß p (‚p‘ ist Platzhalter für einen Satz) (...)“ (Peter Lanz in Anton Hügli/Poul Lübcke, Hg.: Philosophie im 20. Jhdt.,II, Reinbek 1993:285f.) John R. Searle behauptet sehr ähnlich, „die abgeleitete Intentionalität sprachlicher Elemente“ (d. h. deren Bedeutung) beruhe „auf der biologisch grundlegenderen intrinsischen Intentionalität des Geistes/Hirns“ (Die Wiederentdeckung des Geistes. München 1993:9; vgl. ders.: Intentionalität. Frankfurt 1983:60). Er nennt auch sonst „innere qualitative Bewußtseinszustände und intrinsische Intentionalität“ „biologische Phänomene“. Ebenso Roderick Chisholm, Paul Grice u. v. a. – Hubert Schleichert sieht es gerade umgekehrt: „Intentionalität ist aber zugleich ein Charakteristikum des Sprache. Man spricht immer von etwas, über etwas etc. Das gesamte Philosophieren über die Intentionalität beruht im Grunde auf einer Übertragung aus dem öffentlich zugänglichen Bereich der Sprache in den der Öffentlichkeit unzugänglichen, privaten Bereich des Mentalen.“ (Hubert Schleichert: „Über die Bedeutung von ‚Bewußtsein‘“, In Sybille Krämer, Hg.: Bewußtsein. Philosophische Beiträge. Frankfurt 1996:54-65, S. 60; ähnlich in ders.: Der Begriff des Bewußtseins. Eine Bedeutungsanalyse. Frankfurt 1992:155) – Dieser mit dem Behaviorismus übereinstimmenden Herleitung schließe ich mich an. Das Konstrukt des Geistes ist nach dem Vorbild der Sprache modelliert, nicht umgekehrt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.03.2023 um 06.06 Uhr |
|
Die Herakliteer kamen zu dem Schluß, daß man nichts sagen kann (sondern nur mit dem Finger wackeln), während ihre Antipoden, die Eleaten, aus der Einsicht des Parmenides folgerten, daß man nichts verneinen kann ("Sein, reines Sein..."). Beides ist tödlich für die Sprache, für Wahrheit. Daher Platons Kampf gegen die Sophistik, daher die logischen Klärungen des Aristoteles.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.03.2023 um 05.58 Uhr |
|
Nach Hume lassen die Sinnesorgane nur einen Strom von Merkmalen herein zu uns, die wir wie im Kino einen unverstandenen Film von Eindrücken an uns vorüberziehen lassen. Erfahrung entsteht durch das regelmäßige Zusammenvorkommen einiger Erscheinungen, aber Gegenstände können sich so nicht bilden. (Es sei an das „Bindungsproblem“ und an die Schlange erinnert, für die es keine Maus gibt. Hat jemand Erfahrung mit psychedelischen Drogen? Erlebt man dabei etwas ähnliches?) Kant hat das keine Ruhe gelassen. (Das war aber nicht Freges Problem. Heraklit, auf den Sie anspielen, wurde von seinen Schülern noch überboten: Man kann auch nicht EINMAL in denselben Fluß steigen. Hier war es Platon, dem Kratylos und die anderen Herakliteer keine Ruhe ließen.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 18.03.2023 um 00.51 Uhr |
|
Man kann angeblich auch nicht zweimal in den gleichen Fluß steigen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.03.2023 um 18.29 Uhr |
|
Jemand kann Morgenstern und Abendstern für verschiedene Himmelserscheinungen halten. Wie Frege sagt, haben die Menschen auch die Sonne jeden Tag für eine andere gehalten. Das ist für Nichtastronomen gut genug. Vielleicht hält der Hund seinen Herrn bei jeder Begegnung für einen anderen, wenn auch gleichen. Das werden wir nie wissen; der Hund mag mit Leibniz die Identitas indiscernibilium annehmen. An seinem Verhalten ändert es nichts. Ob ein Säugling einen „Begriff“ von Identität (der Mutter und seiner selbst) hat, kann man auch nicht wissen. Wenn das Kind für etwas belohnt oder bestraft wird, was es gestern getan hat, wird es wohl annehmen, daß es dasselbe ist wie gestern, und auch Versprechen und Drohung für morgen bringt ihm den „Begriff“ der Identität bei. Das Strafrecht sieht nicht vor, daß man einen hinreichend ähnlichen Verdächtigen einsperrt, wenn man den wahren Täter nicht zu fassen kriegt. Dagegen haben Männer schon eine ähnliche Frau (z. B. die Schwester) geheiratet, wenn die eigentliche Geliebte nicht wollte oder schon vergeben war. Das ist als zweitbeste Lösung immer noch besser als nichts. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.03.2023 um 14.25 Uhr |
|
Bruno Snell zeigt, daß die griechischen Götter schon in der Ilias eine fast naturalistische Deutung erfahren haben, die sie gar nicht so weit von unserer Erlebniswelt verständlich macht. Wir erleben wie die griechischen Helden unsere eigenen Entschlüsse wie etwas Fremdes, das irgendwie in uns aufsteigt und das wir manchmal im nachhinein gar nicht mehr recht verstehen. So wird auch im Epos jede neue Wendung des Geschehens auf den Willen der Götter zurückgeführt, weil es eine andere Erklärung nicht gibt. Sie erscheinen dem Helden z. B. im Traum und tragen ihm auf, was zu tun ist. (In Helmut Berve, Hg.: Das neue Bild der Antike I: Hellas. Leipzig 1942) Snell stellt es allerdings so dar, als hätten die Griechen „noch nicht“ eingesehen, daß der Wille aus uns selbst entspringt. Gerade hier würde der Radikale Behaviorist sagen: sie haben „auch schon“ erkannt, daß das agierende Subjekt eine Illusion ist: Wir können zwar tun, was wir wollen, aber wir können nicht wollen, was wir wollen. (Schopenhauer) Das Wollen kommt über uns, und dann kann man es auch auf einen Gott zurückführen. Das ist nicht so verschieden, außer in der Ausdrucksweise. In der Ilias gibt es Stellen, die den Menschen für schuldlos am Verhängnis erklären, weil die Götter es so gewollt hätten, z. B. Priamos zu Helena (3, 164f.). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.02.2023 um 15.26 Uhr |
|
Sie haben recht, mich an meine eigene Unterscheidung zu erinnern. finden hat zwei Lesarten, daher einerseits ich finde sie nimmer und nimmermehr = ich kann sie nicht finden, andererseits Goethes "Heideröslein", auf das er stößt, ohne es gesucht haben. In einem tieferen Sinn ist finden wohl doch intentional, weshalb wir nur übertragen sagen, das Wasser finde seinen Weg usw. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 17.02.2023 um 14.02 Uhr |
|
Setzt finden wirklich Intentionalität voraus? Irgendeine sicherlich, aber keine des Findens. Wenn jemand z. B. sich seine Brille aufsetzen möchte, kann er nicht sagen, jetzt finde ich und finde, solange bis ich sie habe. Finden ist kein Verhalten. sondern drückt das Ergebnis eines Verhaltens aus. Man kann es deshalb eigentlich auch nicht (außer in der Werbung) in den Imperativ setzen. Will man etwas suchen, dann sucht man. Will man etwas finden, dann kann man nicht anfangen zu finden, sondern auch nur zu suchen. Finden ist wie bekommen, erhalten die Beschreibung eines Endzustandes. Man kann auch nicht aktiv etwas erhalten (Werbesprache wieder ausgenommen). Man sagt auch, man habe etwas gefunden, wenn es völlig zufällig und intentionslos geschah. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.02.2023 um 05.21 Uhr |
|
Verben wie suchen sind Varianten oder Ableger von wollen und gehören daher zum „intentionalen Idiom“, das in einer objektiven Verhaltensanalyse vermieden werden muß. Allerdings ist es schwer, einem höheren Tier kein Suchverhalten zuzuschreiben. Der Hund, der auf der Wiese umherläuft, bis er auf den Stock stößt, den sein Besitzer immer wieder wirft, um das Tier apportieren zu lassen, scheint uns ein evidentes Beispiel für Suche zu liefern. Bei der Suche der Bienen nach Nektar ist es leichter, die Intentionalität in reine evolutionäre Angepaßtheit aufgehen zu lassen. Finden ist ein Erfolgsverb, setzt also ebenfalls Intentionalität voraus. Die Bienen sammeln, aber streng genommen suchen sie nicht und finden nicht.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.01.2023 um 06.44 Uhr |
|
Dawkins räumt ein, daß wir nicht mit letzter Gewißheit sagen können, ob Ameisen, Termiten oder Spinnen Pläne und Absichten haben; jedenfalls braucht man solche Annahmen nicht, um ihr Verhalten zu erklären. Die Frage ist damit erledigt, man braucht sich nicht um eine Antwort zu bemühen. (Behavioristische Pointe: Auch von Menschen braucht man nicht anzunehmen, daß sie Pläne und Absichten haben...) Das erinnert an Humes Erkenntnis, daß ein Gott, den man nicht braucht, um die Welt zu erklären und ein guter Mensch zu sein, ebensogut angenommen wie geleugnet werden kann – es ist gleichgültig. (Dialogues...) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.12.2022 um 07.09 Uhr |
|
Bevor das Zirkustier seinen Leckerbissen verzehren kann, muß es durch einen Reifen springen. Bevor es durch den Reifen springen kann, muß es ein Stück auf einem Wagen fahren. Bevor es mit dem Wagen fahren kann, muß es Männchen machen usw. (chaining und shaping). Man kann sagen, daß das Essen mit dem Männchenmachen beginnt und daß dies jetzt die erste Phase des Essens ist. Mein Spaziergang beginnt nicht mit dem Verlassen des Hauses, sondern mit dem Sprachverhalten „Ich gehe jetzt spazieren“. Das hat Vorteile für die Gemeinschaft. Um noch einmal Goethes scharfsinnige Analyse zu zitieren: „Unser Wollen ist ein Vorausverkünden dessen, was wir unter allen Umständen tun werden.“ Die Zurückführung von Wollen auf Werden ist der Schlüssel zur Naturalisierung. Goethe als radikaler Behaviorist; Skinner hätte sich gefreut, scheint aber diese Stelle nicht gekannt zu haben.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.12.2022 um 07.15 Uhr |
|
Der kleine Junge (1;6) kann willkürlich eine Jammermiene aufsetzen und tränenlos „weinen“, um auf den Arm genommen und getröstet zu werden. Auch bleibt er, nachdem der sich gestoßen hat, fast eine Minute stumm, bevor ihm einfällt, daß er weinen und Zuwendung erzwingen könnte. Kann man hier von Verstellung sprechen? Das Kind nimmt sich nicht vor, so zu tun als ob, sondern folgt dem zuvor verstärkten Verhaltensmuster. Absichtlichkeit ist noch nicht klar ausgebildet, solange es das Handlungsschema aus Ankündigung und Aushandeln noch nicht gibt. Die weitere Erziehung besteht darin, daß die Eltern das simulierte Verhalten nicht beachten. Dadurch lernt auch das Kind den Unterschied. Die Möglichkeit der Simulation („Lüge“) bleibt natürlich erhalten und wird von uns täglich genutzt; sie ist das Schmieröl der Gesellschaft. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.12.2022 um 05.25 Uhr |
|
„What is a propositional attitude? It is a mental state like belief, desire, intention, hope, fear, etc., that can take a full proposition – speaking loosely, a sentence – as its complement.“ (Eric Schwitzgebel https://schwitzsplinters.blogspot.com/2012/07/propositional-attitudes-belief-vs.html) „Complements“, also Ergänzungen, gibt es in der Grammatik. Wie kann ein Zustand eine „Ergänzung“ haben? Die Phänomenologen sagen: Normalerweise nicht, nur mentale Zustände, machen eine Ausnahme (so schon Brentano an der meistzitierten Stelle seines Werks). Diese Einzigartigkeit und Unvergleichbarkeit macht die These, daß Zustände auf etwas gerichtet sein sollen, nicht verständlicher. Nur weil man insgeheim gleich an Wünsche, Hoffnungen usw. denkt, scheint es plausibel, daß sie sich auf etwas richten. Aber gerade darum kann es sich nicht um Zustände handeln. Der logische Begriff der Einstellung (von Russell eingeführt) wird zwangsläufig psychologisiert, nämlich mit der naiven phänomenologischen, an die Alltagspsychologie anschließenden Redeweise vom Psychischen oder Mentalen vermischt. Schwitzgebel gesteht auch die Sprachlichkeit der Proposition zu – ob „speaking loosely“ oder nicht: etwas anderes als die Gleichung Proposition = Satz (Aussagesatz oder Satzradikal) wird nicht angeboten. All dies bei einem durchaus begriffskritischen Philosophen wie Schwitzgebel. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.11.2022 um 04.39 Uhr |
|
„Absichten oder Intentionen sind mentale Zustände, in denen sich der Handelnde auf eine bestimmte Handlung festlegt.“ Der ausführliche Artikel über „Absicht“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Absicht) zeigt, was passiert, wenn man einen vollkommen verständlichen Alltagsbegriff wie „wollen“ zu verwissenschaftlichen sucht. Goethe (s. Haupteintrag) tut das nicht, sondern wechselt nur den Standpunkt und damit die Begrifflichkeit: vom Mentalismus zum Naturalismus (Behaviorismus). Er will nicht erklären, was keiner Erklärung bedürftig und fähig ist, nämlich die allgemeinsprachliche Bedeutung von wollen, einem Wort des Kernwortschatzes, den man beherrschen muß, bevor man irgend etwas anderes versteht. Das Gerede von „mentalen Zuständen“ usw. ist heute weitgehend philosophischer Konsens. „Intentionality is that property of many mental states and events by which they are directed at or about or of objects and states of affairs in the world“ (John Searle: Intentionality. Cambridge 1983:1). Welche Eigenschaft sollte das denn sein, „durch die“ diese Zustände auf etwas gerichtet sind, und wieso können Zustände überhaupt gerichtet sein? Das scheint sich Searle nicht gefragt zu haben, und darum ist seine Aussage sinnlos, so oft sie auch in der einen oder anderen Form nachgesprochen wird. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.09.2022 um 04.39 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#33544 Wenn Eltern dem Säugling die Windeln wechseln (dieser volkstümlich noch als Wickeln, vgl. Wickeltisch, -kommode, -raum usw., bezeichnete Vorgang hat sich von der Tradition des straffen Wickelns gelöst, das in der westlichen Welt immer weniger praktiziert wird), behandeln sie ihn keineswegs wie ein zu schnürendes Postpaket, sondern sprechen mit ihm, obwohl sie wissen, daß er sie nicht versteht. Die Stimme stellt zusammen mit dem liebevollen Hantieren eine soziale Beziehung her, auf die das Kind früh antwortet: Mit dem Blickkontakt, verschiedenen Lautäußerungen und anderen Bekundungen von Wohl- und Mißbehagen stellt sich nach wenigen Wochen das Lächeln ein, das auch von den Eltern als entscheidender Schritt erlebt und entsprechend beantwortet wird. Die vorwegnehmende Behandlung des Säuglings als Person macht aus ihm tatsächlich eine. Mit Hunden und anderen Heimtieren macht man es ähnlich, aber hier stagniert die Personwerdung; Personhaftigkeit ist abgestuft. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.08.2022 um 05.53 Uhr |
|
Zu Thomas Nagel und anderen, auch zu meinem heutigen Eintrag unter "Delirium": „Wenn jemand Schmerz empfindet, dann ist es für ihn irgendwie, Schmerzen zu haben.“ Das ist rein sprachlich begründet: Ich empfinde x – daraus folgt Ich empfinde. Man kann den Aktanten jederzeit durch einen Stellvertreter ersetzen, der allgemeiner oder ganz leer ist. Ich habe die Empfindung X > Ich habe eine Empfindung. Es tut mir weh ist die konkrete Äußerung, es tut mir irgendwie wäre die allgemeine, ist aber nicht so üblich; stattdessen sagt man Es ist irgendwie für mich, Es fühlt sich irgendwie an o. ä. Das sind keine Einsichten, auf die sich irgend etwas bauen ließe, sondern Leerformen. Der Vordruck der Steuererklärung wird vom Finanzamt nicht als Steuererklärung akzeptiert. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.08.2022 um 05.15 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#44525 Max von Schenkendorfs Freiheit, die ich meine – nach älterem Jesu, den ich meine – wird heute kaum noch verstanden und auch falsch übersetzt: mean statt love. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.07.2022 um 08.54 Uhr |
|
"Schusseligkeit" ist ein umgangssprachlicher Begriff, der beschreibende und wertende Komponenten umfaßt. Er ist daher als wissenschaftlicher Begriff nicht brauchbar. Würde man nur den beschreibenden Anteil operationalisieren, liefe es vielleicht auf Ablenkbarkeit, Konzentrationsfähigkeit usw. hinaus, und das ist alles längst erforscht und gemessen. Die Bewertung mag wechseln. Was dem einen pathologisch vorkommt, findet der andere kreativ usw. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.07.2022 um 06.53 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#47200 Seit vielen Jahren zieht der Schusseligkeitsforscher Sebastian Markett durch die Medien. Jetzt widmet ihm die FAS eine Doppelseite (1.7.22: einschl. Fragebogen, mit dem jeder seine eigene Schusseligkeit messen kann). Markett weiß, wie man es macht: ein Schlagwort, sei es noch so unwissenschaftlich, fest mit dem eigenen Namen verbinden. Das reicht für ein ganzen Leben. Vgl. schon https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/psychologie-schusseligkeit-liegt-in-den-genen-a-959396.html |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.06.2022 um 06.16 Uhr |
|
Die Absichten, die wir und unsere Gesprächspartner haben, sind das Eichmaß jeder anderen Zuschreibung von Absichten. Anders gesagt: Die Möglichkeit oder Denkbarkeit eines Handlungsdialogs muß gegeben sein, damit wir einem „System“ Intentionalität zuschreiben können. Nach der phänomenologischen Art des Solipsismus weiß ich nur von mir ganz sicher, was wollen usw. (alle psychologischen Prädikate) heißt. Aber das stimmt nicht. Der Handlungsdialog ist der Ort, wo Intentionalität entsteht, sie ist immer dialogisch, im Dialog aber unabweisbar. Mir selbst und meinen Gesprächspartnern schreibe ich Intentionalität so wenig zu, wie seinerzeit dem Urmeter in Paris die Länge von 1 m zugeschrieben wurde. Darum hat es auch keinen Sinn zu sagen, daß wir unsere Gesprächspartner so betrachten und behandeln, ALS OB sie Intentionalität hätten. (Das ist Hackers schlagender Einwand gegen Dennett.) Fiktionalität hat nur Sinn, wo es das Original gibt. Die Dialogpartner sind das Original. (Das ist meine Version; ich habe einen anderen Ausgangspunkt als Hacker, es läuft aber auf das gleiche hinaus, in diesem Punkt auf die Verwerfung von Dennetts Thesen.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.05.2022 um 13.05 Uhr |
|
„Funktionsbestimmungen sind im Grunde immer final.“ (Elisabeth Leiss: Die Verbalkategorien des Deutschen. Berlin 1992:72) Aber die Evolutionstheorie erklärt die Funktion von Merkmalen gerade ohne die Unterstellung von Zwecken oder Absichten. An deren Stelle tritt die Selektion. Die Eier von Vögeln, die auf Felsen usw. brüten, sind konisch zulaufend geformt, „damit“ sie nicht herunterrollen. = Sie haben diese Form angenommen, weil sie im Laufe der Evolutionsgeschichte einen größeren Fortflanzungserfolg zeitigten. Diese Erklärung ist nicht-final. Die Verfasserin meint im Anschluß an Coseriu, Sprachwissenschaft könne wegen der Finalität der Funktionen keine Naturwissenschaft sein. Das ist offenbar nicht richtig, es verkennt den fundamentalen Wandel der Sichtweisen durch Darwin; die Konditionierungsgeschichte der Individuen ist das strukturgleiche ontogenetische Gegenstück. – Naturalisierung besteht in der Eliminierung der Teleologie als Erklärungsprinzip. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.04.2022 um 05.51 Uhr |
|
Laut Dixon gibt es Mennoniten, die „I want“ aus der Sprache verbannt haben, weil alles nach dem Willen Gottes geschieht (Are Some Languages Better than Others? S. 24). - Das ist nicht recht glaubhaft. Wohl eher stilistisch: man vermeidet es tunlich. Vgl. „Nothing is more vulgar than a careful avoidance of beginning a letter with the first person singular.“ (Dorothy Sayers) Was wir durch „wollen“ ausdrücken, steckt in anderen Sprachen in Desiderativformen (lat. esurire ‚essen wollen, hungern‘ zu edere, sanskr. shushrûṣati ‚will hören‘ zu shravati; vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=719#22975), die teilweise mit dem Futur verwandt zu sein scheinen – was noch einmal die Nähe von tun werden und tun wollen belegt. Wenn etwas nicht lexematisch, sondern grammatisch (morphologisch) ausgedrückt wird, muß es sehr tief in der Sprache verwurzelt sein. Man kann getrost behaupten, daß alle Sprachen ein "Vorausverkünden dessen, was wir unter allen Umständen tun werden" (s. oben zu Goethe) ermöglichen müssen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.04.2022 um 05.39 Uhr |
|
„Die Intentionalität des menschlichen Geistes ist die primäre Intentionalitätsquelle in der Welt, aus der sich alle anderen Intentionalitätszuschreibungen speisen. (...) Der intentionale Gehalt sprachlicher Repräsentationen ist ebenfalls von der Intentionalität des Geistes abgeleitet, denn er wird den Symbolketten vom Sprecher bzw. von der Sprechergemeinschaft verliehen.“ (Geert Keil: Kritik des Naturalismus. Heidelberg 1993:355; ähnlich John Searle: Die Wiederentdeckung des Geistes. München 1993:9; Ders.: Intentionalität. Frankfurt 1983:60; ebenso Roderick Chisholm, Paul Grice u. a.; mit der Übernahme angelsächsischer Philosophie ist auch „Aboutness“ üblich geworden.) Hubert Schleichert sieht es gerade umgekehrt: „Intentionalität ist aber zugleich ein Charakteristikum des Sprache. Man spricht immer von etwas, über etwas etc. Das gesamte Philosophieren über die Intentionalität beruht im Grunde auf einer Übertragung aus dem öffentlich zugänglichen Bereich der Sprache in den der Öffentlichkeit unzugänglichen, privaten Bereich des Mentalen.“ (Hubert Schleichert: „Über die Bedeutung von ‚Bewußtsein‘“, In Sybille Krämer, Hg.: Bewußtsein. Philosophische Beiträge. Frankfurt 1996:54-65, S. 60; ähnlich in ders.: Der Begriff des Bewußtseins. Eine Bedeutungsanalyse. Frankfurt 1992:155) – Dieser mit dem Behaviorismus übereinstimmenden Herleitung schließe ich mich an. Das Konstrukt des Geistes ist nachweisbar nach dem Vorbild der Sprache modelliert, nicht umgekehrt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.04.2022 um 07.01 Uhr |
|
Wenn die Katze mit dem Smartphone spielt, können wir ihr vorschlagen, sich lieber mit einem Garnknäuel zu beschäftigen. Aber von einem „Tausch“ im eigentlichen Sinn kann nicht die Rede sein, weil die Katze die Institution des Besitzens nicht kennt. Ich kann die Katze nur ablenken, indem ich einen Reiz setze, der im Augenblick stärker wirkt. So macht man es auch mit kleinen Kindern, deren Sinn für Eigentum sich erst allmählich entwickelt (weshalb sie sich ja auch mit „geschenkt ist geschenkt“ so wenig abfinden können, daß sie einander mit dem bekannten Merkvers zur Ordnung rufen müssen). Ist es grundsätzlich anders, wenn der Bankberater mir vorschlägt, Aktien gegen Immobilien einzutauschen? Er führt ein Objekt ein, das im Augenblick attraktiver erscheint als das schon vorliegende, und das rationale Wirtschaftssubjekt folgt dem stärkeren Reiz. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.04.2022 um 15.26 Uhr |
|
Wolfgang Prinz zieht aus neurologischen Überlegungen bekanntlich den Schluß, daß es keinen freien Willen gibt. Auf die Frage nach den Folgen für das Rechtssystem antwortet er: „Wir könnten aber auch ein anderes Rechtssystem etablieren. Etwa eines, das nicht auf dem Schuld- und Verantwortungsprinzip beruht, sondern darauf, daß man für Handlungen, die anderen schaden, zahlen muß, ohne daß man dem Handelnden Freiheit und Schuldfähigkeit unterstellt.“ (In Geyer, Hg.: Hirnforschung und Willensfreiheit, S. 26) Warum muß man zahlen? Man kann doch nichts dafür, daß jemandem ein Schaden entstanden ist. Durch generelle Ablösung aller Strafen durch Geldbußen bzw. Wiedergutmachtung ändert sich im wesentlichen gar nichts, auch nicht an der Unterstellung von Schuldfähigkeit. Übrigens ist dieses Entgeltdenken eine Rückkehr zur alten Auffassung von „Buße“ (etymologisch = „Besserung“). Für Mord (im weitesten Sinne) zahlte man der Familie des Toten ein „Wergeld“ (= Manngeld). Das war die Schuld, wie man heute noch von Geldschuld und Schulden spricht, woran nichts Moralisches haftet. Es ist ein Geschäft wie jedes andere. Ob Prinz das zu Ende gedacht hat? (Abgesehen davon, daß die ganze Argumentation verfehlt ist.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.04.2022 um 05.21 Uhr |
|
„Ich weiß also nicht, ob es Geister gebe, ja, was noch mehr ist, ich weiß nicht einmal, was das Wort Geist bedeute.“ (Immanuel Kant: Träume eines Geistersehers, 1766) Das könnte ich, mit etwas anderer Bedeutung, auch von mir sagen. Natürlich kann man nicht beweisen, daß es Geister (und Götter) nicht gibt. Das versucht Kant ja auch weder hier noch in der nach langer Arbeit daran anknüpfenden Kritik der reinen Vernunft. Er verteilt aber die Beweislast, wie es sich gehört, und macht Schluß mit der "Metaphysik" im traditionellen Sinn. Soll ich alle Texte lesen, die Chalmers zum Thema „Bewußtsein“ zusammengestellt hat? (https://www.metaphysicspirit.com/books/Collection%20of%20Papers%20Concerning%20Consciousness.pdf). Dann könnte ich zehn Jahre lang nichts anderes tun. Lieber gar nicht erst anfangen. Warum sollte ich mich mit etwas beschäftigen, was ich ohnehin für sinnlos halte? Dies nachzuweisen macht nach einer Weile keinen Spaß mehr. Alles weitere hier unter "Delirium". |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.03.2022 um 18.22 Uhr |
|
Natürlich baut sich der Nervenimpuls erst allmählich auf, bevor er die Muskelkontraktion bewirkt (Bereitschaftspotential). Die genauere Untersuchung des Ablaufs und der Dauer durch Kornhuber und Libet kann doch unser Menschenbild nicht erschüttern. Was hat man denn erwartet?
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 29.03.2022 um 17.05 Uhr |
|
Nun geben Sie mir sogar teilweise recht, dabei wollte ich gerade schreiben, mir leuchtet langsam ein, daß es doch besser ist zu sagen, die Frage der physischen Existenz von Konstrukten stellt sich gar nicht, anstatt von einer allgemeinen trivialen Nichtexistenz zu sprechen. Ich war bisher irgendwie in der Idee gefangen, daß es egal ist, wenn etwas sowieso nicht existiert, in welcher Weise es dann nicht existiert. Aber es ist einfach nicht erlaubt, Dinge zweier verschiedener Kategorien so zu vermischen. Danke für Ihre geduldigen Erläuterungen! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.03.2022 um 16.15 Uhr |
|
Tja, da habe ich mich wohl mit der Suche nach einer Analogie etwas leichtfertig aufs Glatteis begeben und muß sehen, wie ich wieder herunterkomme. Die Geomtrie der Kugel mit ihren Großkreisen usw. ist eben wieder zu nahe an der Mathematik, das wollte ich eigentlich nicht. Ebenso die Sache mit den Brennpunkten. Mit Begriffen wie Brennpunkt, Äquator usw. faßt man gewisse Meßergebnisse zusammen, nicht wahr? Die existieren zweifellos. Wenn jemand immer wieder bestimmte Verhaltensweisen zeigt, schreibt man ihm "Leichtfertigkeit" zu (wie ich mir gerade selbst), das ist dann ein Charaktermerkmal und ein typisches Konstrukt (wie auch Theo Herrmann in seinem frühen Buch über Persönlichkeitsforschung = Charakterkunde sagt). Existiert die Leichtfertigkeit? Die Verhaltensweisen, die man damit zusammenfaßt, existieren wirklich. Problematisch wird es, wenn man die Leichtfertigkeit als Ursache des Verhaltens angibt, aus dem sie abgeleitet ist. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 29.03.2022 um 12.29 Uhr |
|
Ich denke nicht, daß ich diesem Mißverständnis aufgesessen war. Sie haben das Beispiel Brennpunkt als Konstrukt genannt. Eine Glaslinse hat einen, eine ebene Scheibe hat keinen. Natürlich immer unausgesprochen im logischen Sinne. Niemand käme auf die Idee zu sagen, die Erde hätte keinen Mittelpunkt, keinen Schwerpunkt, keinen Äquator, keinen Nord- und keinen Südpol. Alles das existiert, aber natürlich nur logisch, nicht physisch. Sie sagen nun, Sie meinen mit Existenz immer die physische Existenz. Ist es nicht ein sehr trivialer Schluß, daß diese Konstrukte physisch nicht existieren? So trivial, daß es tatsächlich niemand ernsthaft erwägt? Aber auch Triviales ist ganz klar determiniert. Wieso sollte sich die Frage der physischen Existenz z.B. eines solchen Konstrukts nicht stellen? Wenn Brennpunkte, Mittelpunkte, Pole usw. physisch NICHT existieren, dann ist die Frage damit doch beantwortet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.03.2022 um 06.03 Uhr |
|
Es gibt hier eine Zweideutigkeit, die anscheinend zu Mißverständnissen führt. Wenn ich sage, daß sich bei Konstrukten die Frage nach der Existenz nicht stellt, so meine ich natürlich nicht, daß die Konstruktbildung selbst nicht existiert. Ich bezweifele, daß es Götter gibt, aber ich bezweifele nicht, daß es den Glauben an Götter gibt. Vielleicht sollte ich analog sagen: Konstruktion gibt es, Konstrukte gibt es weder, noch gibt es sie nicht. Mit Existenz meine ich niemals "logische Existenz". Die Mathematiker sind frei, "Existenz" nach ihren Bedürfnissen zu definieren; das betrifft mein Problem gar nicht. Das hatten wir alles schon mal, daher mein knapper Satz über das "Ausklammern". |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.03.2022 um 23.28 Uhr |
|
"Die mathematische Existenz würde ich, wie schon früher, gern ausklammern." (#48791) Warum eigentlich? Ist sie nicht von der gleichen Art wie logische Existenz, ist eine Zahl kein Konstrukt menschlicher Intelligenz? Man sollte eine Theorie doch so einfach wie möglich halten, d. h. mit möglichst wenigen Ausnahmen. Meine Sicht ist so: Es sind doch nur zwei Arten von Existenz möglich, zum einen das physisch Gegebene und zum andern das logisch Gegebene. Was sonst noch? Die erstere, physische Existenzart hängt unmittelbar mit Menge und Form der Materie, der Substanz, dem Stoff zusammen. Man kann sie noch in einen quantitativen und einen qualitativen Teil spalten. Das Quantitative ist die reine Substanz, der Inhalt, die Menge, der objektiv existierende materielle Gegenstand an sich aufgrund seiner reinen Masse. Das Qualitative ist die Struktur, die [An-]Ordnung, Sortierung, Ausrichtung, Form, es trägt sowohl die stofflichen Eigenschaften als auch weitere Information (Daten) bis hin zur Information im Sinne der heutigen Informationsverarbeitung und bis hin zum Wissen und Bewußtsein im lebenden Organismus. Die objektiv existierende Information ist selbst nicht substanziell, aber an die Form der Substanz gebunden. Es gibt keine Substanz ohne Form und keine Form ohne Substanz. Die zweite Art der Existenz ist die auf logischer Grundlage. Dazu gehören abstrakte Sachverhalte ("Gegenstände"), Ideen, mathematische und logische Objekte ebenso wie Universalien und eben auch Konstrukte. Sie alle haben gemeinsam, daß sie durch Aussagen definiert werden. Man sagt, ein solches ideelles Objekt existiere, wenn die definierenden Aussagen in sich widerspruchsfrei sind, und, soweit sie sich (wie z. B. bei Universalien) auf physisch existierende, reale Objekte beziehen, wenn sie wahr sind. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.03.2022 um 18.15 Uhr |
|
Vgl. übrigens (neben viele anderen Einträgen zu meiner Obsession): http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1370#37647 Hypothetische Einheiten kann man suchen, und es gibt keinen begrifflichen Grund, warum man sie nicht finden sollte. Nach Rotkäppchen wird man nicht suchen, nach Einhörnern schon eher, aber man hat sie nicht gefunden. Götter? Da gehen die Meinungen auseinander, aber es spricht viel dafür, daß es sie nicht gibt. Phlogiston, Weltäther hat man nicht gefunden, deren Existenz ist widerlegt (soweit das logisch möglich ist). Synapsen hat man nach rund 50 Jahren gefunden. Die Haare, die jemand auf den Zähnen hat, wird man weder suchen noch finden. Das ist eine Metapher. Das Alter einer Person ist keine hypothetische Einheit und kein Konstrukt, sondern ein Abstraktum, nämlich die Substantivierung der Angabe, „wie alt jemand ist“ bzw. „daß jemand (soundso) alt ist“. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.03.2022 um 17.32 Uhr |
|
Ein ausgeführtes Beipiel war dies hier: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#38818 Das soll kein Ersatz für die gewünschte Definition sein, sondern nur ein bißchen Fleisch an die Knochen tun. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.03.2022 um 17.29 Uhr |
|
Zur Erinnerung: Konstrukte sind abzugrenzen gegen Fiktionen, hypothetische Einheiten, Metaphern und Abstrakta. Die psychologischen Konstrukte können durch eine kleine Beispielliste veranschaulicht werden: Aggressionstrieb Beharrungsvermögen Betriebsklima Bewußtsein Charakter Charakterstärke Charisma Durchhaltevermögen Ehrgeiz Freiheitssinn Frustration Geist Hemmschwelle Ich, Es, Über-Ich Ich-Schwäche Meme mentale Landkarten usw. Mentalität Motivation Narzißmus Persönlichkeit Repräsentation „Schichten der Persönlichkeit“ Selbstvertrauen Teamgeist Unbewußtes Urteilskraft Weltanschauung Zeitgeist |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.03.2022 um 17.19 Uhr |
|
Die mathematische Existenz würde ich, wie schon früher, gern ausklammern. Aber in einem Punkt gebe ich Ihnen recht: Die Unterscheidung von reinen Fiktionen (Rotkäppchen) und Konstrukten (Naivität) ist intuitiv leichter als in Worte zu fassen. Es gibt ja Theologen, die "Gott" so abstrakt formulieren, daß man darunter tatsächlich ein Konstrukt verstehen kann, mit dem sich Tatsachen zusammenfassen und erklären lassen. Aristoteles hat damit angefangen ("unbewegter Beweger"). Ich muß mir noch eine gute Formulierung überlegen, nicht nur Ihretwegen, sondern weil es ein wichtiger Punkt in meiner naturalistischen Zeichentheorie ist. Hier noch ein Nachtrag zu den Neurosophen: Wenn Neurologen sich über Willen und Willensfreiheit äußern, tun sie das als Laien. „Wille“ kommt im Vokabular der Neurologie oder irgendeiner anderen Naturwissenschaft nicht vor. Der Neurologe weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Er stößt bei seinen Forschungen ja auch nicht auf „Verantwortung“, „Schuld“, „Gerechtigkeit“ usw. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.03.2022 um 17.13 Uhr |
|
"Man würde doch nicht fragen, ob es die Naivität wirklich gibt" Natürlich nicht, aber nur, weil das in diesem Zusammenhang völlig irrelevant, abseits vom Thema wäre. Das heißt doch nicht, daß die Existenzfrage nach dem Konstrukt "Naivität" sich gar nicht stellen ließe. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.03.2022 um 16.26 Uhr |
|
Daß man nicht fragen kann, ob ein bestimmtes Konstrukt (z. B. Bewußtsein, Brennpunkt, natürliche Zahl zwischen 0 und 1) existiert, verstehe ich nun wiederum nicht. Ich würde übrigens auch das Einhorn zu den (nicht existierenden) Konstrukten zählen. Die Frage der Existenz ist ja nicht immer so trivial. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.03.2022 um 16.13 Uhr |
|
(Ich hatte #48787 schon vor dem Lesen von #48786 geschrieben.)
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.03.2022 um 16.06 Uhr |
|
Oder ist es wie folgt gemeint? Alle Konstrukte existieren ebenso wie reine Fiktionen, Illusionen NICHT. Wie, nach welchem Merkmal des Nichts, kann man zwei Nichtse unterscheiden? Wie unterscheidet man im allgemeinen ein Konstrukt von einer reinen Fiktion? Es gibt ja kompliziertere Dinge als das Einhorn. Eine ungerade natürliche Zahl zwischen 1 und 3 (ein weiteres einfaches Beispiel), ist das ein nichtexistierendes Konstrukt oder eine Fiktion? Eine gerade Zahl zwischen 1 und 3 existiert jedoch. Also ein existierendes Konstrukt? Aber eigentlich existieren Konstrukte ja von vornherein nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.03.2022 um 15.53 Uhr |
|
Diese Frage verstehe ich jetzt nicht. Ich sage doch ständig, daß sich die Existenzfrage bei Konstrukten nicht stellen läßt. Es geht um den Nutzen. Wenn ich jemandem z. B. "Naivität" zuschreibe, fasse ich damit eine große, wenn auch im einzelnen unbestimmte Menge von Reaktionen zusammen. Man würde doch nicht fragen, ob es die Naivität wirklich gibt, sondern höchstens, ob jemand wirklich naiv ist. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.03.2022 um 15.13 Uhr |
|
Was könnte ein Beispiel für ein beliebiges Konstrukt (also keine reine Fiktion, keine Illusion) sein, von dem man sinnvollerweise sagen kann, daß es nicht existiert? In welchem Sinne existiert es nicht? Oder existieren aĺle Konstrukte? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.03.2022 um 05.18 Uhr |
|
Ich bin natürlich nicht dieser Ansicht, sondern versuche die ganze Zeit, zwischen Konstrukten und reinen Fiktionen zu unterscheiden. Goethes Formulierung ist überlegen, weil sie dem Begriff des Willens in sprachanalytischer Weise seinen Platz in der sprachlichen Koordination des menschlichen Verhaltens zuweist. Nur wenn man den Willen aus dem Zusammenspiel kommunizierender Partner herauslöst und für eine Naturerscheinung hält, kann man zu dem Ergebnis kommen, daß es ihn nicht gibt, daß er eine Illusion ist. „Es gibt keinen Willen“ ist offenbar so wenig eine sinnvolle Aussage wie „Es gibt kein Bewußtsein, kein Denken usw.“ Von Konstrukten kann man nicht sagen, daß es sie nicht gibt, jedenfalls nicht im gleichen Sinn, in dem man es von fiktionalen Gegenständen sagen kann. Darum ist es verfehlt, wie Wolfgang Prinz an die Sache herangeht. Zwar erkennt er, daß der (freie) Wille ein soziales Konstrukt ist, aber dann kann er nicht sagen: „Vom freien Willen zu reden ist ähnlich wie über das Einhorn zu reden: Man spricht dabei über Dinge, die es von Natur aus gar nicht gibt. Vom Einhorn wissen wir das schon längst. Schon lange gehört es nicht mehr in die Zuständigkeit der Naturwissenschaften, sondern in die der Kulturwissenschaften. Denn wenn es auch keine Naturgeschichte hat, so hat es doch eine Kulturgeschichte. Und hier – in der Kultur – existiert es dann doch und die kulturgeschichtliche Forschung hat einiges darüber zu sagen, wie es in die Welt kam, wie es kommt, dass es sich so hartnäckig am Leben hält und was die Leute davon haben, dass sie an es glauben. Das Einhorn will ich mir im Folgenden zum Beispiel nehmen, wenn es um den freien Willen geht. Ich werde nicht nur über Willensfreiheit als Naturtatsache reden, sondern über die Idee der Willensfreiheit als kollektive Vorstellung und Konstruktion. Wie kann es sein, so werde ich fragen, dass Personen sich frei fühlen und glauben, obwohl sie es vielleicht von Natur aus eigentlich nicht sind?“ (Wolfgang Prinz: „Der Wille als Artefakt“. In: Karl-Siegbert Rehberg, Hg.: Die Natur der Gesellschaft: Verhandlungen des 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Kassel 2006. Frankfurt 2008:642-655, S. 642) Passender wäre der Vergleich mit anderen Konstrukten: Der Brennpunkt einer Linse zum Beispiel ist kein Ort im Raum, den man auffinden könnte, sondern ein Konstrukt, mit dessen Hilfe man die Eigenschaften eines Brennglases darstellen kann. Daß Menschen „von Natur nicht frei“ seien, ist keine sinnvolle Behauptung. Der Begriff der Freiheit stammt nicht aus der Naturbeobachtung, sondern aus der Verhaltenskoordination zwischen Personen. Diese wissen recht gut, was sie mit freien und unfreiem Verhalten meinen. Das Einhorn ist in ganz anderer Weise nichtexistent als der freie Wille; letzterer ist ein Konstrukt, d. h. ein Hilfsbegriff, der eine gewisse Funktion in der Erklärung und Koordination menschlichen Verhaltens hat. Prinz hat das durchaus erkannt, unterscheidet dann aber nicht zwischen Konstrukt und „Illusion“. Ich habe es getan, weil ich es wollte – das ist kein theoretischer Satz über Verursachung, sondern dient z. B. der Unterscheidung freiwilliger von erzwungenen Handlungen. Man könnte es adverbial ausdrücken, dann verschwände der Schein des Kausalen. Es geht nicht um die Nichtdeterminiertheit von Ereignissen. Das wäre ein unzulässiges Pressen der alltäglichen Verständigungssprache. Ich bringe die Ansicht gewisser Philo- und Neurosophen auf die einfachste Form: „Es gibt keinen freien Willen = Es gibt keinen Willen = Man kann nichts wollen = Niemand will etwas“ – das ist offenbar nicht sinnvoll. Wer so redet, kann einfach kein Deutsch. Dagegen sind "Es gibt keine Götter" oder "Rotkäppchen existiert nicht" perfektes Deutsch. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 27.03.2022 um 15.44 Uhr |
|
Den Begriff Willen allein finde ich nicht besser als einen ontologischen Gottesbeweis. Ob es einen "Willen" gibt, steht ja gerade im Zweifel. Es wird vermutet, der angebliche Willen sei eine Illusion. Um nun zu betonen, daß der Willen eben doch keine Illusion sei, wird er von Vertretern dieser Auffassung auch "freier Willen" genannt. Das Attribut mag in gewisser Weise überflüssig sein, wird aber m. E. dennoch zur psychologischen und philosophischen Abgrenzung benötigt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.03.2022 um 08.00 Uhr |
|
Die Willensfreiheit braucht nicht bewiesen zu werden, weil sie mit dem Begriff des Willens schon gegeben ist. Der Wille ist immer frei, weil von Willen überhaupt nur gesprochen werden kann, wo das Verhalten offen für Einspruch, für Argumente ist; wo es Wahlmöglichkeiten gibt, also im dialogischen Handlungsschema. Das belegt auch die Sprache selbst: i][willentlich, willkürlich[/i] – darin steckt nicht nur der Wille, sondern auch die Willensfreiheit (vgl. sua sponte, suo motu). Etwas gewollt haben genügt, man muß nicht frei oder freiwillig dazusetzen. freiwillig und willig sind dasselbe.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.03.2022 um 08.17 Uhr |
|
Zum vorigen: Ich habe gerade die drei besonders wichtigen Zitate zu dem von Goethe so schön zusammengefaßten Problem zusammengestellt und will sie hier (teils in Übersetzungen) anführen. Goethe war sicherlich von Spinoza beeinflußt: „Denken Sie nun, bitte, der Stein denke, indem er fortfährt, sich zu bewegen, und er wisse, daß er nach Möglichkeit in der Bewegung zu verharren strebt. Dieser Stein wird sicherlich, da er sich doch nur seines Strebens bewußt und durchaus nicht indifferent ist, der Meinung sein, er sei vollkommen frei und verharre nur darum in seiner Bewegung, weil er es so wolle. Und das ist jene menschliche Freiheit, auf deren Besitz alle so stolz sind und die doch nur darin besteht, daß die Menschen sich ihres Begehrens bewußt sind, aber die Ursachen, von denen sie bestimmt werden, nicht kennen.“ Baruch de Spinoza: Briefwechsel (Hamburg 1986:236). Schopenhauer bezieht sich auf diese Stelle, der er noch eine charakteristische Pointe hinzufügt: „Spinoza sagt (epist. 62), daß der durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtsein hätte, meinen würde, aus seinem eigenen Willen zu fliegen. Ich setze nur noch hinzu, daß der Stein Recht hätte.“ (Welt als Wille I. Spinozas 58. Brief an Georg Hermann Schuller wird nach früherer Zählung bei Schopenhauer als 62. Brief angeführt.) Albert Einstein, der mit Spinoza und Schopenhauer vertraut war und ihre Ansicht teilte, schrieb in der Festschrift für Tagore: „Wäre der Mond auf seinem ewigen Kreislauf um die Erde mit Bewußtsein begabt, so wäre er fest davon überzeugt, er ziehe seine Bahn auf eigene Faust, auf der Grundlage einer Entscheidung, die er irgendwann ein für allemal getroffen habe. Ein Wesen, begabt mit tieferer Einsicht und höherer Intelligenz als wir, das die Menschen und ihr Tun beobachtete, würde lächeln über ihre Illusion, sie handelten im Einklang mit ihrem eigenen freien Willen.“ (Albert Einstein: „About Free Will“, in: Ramananda Chatterjee, Hg.: The Golden Book of Tagore. Calcutta 1931:77) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.03.2022 um 06.02 Uhr |
|
Ich hatte schon mehrmals Goethes unübertreffliche Formulierung herangezogen: „Unser Wollen ist ein Vorausverkünden dessen, was wir unter allen Umständen tun werden. Diese Umstände aber ergreifen uns auf ihre eigene Weise.“ Der Behaviorist Goethe ist auch den heutigen mentalistischen Psychologen weit voraus. Sie halten an der Geistmetaphysik fest: „Wie geschieht es, dass unser Körper in aller Regel unserem Willen gehorcht, dass etwa, wenn ich trinken will, sich meine Hände so bewegen, dass sie tatsächlich die Tasse ergreifen und zum Munde führen?“ (Joachim Hoffmann u. a.: „Spekulationen zur Struktur ideo-motorischer Beziehungen“. Zeitschrift für Sportpsychologie 14/3, 2007:95-103, S. 95) „Wir erfahren uns als Agenten, die durch ihr intentionales Handeln Effekte in der Körperwelt herbeiführen können“ usw. (Geert Keil: Kritik des Naturalismus. Berlin, New York 1993:221) Goethes Formulierung vermeidet es, den Willen als die Ursache des Verhaltens darzustellen. Die Dinge geschehen einfach, einschließlich des Ankündigens. Diese Auffassung ist naturalistisch. Es ist merkwürdig, daß Goethe in den begriffsgeschichtlichen philosophischen Handbüchern nicht vorkommt, wohl aber Spinoza, von dem er es haben könnte: „Spinoza sagt (epist. 62), daß der durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtsein hätte, meinen würde, aus seinem eigenen Willen zu fliegen. Ich setze nur noch hinzu, daß der Stein Recht hätte.“ (Schopenhauer) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.03.2022 um 06.44 Uhr |
|
Über die einfältige Neurosophie (Philosophie der Neurologen) ist schon einiges gesagt. „Eine Gesellschaft darf niemanden bestrafen, nur weil er in irgendeinem moralischen Sinne schuldig geworden ist – dies hätte nur dann Sinn, wenn dieses denkende Subjekt die Möglichkeit gehabt hätte, auch anders zu handeln als tatsächlich geschehen“, gibt Biologe Roth zu bedenken. (NZZ 15.7.07) Wieso „darf“ sie das nicht? Woher nimmt Gerhard Roth die Normen, wenn er die Willensfreiheit leugnet? Kann die Gesellschaft – das sind wir alle – doch anders handeln, als wir es tun, wenn wir Verbrecher bestrafen? Über diesen Selbstwiderspruch waren schon die antiken Philosophen hinausgekommen. Wolfgang Prinz erkennt zwar, daß der (freie) Wille ein soziales Konstrukt ist, aber daraus folgt nicht, daß er eine Illusion ist und es den (freien) Willen nicht gibt. Bei solchen Konstrukten stellt sich die Existenzfrage nicht. Kein Libet und keine Kritik an Libet sind relevant, wenn es um rechtliche und moralische Diskussionen geht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.03.2022 um 08.40 Uhr |
|
Der kontemplativen Existenz des Philosophen, insbesondere des Phänomenologen, entspricht folgende Vorstellung von Zeichen und Sprache: Man kann ein Wort aussprechen, und man kann es zusätzlich auch noch meinen, indem man gewissermaßen dem Pfeil, der zunächst ruhig auf dem Bogen ruht, durch die angespannte („intendierte“) Sehne Schwung verleiht. („Damit man sprachlich etwas meinen kann, muß man die Wörter der Äußerung in eine intentional gerichtete Struktur hineinstellen, die ihnen sozusagen Richtung und damit Wucht gibt.“ (Hans Hörmann: Einführung in die Psycholinguistik. Darmstadt 1991:55 - The term ‘intentionality’ derives from a Latin word meaning roughly "to aim" - as one might do with a bow. [David Beisecker: „The importance of being erroneous: prospects for animal intentionality“ (Philosophical Topics, 27,1999:281–308]) So behaupten auch die Phänomenologen das Meinen als inneren, „bedeutungsverleihenden“ Akt zu erleben. In Wirklichkeit ist es umgekehrt: Um das Wort oder ein anderes Zeichen „an sich“ in der Hand zu haben, muß man es aus dem funktionalen Zusammenhang herauspräparieren, den normalen Ablauf gewissermaßen sistieren. Dies ist ein Akt der Verstellung: Ich tue so, als ob ich etwas sage, aber eigentlich spreche ich es nur aus. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.03.2022 um 15.46 Uhr |
|
Auch Eckart Scheerer (in Gerhard Roth/Wolfgang Prinz [Hg.]: Kopf-Arbeit. Gehirnfunktionen und kognitive Leistungen. Heidelberg, Berlin, Oxford 1996), der die Computersimulation als modernste Methode der Psychologie darstellt, sagt, daß die Symbole oder Repräsentationen sich auf die Gegenstände der Außenwelt „beziehen“, und hält am phänomenologischen Begriff der Intentionalität fest. Das Nichtnaturalistische daran wird nicht gesehen und daher nicht diskutiert. Was für eine Beziehung ist dieses „Sichbeziehen“? Und wieso verarbeitet der Computer Symbole oder Zeichen? Dazu werden sie erst durch Interpretation. Die mentalistische Diktion paßt nicht zum technischen Apparat. Elektrische Ladungen usw. passen nicht mit Intentionalität und Zeichenhaftigkeit zusammen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.12.2021 um 06.24 Uhr |
|
How does intentionality arise? How do mental states come to be about anything, or to have semantic properties? Brentano (1874 [1973: 97]) maintained that intentionality is a hallmark of the mental as opposed to the physical: “The reference to something as an object is a distinguishing characteristic of all mental phenomena. No physical phenomenon exhibits anything similar”. In response, contemporary naturalists seek to naturalize intentionality. They want to explain in naturalistically acceptable terms what makes it the case that mental states have semantic properties. In effect, the goal is to reduce the intentional to the non-intentional. (Michael Rescorla https://plato.stanford.edu/entries/language-thought/) (Der Eintrag ersetzt den früheren von Murat Aydede. Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1370#37630) Das ist schief ausgedrückt. Die Naturalisierung, wie ich sie verstehe, erkennt mentale Zustände gar nicht erst an und fragt daher nicht, wie sie semantische Eigenschaften haben können. Das Problem müßte sprachkritisch umformuliert werden: Wie entstehen mentalistische (transgressive) Redeweisen, darunter das Handlungsschema als der Ort, an dem „Absichten“ ihren Platz haben? Daher kommt Rescorla auch nicht zu einer sinnvollen weiteren Bearbeitung der Frage. Die mühsame Beschäftigung mit Fodor usw. ist aus wirklich naturalistischer Sicht weitgehend sinnlos. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.10.2021 um 05.39 Uhr |
|
Ein Satz, dessen Verneinung nicht falsch, sondern sinnlos wäre, ist sinnlos. Jedenfalls als Aussage; er kann immer noch eine Verwendung in der Sprache haben, z. B. den Sprecher auf die Geschäftsordnung der Alltagssprache verpflichten: Ich bin mir meiner selbst bewußt. Es fühlt sich für mich irgendwie an, ein Mensch zu sein. Usw. – Man vereinbart implizit eine bestimmte Redeweise. Falsch wäre es nur, solche Sätze als theoretische zu verstehen und zum Ausgangspunkt anderer theoretischer Aussagen zu machen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.10.2021 um 03.54 Uhr |
|
„Wir erfahren uns als Agenten, die durch ihr intentionales Handeln Effekte in der Körperwelt herbeiführen können“ usw. (Geert Keil: Kritik des Naturalismus. Berlin, New York 1993:221) = Ich kann tun, was ich will. Das ist im Begriff des Wollens oder Willens schon eingeschlossen. Daher die „Erfahrung“, die wie so oft aus der Geschäftsordnung der Sprache herausgesponnen und daher unwiderlegbar, aber auch leer ist. (Mit der Metapher "Geschäftsordnung der Sprache" umgehe ich den problematischen Ansatz der "analytisch wahren Sätze", der bei Nagels Fledermausbeispiel usw. nicht recht zu passen scheint.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.10.2021 um 06.03 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#47200 Besonders die Süddeutsche Zeitung zeichnet sich dadurch aus, daß sie auf der ersten Seite in einem eigenen Kasten fast jeden Tag irgendwelchen Psychologenquatsch verbreitet. Das Referat übernimmt oft Sebastian Herrmann, der auch einschlägige Bücher verfaßt hat. – Heute geht es um "Authentizität", was genauso zu beurteilen ist wie neulich die "Schusseligkeit". Eigentlich schade, man könnte an so prominenter Stelle etwas für die Aufklärung tun. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.10.2021 um 04.34 Uhr |
|
People are more than physical bodies. We are more than dynamic bags of skin that can be seen, heard, and weighed. In the adult framework, persons also have beliefs, desires, and intentions that lie below the surface behavior. One cannot directly see, taste, smell, or hear mental states, but it is an essential part of our ordinary adult understanding that other people have them. Theory of mind research investigates the development of this framework (e.g., Astington & Gopnik, 1991; Flavell & Miller, 1998; Perner, 1991; Taylor, 1996; Wellman, 1990). Where does this tendency to treat others as sentient beings come from? Are we born with a theory of mind? Do we learn it in school? One problem with trying to sort out origins is that most of the test paradigms measure verbal responses. If we want to look at origins of theory of mind or its development in nonverbal populations we need another approach. (Andrew N. Meltzoff: "Origins of theory of mind, cognition and communication" https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3629913/; Ähnlich: Roots of theory of mind and intersubjectivity People are more than dynamic bags of skin that move, manipulate objects, and vocalize. Persons also have beliefs, desires, and intentions that underlie and cause the surface actions. One cannot directly see the underlying mental states, but it is an essential part of our adult understanding of people that others have them. “Theory of mind” research investigates the development of this understanding of other minds (Flavell & Miller, 1998; Perner, 1991; Taylor, 1996; Wellman, 1990). Where does this tendency to treat others as sentient beings come from? Are we born with a theory of mind, naturally attributing mental states to others? Do we learn it in school? (Andrew N. Meltzoff: „The developmental theory of imitation“. In: Andrew N. Meltzoff/ Wolfgang Prinz, Hg.: The Imitative Mind: Development, Evolution and Brain Bases. Cambridge 2012:19-41, S. 30f.) (Ähnlich an weiteren Stellen.) Der Unterschied ist einer der Betrachtungsweise, nicht der Sache selbst: Man kann den Menschen naturalistisch oder mentalistisch betrachten. Die Theory of mind, die Meltzoff den Leuten und ansatzweise schon Säuglingen unterstellt, ist die gleiche Folk psychology, die er selbst auch vertritt. Man kann die „geistigen Zustände“ nicht nur nicht direkt sehen, man kann sie überhaupt nicht sehen, weil es Konstrukte und keine Objekte sind. Meltzoff teilt auch die zur Folk psychology gehörige Ansicht, daß die sichtbaren Handlungen durch die unsichtbaren Absichten „verursacht“ werden. Er sieht das Problem nicht, mit dem sich die Philosophie der Psychologie seit langer Zeit herumschlägt. Der naturalistische („behavioristische“) Verhaltensanalytiker leugnet ja nicht, daß es Intentionen gibt – sonst würde er erkennen lassen, daß er die deutsche bzw. englische Sprache nicht beherrscht. Er betrachtet jedoch die intentionalistische („mentalistische“) Redeweise als Explanandum; er schließt sich begrifflich nicht an sie an und setzt sie nicht in eine Psychologie hinein fort, die wissenschaftlich anschlußfähig sein soll. Zum Argumentationsstil: Der höhnische Unterton („bags of skin“) ist aus der kognitivistischen Mainstreampsychologie bekannt, die sich über den Behaviorismus erhaben dünkt. Man denke an Searles „Wiederkehr des Geistes“: Wir sind doch nicht nur Maschinen! (Im Hintergrund glaubt man ein „verdammt noch mal!“ mitzuhören.) Und so nehmen die Dinge ihren Lauf. Meltzoff, ein weltweit bekannter Spezialist auf diesem Gebiet, handelt a. a. O. von unmittelbarer und aufgeschobener Nachahmung bei Neugeborenen und Säuglingen: sofort werden „Repräsentationen“ eingeführt, als ob dadurch die Nachahmung erklärt werden könnte. Gemeint sind aber nur überdauernde Veränderungen des Organismus. Säuglinge ahmen zu einem gewissen Prozentsatz und bei wohlwollender Interpretation (worauf ich hier nicht eingehen will) auch nach 24 Stunden noch Mundbewegungen nach, die ihnen ein Erwachsener unter gewissen Umständen vorgemacht hat. Das sei nur möglich, weil das Kind die beobachtete Bewegung in sich „repräsentiert“ habe. Das ist nur die Beschreibung des Sachverhalts noch einmal, es ist keine Erklärung, sondern die Illusion einer solchen und eine Vernebelung der wirklichen Vorgänge. Man sollte auch meinen, daß "Repräsentation" doch noch etwas mehr bedeutet als synaptische Veränderungen... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.09.2021 um 08.11 Uhr |
|
Kürzlich wurde über einen Psychologen berichtet, der die "Schusseligkeit" erforscht. Auch das ist kein wissenschaftstauglicher Begriff. Es ging um Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration, aber damit käme man nicht in die Tagespresse.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.09.2021 um 16.15 Uhr |
|
Ich sehe den Unterschied nicht, oder vielmehr: er liegt im Auge des Betrachters. Sonst wäre schon die Brutpflege die Ausnahme. (Meine Frau ist sehr altruistisch, aber das Gebären und die Aufzucht ihrer Töchter würde sie nicht dafür in Anspruch nehmen. Man kann es anders sehen, aber das ist ja gerade das, was ich meine.) Neulich auf der Insel: Am Strand wird eine Möwe von ihrem erwachsenen Kind (noch im Jugendkleid) angebettelt. Nach einer Weile fliegt sie weg und läßt sich nach einigen Kurvenflügen etwa 100 weiter hinter dem Holzschuppen der Strandwacht nieder. Nach etwa zehn Sekunden folgt ihr der Jungvogel und läßt sich genau neben ihr wieder nieder. Dabei war der Landeplatz aus dieser Entfernung schwer zu sehen. Der Beobachter hat den zwingenden Eindruck, daß die Bettelei dem Elterntier lästig geworden war. Aber das ist natürlich hineingedeutet. Das Füttern und die Entwöhnung gehören zum unabänderlichen Lauf der Dinge. (Die Tiere "können nicht anders".) |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 27.09.2021 um 13.59 Uhr |
|
Trotzdem ist ja die Unterscheidung nicht vollkommen überflüssig. Der "Normalfall" ist eben, daß das "eigene" Individuum den Genen als Vehikel dient. Wenn von diesem Schema abgewichen wird, rechtfertigt es meines Erachtens auch einen eigenen Begriff. Man kann das Wort ja in Anführungszeichen setzen, um die moralische Wertung herauszunehmen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.09.2021 um 11.49 Uhr |
|
Gerade wenn man das Verhalten mathematisch modelliert, ist es überflüssig und irreführend, darauf zusätzlich solche menschlichen, gesellschaftlich-wertenden Begriffe anzuwenden. Wie Dawkins (der sich ja immer wieder stark auf Hamilton bezieht) an unzähligen Beispielen zeigt, überleben nur solche Gene, die dafür "sorgen", daß die von ihnen gesteuerten Merkmale und Verhaltensweisen ihre Ausbreitung sicherstellen. Welche Individuen dabei einen "Vorteil" oder "Nachteil" haben (oder "geopfert" werden), ist vollkommen gleichgültig. Wenn sie sprechen könnten, würden manche wohl sagen: "Wir müssen sterben, damit ihr leben könnt" (oder: "Du bist nichts, dein Volk ist alles") – richtig heroisch, aber das ist natürlich Quatsch.
|
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 27.09.2021 um 07.58 Uhr |
|
Was wäre denn eine bessere Begrifflichkeit? Man kann ja nicht grundsätzlich darauf verzichten, den "Altruismusgrad" von Verhalten wissenschaftlich zu beschreiben, siehe Hamiltons Verwandtenselektion.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.09.2021 um 05.45 Uhr |
|
The evolution and psychology of unselfish behavior (Buchtitel) „Altruismus“ usw. sind Bewertungen, keine natürlichen Kategorien. In der Natur gibt es weder Egoismus noch Altruismus, solche Begriffe sind schlicht nicht anwendbar. Selbstloses Verhalten kann sich darum nicht entwickeln. (Dawkins hat längst bereut, vom „selfish gene“ gesprochen zu haben – in der naiven Annahme, man werde ihn schon richtig verstehen.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.08.2021 um 06.17 Uhr |
|
Ich hatte schon Hannes Rakoczy zitiert, einen Schüler Michael Tomasellos. Hier noch ein paar Sätze: Intentionality, in the broad philosophical sense of “aboutness,” is the mark of the mental (Brentano, 1873) and pertains to all content-full mental states, such as perceptions, beliefs, desires, and intentions that paradigmatically we ascribe to individuals. (...) From around their first birthday, human children, and probably only human children, begin to understand others and themselves as persons in a basic sense, as intentionally perceiving and acting in the world, and therefore as potential cooperators. In virtue of this understanding, they enter into forms of joint attention, shared action, and imitative cultural learning—into what can be called the most basic units of collective intentionality and culture. („Play, Games, and the Development of Collective Intentionality“ 53f.) Ich halte "Verstehen", "mentale Zustände", "Intentionen" (hier sogar im neuscholastischen Sinn Brentanos) für überflüssig und sehe nicht, was es zur Erklärung beiträgt. Es geht doch um das Verhalten und seine Entwicklung (Geschichte). Warum nicht bei der Beobachtung bleiben, ohne solche folkpsychologischen Konstrukte? Dann entgeht man auch der sprachlichen Kalamität von "Zuständen über etwas" usw. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.07.2021 um 04.49 Uhr |
|
Die Möglichkeit der Kommunikation ist abgestuft, ebenso die Personhaftigkeit. Manche Autoren ziehen es vor, von Agentivität zu sprechen. „Humans have a tendency to believe in agency (...) An agent is a thing that deliberately does something for a purpose.“ (Richard Dawkins: Outgrowing God 227; mit „deliberately“ und „purpose“ ist die Intentionalität gleich doppelt benannt.) Wie Dawkins ausführt, kann ein Rascheln im Gras der Savanne auf den Wind oder auf einen Löwen hindeuten. Vorsicht ist überlebensdienlich. Mit einem Löwen kann man zwar nicht in einen (wortsprachlichen) Dialog eintreten, man kann aber bis zu einem gewissen Grad mit ihm kommunizieren: ihn täuschen, abschrecken, ablenken. Die Grenze zur vollständigen Personifizierung ist gegenüber höheren Tieren fließend.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.07.2021 um 05.34 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#33544 (Mead) Man könnte von einem „natürlichen Dualismus“ sprechen. Als naiver Dualismus bleibt er eine harmlose Verständigungstechnik, aber Philosophen haben einen theoretischen Dualismus daraus gemacht, und dagegen richtet sich das Naturalisierungsprojekt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.06.2021 um 05.36 Uhr |
|
Ich habe im Haupteintrag Husserl zitiert: Jedes intellektive Erlebnis und jedes Erlebnis überhaupt, indem es vollzogen wird, kann zum Gegenstand eines reinen Schauens und Fassens gemacht werden, und in diesem Schauen ist es absolute Gegebenheit. Es ist gegeben als ein Seiendes, als ein Dies-da, dessen Sein zu bezweifeln gar keinen Sinn gibt. (Edmund Husserl: Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen. Haag 1958:31) An dieser Stelle möchte ich nur darauf hinweisen, daß man im Deutschen nicht sagen kann, ein Erlebnis werde vollzogen. Den fragwürdigen Rest lasse ich mal beiseite. Es ist wie mit den "gerichteten Zuständen" und den "things about things": Was soll man mit Philosophemen anfangen, die schon rein sprachlich verunglückt sind? Es sind Satz-Kandidaten, wie Eschers Treppenzeichnungen Treppen-Kandidaten sind, aber bei näherem Hinsehen stellt man fest, daß Husserl nur Geräusche ohne Bedeutung hervorgebracht hat. Leider wagt das fast niemand auszusprechen, sondern der Kult um die heiligen Schriften der Phänomenologie besteht fort. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.06.2021 um 07.17 Uhr |
|
„Thus, if you physically push me down into a chair I will recognize your intention that I sit down. But if you tell me ‚Sit down‘ I will recognize your intention that I attend to your proposal that I sit down – and if I do sit down it will not be due to physical force but rather because I have changed my intentional states to comply with your proposal.“ (Tomasello) Überflüssige Intellektualisierung; der Preis ist zu hoch: die Absurdität „intentionaler Zustände“, die man auch noch „ändert“ – vielleicht absichtlich? Warum sollte man es nicht auf Tiere ausdehnen? Ich kann den Hund in seinen Schlafkorb tragen oder schieben; ich kann es ihm aber auch befehlen. Die Wirkung des Zeichens erklärt sich aus der Konditionierungsgeschichte. Worte brechen keine Knochen, zusammen mit der Konditionierungsgeschichte können sie aber noch viel Schlimmeres bewirken. |
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 11.06.2021 um 23.46 Uhr |
|
»Als Sprecher habe ich ja nicht die Absicht, das Bewußtsein meines Hörers zu steuern« – es sei denn, Sie sind von der fixen Idee besessen, das generische Maskulinum abzuschaffen, weil Sie glauben, daß es Ihren Hörer um die Chance bringt, die Vorstellung von einer männlich dominierten Welt zu überwinden.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.06.2021 um 19.08 Uhr |
|
Auch Hans Hörmann (Meinen und Verstehen. Frankfurt 1976) spricht ständig von den „Akten“ Meinen und Verstehen. Das Fremdwort ist hilfreich. Ob er Meinen und Verstehen auf gut deutsch als „Handlungen“ bezeichnet hätte? Die „Grundkonzeption“ von Hörmanns eklektischer Kompilation lautet: „Sprache dient dazu, das Bewußtsein des Hörers zu steuern.“ (ebd. 502) Die Mischung aus behavioristischem steuern und mentalistischem Bewußtsein ist bezeichnend. Ob und wie das Bewußtsein gesteuert wird, läßt sich schon rein begrifflich nicht nachprüfen. Auch ist der Standpunkt des Psychologen nicht klar: Als Sprecher habe ich ja nicht die Absicht, das Bewußtsein meines Hörers zu steuern – das wäre allenfalls die Deutung durch einen Beobachter. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.06.2021 um 04.30 Uhr |
|
Personhaftigkeit ist abgestuft. Wir können einem Hund oder einer Katze helfen, aber wir können ihnen nichts schenken, abkaufen, mit ihnen tauschen. Sie haben „Probleme“, d. h. wir schreiben ihnen einen Willen zu; aber kein Eigentum, weil dazu gesellschaftliche Vereinbarungen notwendig wären. Was ist ein „Problem“? „Skinner (1953) defined a problem as a situation in which a response that is highly likely cannot be emitted. For example, a person with a history of opening medicine bottles and having access to aspirin is presented with a problem when encountering a medicine bottle with a novel child-safety lock. Taking an aspirin is highly likely because of other conditions, like an ache in the shoulder, but cannot occur because the medicine bottle will not open.“ (Timothy A. Shahan/Philip N. Chase: „Novelty, stimulus control, and operant variability“. The Behavior Analyst 25, 2002:175-190, S. 183) „Problem“ und „Wille“ sind Konstrukte, die uns bei der alltäglichen, nichtwissenschaftlichen Beschreibung und Deutung des Verhaltens anderer Menschen und in begrenztem, umstrittenem Maße auch der Tiere nützen. So kann man der Katze im „Problem-Käfig“ den Willen zuschreiben, an das Futter zu gelangen, woran sie durch eine Tür gehindert wird. Je näher uns ein Organismus verwandt ist, desto plausibler kommt uns diese Darstellung vor, also bei Vögeln eher als bei Spinnen. Vom behavioristischen Standpunkt ist der „Wille“ für eine Verhaltensanalyse nutzlos, er wird durch die historisch-genetische Herleitung des Problemlösens ersetzt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.06.2021 um 05.47 Uhr |
|
Schon zitiert: „Es wäre absurd anzunehmen, daß es für einen Hund nicht irgendwie ist, an seinem Lieblingsknochen zu nagen.“ (Michael Tye in Thomas Metzinger, Hg.: Bewußtsein. Beiträge aus der Gegenwartsphilosophie. 2. Aufl. Paderborn u.a. 1996:108f.) Wenn man darüber nachdenkt, könnte man den Verstand verlieren. Freilich kann man schlecht annehmen, daß es für den Hund nicht irgendwie ist. Gleichzeitig fühlt man eine gewisse Leere. Die positive Aussage, daß es für ihn irgendwie ist, läßt uns ratlos zurück, weil wir nicht sagen können, wie es für ihn ist. „Irgendwie“ ist nur die leere Form. Der Vordruck der Steuererklärung ist keine Steuererklärung. Der Nagelsche Satz, hier in Tyes Fassung, ist nur das Bekenntnis zum Gebrauch der Erlebnissprache, aber nicht theoretisch behauptet, sondern durch die leerstmögliche Form exemplifiziert. Wenn man annimmt, daß die Erlebnissprache (selbstverständlich!) eine auf den sprachfähigen Menschen beschränkte Verständigungstechnik ist, nämlich das Konstrukt des Geistes, die transgressive Rede von einem radikal privaten Inneren, dann ist es nicht absurd, sie dem Hund abzusprechen. Nicht daß er keine Erlebnisse hat, sondern daß es keinen Sinn hat, ihm Erlebnisse zuzusprechen. Die ganze mentalistische Diktion findet hier keine Anwendungsmöglichkeit. Bezeichnend sind Platzhalter wie "so", "irgendwie" usw. Man erkennt daran, daß es sich nicht um Aussagen, sondern sozusagen um Vorlagen für Aussagen handelt. Carsten Siebert spricht in seiner Dissertation vom "factum brutum: daß es sich jetzt so anfühlt, ich zu sein." (Qualia. Berlin 1998:194) Na, wie denn? Vergebliche Frage. Und ebenso in Hunderten von Varianten der Nagelschen Formel. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.05.2021 um 05.49 Uhr |
|
Meine Bemühungen um einen naturalistische (behavioristische) Zeichentheorie und Sprachtheorie stehen seit Jahrzehnten unter dem Motto "die Zaubersprüche ganz und gar verlernen". Die Magie, die Faust von seinem Pfad entfernen will, ist der Mentalismus, und zwar keineswegs nur analog oder metaphorisch. Auch die "Natur" im nächsten Vers ist wörtlich zu verstehen, daher ja auch "Naturalismus". Das "intentionale Idiom" ist magisch. Daher "Wiederentdeckung des Geistes" usw. – sie machen ja gar kein Hehl daraus, auch wenn sie den Geist nun "Mind" nennen. Reden als Geisterbeschwörung... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.05.2021 um 06.52 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#34999 Viele glauben ja immer noch, mit Begriffen wie "Ursache", "Kausalität" im Bereich der Physik zu sein, während "Zweck", "Sinn" usw. dem Geist zugeordnet sind. Das halte ich aus den angegebenen Gründen für falsch, vgl. auch: Im übrigen jedoch kommen Begriffe wie „Ursache“, „Wirkung“, „kausal“ usw. in einer theoretisch entwickelten Wissenschaft wie der Physik praktisch nicht vor. (Lorenz Krüger in ders., Hg.: Erkenntnisprobleme der Naturwissenschaften Köln/Berlin 1970) "Ursache" ist ein mentalistisches Konstrukt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.05.2021 um 17.08 Uhr |
|
Genau, und das ist auch eines meiner Hauptargumente: Aus Empfängersicht sind Zeichen und Anzeichen nicht zu unterscheiden. Der Blitz geht dem Donner voraus, das Aufleuchten der Bremslichter der Verlangsamung des Autos. Nur aus der historisch-genetischen Sicht des Beobachters wird der grundlegende Unterschied erkennbar. Die übliche Semiotik der "Symptome" verzichtet auf die Unterscheidung, darum entgeht ihr etwas Wesentliches. Wirkliche Zeichen sind durch empfängerseitige Semantisierung entstanden oder – beim sprachfähigen Menschen – durch ausdrückliche Vereinbarung bzw. Verordnung, ein abkürzendes Verfahren des Homo docens. Bei bloßen Symptomen ist das nicht der Fall, darum rechne ich sie nicht zu den Zeichen. S. Stichwort "Zeicheninflation". |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 17.05.2021 um 11.05 Uhr |
|
Dies ist sozusagen die Sicht des Zeichengebers, da besteht ein Unterschied zwischen dem Verkehrszeichen (das Zeichen als statisches Objekt) und Polizist (das Zeichen als Verhalten). Anders ist es auf der Empfängerseite, für den Zeichenleser entfällt dieser Unterschied, es spielt keine Rolle, ob das Zeichen schon lange da steht oder unmittelbar gegeben wird. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.05.2021 um 07.47 Uhr |
|
Der Arbeiter, der auf Anweisung der Behörde ein Stoppschild aufstellt, kommuniziert nicht mit den Verkehrsteilnehmern. Das Zeichen ist für ihn ein physisches Objekt, sein Umgang damit hantierend. Anders, wenn der Polizist dem nahenden Autofahrer die Kelle entgegenhält. Er „will“ den Autofahrer zum Halten bringen. Die Episode ist für den Polizisten damit beendet, daß der Autofahrer anhält. Der Arbeiter lebt in anderen Zusammenhängen und interpungiert anders: Das Verkehrszeichen soll an der richtigen Stelle und standfest angebracht werden. Damit endet die professionelle, handwerkliche Episode. Immerhin „will“ die Behörde etwas von den Autofahrern, während der Straßenarbeiter nichts von ihm will. „Halten Sie an!“ – das kann durch Hochhalten der Kelle ersetzt werden, dauerhaft durch Aufstellen eines Stop-Schildes. - Der Linguist und der Sprachlehrer ähneln dem Arbeiter, was den „handwerklichen“ Umgang mit Sprachmaterial betrifft. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.05.2021 um 17.32 Uhr |
|
Aus dem vorigen greife ich eine Einzelheit heraus, um die Aufgabe einer naturalistischen Sprachwissenschaft zu verdeutlichen: Jemand macht ein Geräusch, und ich weiß, daß er morgen nach Nürnberg fahren wird. Wie ist das möglich? Herrchen geht in die Garderobe, zieht den Mantel über und greift zum Regenschirm. Bello "weiß", daß Gassigehen angesagt ist, d. h. er schließt sich schwanzwedelnd an. Wie ist das möglich? (Jenes Geräusch könnte man so transkribieren: "Ich fahre morgen nach Nürnberg." Die Wirkung muß aber erklärt werden.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.05.2021 um 08.41 Uhr |
|
Vorzeichen (Omina) sind Ereignisse, die physisch als erste Phase eines anderen Ereignisses oder zeichenhaft als Hinweise auf ein solches Ereignis verstanden werden. In beiden Hinsichten schließt die Nutzung an lebenswichtige alltägliche Verfahren an. Allgemein verbreitet ist die Wettervorhersage aus den beobachtbaren Wetterdaten. Nicht nur Wolken und andere meteorologische Erscheinungen werden beachtet, sondern zum Beispiel auch das Verhalten von Tieren (Schwalben) und Pflanzen (Kiefernzapfen). Die ausdrückliche Ankündigung ist ein Vorzeichen des angekündigten Ereignisses oder Verhaltens. Wenn jemand ankündigt, was er tun wird bzw. will, ist die Ankündigung aus naturalistischer Sicht eine vorgeschaltete Phase des Gesamtverhaltens (eines realen Bestandssystems), dessen Abschluß dann das angekündigte Verhalten ist. Wie Blitz dem Donner vorhergeht, so die Ankündigung dem abschließenden Verhalten. Vorzeichen sind Vorphasen. Der Aberglaube vermutet Bestandssysteme, entweder physischer Art oder zeichenhaft vermittelt durch eine unterstellte personale Macht, deren Absicht durch Orakelpriester, Auguren usw. entschlüsselt werden kann. Der Mensch lernt, einen Spaziergang nicht mit dem ersten Schritt zu beginnen, sondern mit der Ankündigung: „Ich gehe jetzt spazieren.“ Darauf könnte ein Partner anworten: „Nimm den Regenschirm mit.“ Oder: „Warte einen Augenblick, ich komme mit.“ Das Sprachverhalten, das wir als „Ich gehe jetzt spazieren“ transkribieren, wird divinatorisch als Vorzeichen, d. h. als erste Phase eines Spaziergangs gedeutet. Würfeln, Kartenlegen, Würfe von Schafgarbenstengeln, Blutfluß von Opfertieren, Sprünge in erhitzten Schildkrötenpanzern oder Knochen, Kaffeesatz usw. sind „aleatorische“ Verhaltensweisen, die dem Zufall und damit dem vermuteten Eingreifen übersinnlicher Mächte Raum schaffen. Auch unbestimmte Analogie wird angenommen, eine Entsprechungslehre neben der (oft verborgenen) Kausalität. So spiegelt sich der Makrokosmos im Mikrokosmos, ohne daß die Natur dieser Entsprechung genauer bestimmt werden müßte: Der menschliche Körper soll in der Ohrmuschel, auf den Fußsohlen, in der Handfläche, im Gesicht oder in der Iris „abgebildet“ sein, was bestimmte Behandlungsweisen ermöglicht. Auch die Handschrift soll mit ihren drei Bändern (Kopf, Herz, Bauch in ihrer volkstümlichen Deutung als Verstand, Gefühl, Trieb) dem Körper entsprechen und Charakter- oder Schicksalsdiagnosen ermöglichen. Die Kirchen lehnen Wahrsagerei ab, aber aus den falschen Gründen: Hybris gegenüber Gott. So haben die Kirchen auch die Hexerei nicht bezweifelt, sondern verboten. Christen, jedenfalls katholische, sind auch verpflichtet, an Wunder zu glauben; im Heiligsprechungsprozeß werden sie indirekt bewiesen. Böse Geister werden im Exorzismus vertrieben, dem Teufel wird bei der Taufe abgeschworen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.04.2021 um 04.49 Uhr |
|
Der Fliehkraftregler, der Thermostat, die Mausefalle sind „teleologische Maschinen“ – aber nur in Verbindung mit weiterer Hardware (Dampfmaschine, Heizkörper, Maus). Für sich genommen kann man sie noch so eingehend studieren, sie werden zwar ihren artifiziellen Charakter verraten, nicht aber ihre Funktion als Steuerungsgeräte. Sie wären sozusagen Maschinen-Kandidaten (wie die sinnlosen Apparate mancher modernen Künstler, die damit spielen).
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.04.2021 um 08.19 Uhr |
|
Noch einmal zu Thomas Nagel: Eine Soziologie, die sich mit der Feststellung begnügt, daß alle Menschen irgendwie leben, ist noch nicht sehr weit fortgeschritten. Von dieser Art ist die vielbestaunte Formulierung, daß es sich für mich irgendwie anfühlt, ein Mensch, ein Mann, Theodor Ickler ... zu sein. Es ist, als wolle man Erika Mustermann eine Summe auf ihr Musterkonto überweisen. Formal scheint alles in Ordnung, aber in Wirklichkeit kommt nichts voran. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.03.2021 um 04.18 Uhr |
|
Der Begriff der Intentionalität im "phänomenologischen" Sinne von Bezüglichkeit, Referenz geht auf die gleiche Metaphorik zurück wie Husserls "Blickstrahl" mit seiner antikisierenden Naivität. Bedeuten ist ein "Wollen", Meinen ist ein Zielen wie mit Pfeil und Bogen. Dazu https://plato.stanford.edu/entries/intentionality-ancient/ (von Victor Caston, ausgezeichneter Text!). Daraus: In Plato’s Cratylus (420b–c), Socrates suggests that the word for belief, doxa, derives etymologically from the word for bow, toxon: it “goes toward” each thing and how it is in reality. Socrates then extends this analysis to the vocabulary for deliberative states: the word for plan, boulē, for example, derives from the word for shot, bolē. The metaphor is repeated again in the Theaetetus (194a): someone who believes falsely is “like a bad archer who, in shooting, goes wide of the mark and errs”. ‘δόξα’ δὴ ἤτοι τῇ διώξει ἐπωνόμασται, ἣν ἡ ψυχὴ διώκουσα τὸ εἰδέναι ὅπῃ ἔχει τὰ πράγματα πορεύεται, ἢ τῇ ἀπὸ τοῦ τόξου βολῇ. ἔοικε δὲ τούτῳ μᾶλλον. ἡ γοῦν ‘οἴησις’ τούτῳ συμφωνεῖ. ‘οἶσιν’ γὰρ τῆς ψυχῆς ἐπὶ πᾶν πρᾶγμα, οἷόν ἐστιν ἕκαστον τῶν ὄντων, δηλούσῃ προσέοικεν, ὥσπερ γε καὶ ἡ ‘βουλή’ πως τὴν βολήν, καὶ τὸ ‘βούλεσθαι’ τὸ ἐφίεσθαι σημαίνει καὶ τὸ ‘βουλεύεσθαι’: πάντα ταῦτα δόξῃ ἑπόμεν᾽ ἄττα φαίνεται τῆς βολῆς ἀπεικάσματα, ὥσπερ αὖ καὶ τοὐναντίον ἡ ‘ἀβουλία’ ἀτυχία δοκεῖ εἶναι, ὡς οὐ βαλόντος οὐδὲ τυχόντος οὗ τ᾽ ἔβαλλε καὶ ὃ ἐβούλετο καὶ περὶ οὗ ἐβουλεύετο καὶ οὗ ἐφίετο. (Platon Kratylos 420) (Der Text veranschaulicht auch das wilde Etymologisieren, das Platon nicht nur mit allen antiken Autoren teilt, sondern mit der gesamten gelehrten Welt bis etwa 1800: Je mehr Anklänge an andere Wörter, desto besser!) Mehrmals wird also das Intendieren durch das Bogenschießen verbildlicht. intendieren, Intention übersetzt griechisch enteino, Entasis – das Anspannen der Bogensehne. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.02.2021 um 07.14 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#39108 Das "treffende Wort" der traditionellen Psychologie ist aus naturalistischer Sicht eigentlich das "getroffene Wort". Die Umstände wählen es aus, und dann wird es artikuliert, bricht sozusagen aus dem Organismus hervor. Vgl. auch http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#29449 |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.02.2021 um 07.10 Uhr |
|
Aristoteles sagt, für viele Leser überraschend, daß ein Leichnam kein Körper im eigentlichen Sinn mehr ist, sondern nur „homonym“, ähnlich einer Statue, die ja auch kein Mensch ist. Eine recht gute Diskussion hier: https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-psychology/suppl1.html Ich möchte meine Interpretation ohne das ganze Umfeld des „Hylomorphismus“ so formulieren: Der Körper ist auf die Beseelung, also das Leben hin eingerichtet. Wenn er tot ist, fehlt diese Funktion, darum ist er nur „homonym“ als Körper zu bezeichnen. Eine Attrappe oder eben Statue ist in diesem Sinne vergleichbar. Die Leiche sieht nur noch so aus wie ein Körper, aber die Ausrichtung der Teile auf einen Zweck ist verloren. Eine Maschine im Deutschen Museum ist in diesem Sinn keine Maschine mehr, ein Götterbild im Museum ist kein Götterbild mehr (und ein Kruzifix an Söders Wand ist kein Kruzifix mehr, es fällt jetzt unter den neuen Oberbegriff Wandschmuck). Ein Bauernschrank im Heimatmuseum ist kein Schrank als Möbel, eine alte Sense ist dort kein Werkzeug, sondern es sind eben Ausstellungsstücke. Wenn der Oberbegriff wechselt, stimmt die alte Definition nicht mehr, daher spricht Aristoteles mit Recht von „Homonymie“. Die belebte Materie wirft die Frage auf, was eigentlich das Leben ausmacht. Früher konnte man nicht anders, als irgend etwas Belebendes anzunehmen, das Aristoteles „Seele“ nennt, aber nicht als Substanz auffaßt, die beim Tod entweicht und eventuell unsterblich ist. „Lebenskraft“ wäre auch passend. Wenn man die Entwicklungsgeschichte abtrennt oder nicht kennt, kommt man zur Entelechie, der teleologischen Geformtheit. Man könnte auch sagen „Funktionalität“. Aus synchronischer Sicht drängt sich der Eindruck auf, daß Organismen auf ihr Funktionieren hin angelegt sind. Zweckmäßigkeit ohne Evolution ist ein Wunder. Zwei Tauben, die Pingpong spielen, sind ein Wunder. Skinner führt vor, daß das Shaping rund 20 Minuten dauert. Ein Bär, der mit dem Fahrrad durch die Manege fährt, ist ein Wunder und lohnt die Zirkuskarte. Die Dressur dauert etwas länger, aber wenn man sie kennt, ist es kein Wunder mehr. Das Radnetz einer Spinne ist ein Wunder, die Phylogenese dauerte wahrscheinlich Millionen Jahre, aber heute kennen wir sie und können das Wunder erklären, so daß es keins mehr ist. Ohne Evolutionslehre kann man nur staunend vor der inhärenten Zweckmäßigkeit oder Funktionalität der Organismen stehen. Die Option eines Schöpfungsglaubens stand nicht mehr offen. „Inhärente Zweckmäßigkeit“ ist wörtlich dasselbe wie „Entelechie“, der Begriff, den Aristoteles dafür erfunden hat. Er hat sich mit der Auflösung in „Geschichte (Evolution)“ erübrigt. |
Kommentar von Theodor Ickkler, verfaßt am 02.02.2021 um 10.28 Uhr |
|
(Fortsetzung) „Unter animus oder anima versteht Augustinus (weitgehend austauschbar) dasjenige im Menschen, was dessen kognitive, perzeptive, affektive, volitionale, appetitive, memoriale und imaginative Leistungen ermöglicht.“ (Christoph Horn in Crone et al., hg.: Über die Seele. Berlin 2010:78) Man sieht hier, wie ein spätantikes psychologisches Konstrukt mit Begriffen erläutert wird, die einem als selbstverständlich vorausgesetzten modernen Konstrukt entnommen sind. Die sieben Adjektive entsprechen ebenso vielen „Vermögen“ einer traditionellen neuzeitlichen Auffassung, die inzwischen allerdings mehr wissenschaftsgeschichtliches Interesse weckt, als daß sie von der Wissenschaft selbst noch ernst genommen würde (soweit man das angesichts der Aufsplitterung in unzählige Schulen noch sagen kann). Das Vorgehen ist völlig naiv. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.01.2021 um 10.49 Uhr |
|
Dorothea Frede rekonstruiert sehr einsichtsvoll die Psychologie des Aristoteles, weist auch auf die Unvereinbarkeit mit unseren heutigen Vorstellungen hin: Aristoteles hat nicht einmal einen Begriff wie „Wille“ und braucht ihn auch nicht, weil in den intellektuellen Tätigkeiten eine „voluntative“ Komponente enthalten sei. So ähnlich sieht es auch Kurt Danziger („Naming the mind“), der ein Fehlen der „Motivation“ feststellt, heute ein Grundbegriff der Psychologie, weil wir die intellektuellen Fähigkeiten als rein logische Maschine abgetrennt haben und dann natürlich etwas brauchen, was Einsichten in Absichten überführt und dann das Handeln antreibt. Die genannte Rekonstruktion hat immer etwas Gewaltsames, so wenn der bouleusis ein „propositionaler Gehalt“ zugeschrieben wird, „wie man es heute nennt“. Aber was nennt man heute so? Das ist ja nicht ein Etwas, das unabhängig existiert, sondern Teil unserer heutigen, ganz andersartigen Konstruktwelt. Vergleichbare wäre die Funktion im Handlungsdialog, besonders im forensischen, aber die müßte erst untersucht werden. Aristoteles greift bei seinen Analysen, die im wesentlichen synonymische Studien sind, auf den Sprachgebrauch zurück, aber gerade dieser ist schlecht dokumentiert und wird in der Aristoteles-Literatur nur gelegentlich herangezogen. Das gilt vor allem für den Alltagssprachgebrauch, nicht für die gut erforschte Literatur. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.01.2021 um 10.36 Uhr |
|
Knackig wie immer: Self-knowledge or awareness emerges when one person asks another such a question as: "What are you going to do?" or "Why did you do that?" (Skinner in Catania/Harnad S. 13) Also im Deliberations- und im Rechtfertigungsdialog, s. Haupteintrag. Das ist sozusagen die Ursituation, um die sich alles dreht (wenigstens meine ganze Theorie). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.01.2021 um 06.08 Uhr |
|
Kann man gegen seine eigenen Interessen handeln? Wenn man mit der Entlarvungspsychologie danach fahndet, findet man immer das egoistische Motiv. Der Wille ist aber aus begrifflichen Gründen frei, folglich kann man gegen seine Interessen handeln, das ist bereits sprachlich angelegt. Ich kann aus begrifflichen Gründen etwas tun, was ich nicht will, weil ich alles tun kann, was du willst. Ich will es „eigentlich“ nicht, tue es aber trotzdem. Nur Philosophen konstruieren das Problem, ob man etwas tun kann, was man nicht will. Die alltagspsychologischen Begriffe sind dafür nicht ausgelegt. „etwas gegen seinen Willen tun“ ist eine sprachliche Wendung, die ihren guten Sinn hat, auch wenn Philosophen es uns auszureden versuchen. Die Alltagssprache schließt keine Theorie ein, die man widerlegen könnte oder beweisen müßte, sondern ist einfach eine Praxis zur Bewältigung bestimmter Aufgaben und zur Abstimmung mit anderen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.01.2021 um 19.23 Uhr |
|
Das ist mir schon klar, aber habe ich irgendwo "nur" gesagt? Das sollte mir leidtun, denn es steckt doch etwas mehr dahinter. Bewußtsein, Subjektivität, Erlebnis usw. sind ganz junge Begriffe, und bisher hat niemand erklären können,warum das, was angeblich jedermann unmittelbar gegeben ist, die vermeintliche private Welt in uns selbst, so spät „entdeckt“ worden ist. Die Auskunft, so sei das eben mit Dingen, die uns allzu vertraut sind, überzeugt mich nicht. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 17.01.2021 um 18.24 Uhr |
|
Haben Sie nicht auch Ihre feste Voraussetzung? Sie sehen das Bewußtsein von vornherein nur als sprachliches Konstrukt. Ich denke, genau das ist es aber nicht.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.01.2021 um 05.24 Uhr |
|
Wenn man das Bewußtsein immer schon voraussetzt und nur noch fragt, warum die Natur es geschaffen hat, ist alles schon entschieden. Man steht dann in der Tradition der naiven Psychologie, wie ich es (rein deskriptiv) nenne. s. auch hier http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1106#43105 und unsere frühere Diskussion ebd. Dazu meinen Haupteintrag oben; ich kann es nicht jedesmal wiederholen. Es handelt sich nicht um eine Tatsachenfrage, sondern um Begriffskritik, Sprachkritik... Aber ich weiß, wie schwer es ist, sich von der scheinbar "letzten Gewißheit" (das ist mein Titel dafür) zu lösen: Das Bewußtsein gibt es doch, verdammt noch mal! Das eigene Erleben ist doch "schlicht gegeben" (so die Formel der Phänomenologen)! Ich halte dagegen: Die Allgemeinsprache gibt es zweifellos mit ihren psychologischen Konstrukten (Fiktionen), ihrer "Geschäftsordnung". Aber sie funktioniert nicht so, wie die naive Psychologie und Philosophie es will. Sehr gut wie immer Peter Hacker (The sad and sorry history of consciousness...) |
Kommentar von Ivan Panchenko, verfaßt am 16.01.2021 um 23.40 Uhr |
|
Ich kann mir etwas unter einem unfreien Willen vorstellen: Man hat die Absicht, etwas zu tun, aber diese Absicht ist einem Zwang geschuldet, zum Beispiel einer Strafandrohung. Nun ist Freiheit ein relativer Begriff, bei dem der Bezugspunkt (frei WOVON?) oft nicht extra genannt wird, wobei unterschiedliche Sprecher unterschiedliche Bezugspunkte nehmen können (vgl. unsere Diskussion über Modallogik); ich schreibe diesen Beitrag hier „frei“willig, könnte man sagen, tatsächlich schreibe ich ihn aber nur aufgrund der Diskussion hier. Die Frage, ob der Mensch vielleicht eine Marionette seines eigenen Körpers ist, erscheint mir recht konfus, denn natürlich tut ein Mensch genau das, was er tut; von Willens„freiheit“ kann die Rede sein, weil es um die Freiheit von etwas Bestimmtem (implizit) geht. Damit ist die Sache für mich auch schon abgefrühstückt, ganz ohne Hirnforschung. Jetzt könnte man sich noch fragen, was mit Wille gemeint ist. Vielleicht helfen diese sprachanalytischen Betrachtungen weiter: https://reducing-suffering.org/why-free-will-is-not-an-illusion/ https://reducing-suffering.org/dissolving-confusion-about-consciousness/ (Zugegebenermaßen verwirrt mich das Thema Qualia immer noch.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.01.2021 um 21.36 Uhr |
|
Was heißt, nicht lebensnotwendig? Das Bewußtsein wäre dann noch nicht einmal notwendig, um vernünftig zu handeln wie ein Mensch. Wir würden ohne das nutzlose Bewußtsein genauso leben und handeln, wie jetzt, wir würden sogar über den freien Willen und das Bewußtsein diskutieren wie jetzt, nur daß es tatsächlich kein Mensch bemerken würde, niemandem wäre diese Diskussion bewußt. Ich wüßte nicht, daß ich dies schreibe. Aber es kommt mir doch so vor, als wüßte ich es. Dann muß das Bewußtsein für irgendetwas doch gut und notwendig sein, sonst hätte es die Evolution nicht geschaffen. Wofür ist es notwendig? |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.01.2021 um 18.33 Uhr |
|
Ein unfreier Willen wäre genaugenommen ein Widerspruch in sich, nicht vorstellbar, ebenso wie ein freier Willen eigentlich eine Tautologie ist. Aber man darf m. E. diese Ausdrücke nicht allzu wörtlich nehmen, sondern so, wie sie gemeint sind. Ein unfreier Willen wäre für mich etwas, das nur scheinbar mein Willen ist, sich wie mein Willen anfühlt, aber keiner ist. Ich hätte die Illusion, genau das zu denken und zu tun, was ich in meinem Bewußtsein selbst bestimme. Ich würde mich darin irren zu glauben, daß ich Herr meiner Gedanken und meines Tuns bin. Letztlich würde es bedeuten, daß der Mensch eine Marionette ist, gesteuert von zufälligen Teilchenbewegungen. Das Bewußtsein wäre nichts als eine nutzlose Attrappe, nicht lebensnotwendig. Das widerspricht all meinen Erfahrungen und Anschauungen, ich finde, es wäre eine sehr pessimistische Sichtweise. Irgendwie muß das Bewußtsein bestimmte Gehirnfunktionen steuern, d.h. auf die Materie zurückwirken können. Ich weiß, das klingt ein bißchen märchenhaft, aber liegt die umgekehrte Richtung, wie Materielles überhaupt bewußt werden kann, die Entstehung eines Bewußtseins, nicht noch genauso im dunkeln? Dennoch zweifelt an dieser Richtung niemand. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.01.2021 um 16.46 Uhr |
|
Aus sprachkritischer Sicht gibt es viele Probleme, die sich aufgelöst haben oder auflösen lassen, ohne gelöst zu werden – weil letzteres gar nicht möglich ist ("Scheinprobleme"). Sie lassen sich natürlich auch nicht wissenschaftlich formulieren und dann lösen. Wissen wir wirklich, was mit der Frage nach dem freien Willen gemeint ist? Ich glaube zu wissen, wie solche Fragen aufkommen, aber nicht, was damit gemeint ist. Können Sie sich einen unfreien Willen vorstellen? |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.01.2021 um 14.48 Uhr |
|
Über die Frage des freien Willens haben sich ja schon lange Philosophen und Naturwissenschaftler den Kopf zerbrochen. Sie alle und auch wir wissen, was damit gemeint ist. Dann muß es doch eine Möglichkeit geben, dieses Problem in wissenschaftliche Worte zu fassen, statt einfach zu sagen, es existiert gar nicht. Steuert der Mensch sein Denken und Handeln selbst oder registriert er nur die rein physikalischen Bewegungen der materiellen Teilchen seines Körpers und hält das irrtümlich für das Ergebnis eigenen, bewußten Denkens? Denken und entscheiden wir selbst, haben wir die Möglichkeit, so oder anders zu handeln, oder ist jede Bewegung unabhängig vom Bewußtsein vorbestimmt, wir haben in Wahrheit gar keine Wahl? Denkt und entscheidet etwas Unbewußtes in uns? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.01.2021 um 10.55 Uhr |
|
Zu einem Aufsatz von Eddy Nahmias: https://www.eddynahmias.com/wp-content/uploads/2015/01/Nahmias-Free-Will-in-Scientific-American-2015.pdf dt. in Spektrum Spezial: Neue Fronten der Hirnforschung: Wie frei ist der Mensch? Zusammenfassung: Wollen oder Müssen 1. Die meisten sozialen Institutionen beruhen auf moralischen und rechtlichen Regeln, die voraussetzen, dass Menschen einen freien Willen besitzen. 2. In den letzten Jahrzehnten haben raffinierte Experimente ergeben, dass das Gehirn bereits Aktivität zeigt, bevor uns bewusst wird, dass wir eine Entscheidung gefällt haben. Das scheint die Willensfreiheit in Frage zu stellen. 3. Vermutlich ist unser Wille weniger frei, als wir meinen. Aber das bedeutet nicht, er existiere überhaupt nicht. Wie sozialpsychologische Versuche demonstrieren, haben bewusste Überlegungen und Intentionen einen deutlichen Einfluss auf unsere Handlungen. (S. 79) Eine solche Frage kann man nicht durch Versuche oder überhaupt durch Forschung beantworten. Wer die gesamte folkpsychologische Begrifflichkeit von bewußtem Denken, Intentionalität, Wille, Entscheiden usw. übernimmt, kann damit nicht die Willensfreiheit widerlegen oder beweisen. Daß man sich entscheiden kann, braucht nicht bewiesen zu werden, es ist mit Begriffen wie „Entscheidung“ schon gegeben. Natürlich ist der Mensch nicht „willenlos“ (außer gerade in Ausnahmefällen wie Ohnmacht oder unter Anästhesie oder Drogen). Nahmias’ Aufsatz ist von keiner Sprachkritik berührt und hat eigentlich keinen Sinn. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.12.2020 um 05.53 Uhr |
|
Es ist schwer, einer Wespe nicht die Absicht oder den Willen zu unterstellen, aus dem Glas herauszukommen oder aus dem Zimmer, wenn sie an der Fensterscheibe nach einem Ausweg „sucht“ und dabei immer „wütender“ wird. Bei höheren Tieren ist es noch schwerer, den naturalistischen Blick beizubehalten. Das Verhalten der Katze im „Problemkäfig“ können wir kaum anders als in menschlichen Begriffen beschreiben. Der Naturalismus geht umgekehrt vor, er will auch menschliches Verhalten ohne Begriffe wie Wille, Absicht usw. beschreiben und erklären. Das führt nicht zu einer neuen Psychologie, sondern eben zur Verhaltensanalyse, die an andere Naturwissenschaften anschließbar ist. Der Grund des sogenannten Suchverhaltens liegt für sie nicht im zukünftigen Ziel, sondern in der vergangenen Konditionierung bzw. phylogenetisch in der kumulativen Selektion. Paradoxerweise vermenschlichen wir die Tiere nicht mehr so naiv wie früher, behandeln sie aber zugleich „humaner“. Man denke an Hunde oder Pferde, die früher auf offener Straße tatsächlich geschlagen wurden. Zum Ertränken überzähliger Katzen nahm man die Kinder mit, ganz zu schweigen von den öffentlichen Hinrichtungen und den stets wohlbesetzten Galgen in jedem Städtchen (vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=783#34862). Die indischen Hundefänger habe ich schon erwähnt (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1572#23901); so etwas würden wir auf unseren Straßen nicht dulden. Die Schrecknisse der Massentierhaltung widersprechen diesem Befund nicht, denn die sperren wir ja gerade darum weg, weil wir nicht sehen wollen, wo das Schnitzel herkommt. Auch Krankheit und Tod sperren wir weg, und nur der Weitgereiste weiß noch, daß es auch anders gemacht werden kann. Man muß eben zu der Art, wie die Leute reden, immer hinzufügen, was sie wirklich tun. (Das Studium antiker Texte muß durch Realienkunde ergänzt werden.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.12.2020 um 17.53 Uhr |
|
In Maschinen ist die Funktion hineinkonstruiert, sie lassen sich daher so betrachten, als hätten sie sich angepaßt. Man betrachtet aber eher die Lebewesen, die sich wirklich angepaßt haben, so, als seien sie konstruiert (Kreationismus). Dennett bezeichnet Pflanzen als intentionale Maschinen sehr niedrigen Grades. Aber wozu? Anpassung genügt doch, man braucht kein Als-ob. Heuristisch kann man fragen: Wozu ist das gut? Aber das ist eine unnötige Umschreibung. Nur weil wir die Entwicklungsgeschichte meistens nicht kennen, ist doch der historisch-genetische Blick möglich und ausreichend. Früher glaubte man, daß der Apfel zur Erde fällt, weil er das Bestreben in sich hat, an seinen natürlichen Ort zu gelangen. Erde ist unten, darüber das Wasser, darüber die Luft. In begrenzten Bereichen ist das immer noch brauchbar. Besser, weil allgemeingültiger ist es aber, die Schwerkraft anzusetzen und dann auch in die Dinge hineinzusehen – eine Frage der Gewohnheit. Der Apfel und die Erde ziehen einander an. Ein Trägermedium für das Licht? Warum nicht – aber besser geht es ohne „Äther“. Das geozentrische Weltbild ist nett und im Alltag nützlich, aber das heliozentrische ist mathematisch einfacher und dynamisch unendlich plausibler. Geist ist auch hübsch, aber Verhaltensanalyse ist besser. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.12.2020 um 04.58 Uhr |
|
Ein digitaler Sprachassistent kann Pizza bestellen und wortreich über sie reden, aber wie sie schmeckt, weiß er nicht. Dass sich diese Mängel durch noch mehr Trainingsdaten beheben lassen, bezweifeln Drössers Gesprächspartner. (FAZ 3.12.20; Wolfgang Krischke in einer Besprechung von Christoph Drösser: „Wenn die Dinge mit uns reden“. Von Sprachassistenten, dichtenden Computern und Social Bots. Berlin 2020) In einer naturalistischen Zeichentheorie entfällt auch diese Besonderheit des Menschen: das Paradiesgärtlein des „phänomenalen Bewußtseins“, der „Subjektivität“. Es ist ja eigens zu dem Zweck konstruiert, uns einen unerklärbaren Rest zu erhalten. Natürlich kann auch ein Computer lernen, vom Geschmack einer Pizza zu reden. Dann dürfte es schwerfallen, ihm jenes „Wissen“ abzusprechen. Die Phänomenologen (bis hin zu Thomas Nagel) werden darauf bestehen, daß es nicht nur ums Reden geht, sondern um das subjektive Erleben usw. – eine Petitio principii. Gegen diese Behauptung einer letzten Gewißheit (meiner Ansicht nach in Wirklichkeit die "Geschäftsordnung der Sprache", die mit einem "Geschäft" verwechselt wird) kann kein Argument etwas ausrichten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.10.2020 um 08.59 Uhr |
|
Bei Dennett gibt es einen tiefen Widerspruch in seinem bekannten Intentionalitätskonzept. Einerseits sagt er ausdrücklich, Eisberge seien nicht "about" etwas, aber von Jahresringen in Bäumen behauptet er, sie enthielten Information "about" Vegetationsperioden. In Wirklichkeit handelt es sich in beiden Fällen um natürliche Gegenstände, die nicht um ihrer Auswertung willen (durch Glaziologen dort, Dendrochronologen hier) entstanden sind. Sie sind nicht zeichenhaft, gehören nicht zur Kommunikation. Es gibt da keinen Unterschied, und das Gerede von "Information" ist gegenstandslos. (Nachweise im Haupteintrag.) Übrigens habe ich nicht gewußt, daß große Eisberge nicht durch den Wind bewegt werden, sondern auf dem Gefälle des Meeresspiegels herunterrutschen und dabei von der Corioliskraft abgelenkt werden. Das hat man auch erst kürzlich herausgefunden. Es gehört nicht zum Thema, aber ich benutze die Gelegenheit, es weiterzugeben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.10.2020 um 04.30 Uhr |
|
Im Haupteintrag habe ich die verbreitete Ansicht zitiert, daß die beiden (philosophischen) Hauptbedeutungen von "Intentionalität" (Absichtlichkeit und Gerichtetheit) nichts miteinander zu tun hätten, und meinen Zweifel angekündigt. Die falschen Freunde "Meinung" und "meaning" geben einen Hinweis. Die Bedeutung eines Wortes ist das, was der Sprecher damit ausdrücken will. Auch sind "meinen" und "Minne" verwandt ("Freiheit, die ich meine..."). Bei Platon heißt es: ti bouletai ho logos "Was will die Rede?" = Worauf läuft sie hinaus, was bedeutet sie? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.05.2020 um 04.26 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#34999 Agens autem non movet nisi ex intentione finis. (Thomas von Aquin) Das ist insofern richtig, als es außerhalb der folk psychology, d. h. außerhalb des menschlichen Dialogs, überhaupt keinen Sinn hat, von „Agens“ zu sprechen: „In der Natur gibt es keine Ursache und keine Wirkung.“ (Ernst Mach: Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt, Darmstadt 1988:524, 1883:459) Die „Finalursache“ ist die ursprüngliche und einzige wirkliche Ursache, alles andere sind personalistische Metaphern für Naturvorgänge. Agens, Ursache sind keine physikalischen Begriffe. Das teleologische Weltbild ist inzwischen obsolet, aber der Mentalismus mit seinem Grundbegriff der Intentionalität beherrscht noch weite Teile der Psychologie und der Geisteswissenschaften. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.03.2020 um 11.11 Uhr |
|
Beliefs, desires and most of the other mental states assigned are taken to be ‘propositional attitudes’. In other words, they have the form ‘X believes that p’ and ‘X desires that q’, where and q are propositions that can have any intelligible content you like, such as ‘it is raining’, ‘Paris is the capital of France’, ‘the cat is under the table’ and so forth. (Daniel D. Hutto/Matthew Ratcliffe: „Introduction“ in: Dies., Hg.: Folk Psychology Re-Assessed. Dordrecht 2007:1) Das zeigt den sprachlichen Charakter des „Mentalen“. Propositionen sind Sätze. Der Geist ist eine Person, die meistens mit sich selbst spricht. Auf diesem naiven Stand können wir aber doch nicht stehenbleiben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.03.2020 um 08.42 Uhr |
|
„Intentionale Bezugnahme“ (über 1000 Belege bei Google) ist „bezugnehmende Bezugnahme“ – tautologisches Doppelmoppeln. Das Fremdwort verschleiert den Unsinn. Das hat seinen tieferen Grund in der Unwissenschaftlichkeit des Begriffs Intentionalität, Referenz, Bezugnehmen. (Es ist im Grunde alles dasselbe, daher der Singular.)
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 25.02.2020 um 04.36 Uhr |
|
Für mich klingt das auch unsinnig. Zustand wird hier als Oberbegriff von Überzeugung, Wunsch, Absicht gebraucht, die unter bestimmten Bedingungen wahr, erfüllt bzw. ausgeführt seien. Eine wahre oder falsche Überzeugung – das ist sehr verschlungen ausgedrückt. Überzeugung wovon? Man kann das viel klarer eine wahre oder falsche Aussage nennen. Bedingte Wahrheiten gibt es m. E. nicht. Alle relevanten Bedingungen gehören immer mit zur Aussage. Also nicht: Die Aussage A ist unter der Bedingung B1 wahr und unter der Bedingung B2 falsch sondern Die Aussage (A, B1) ist wahr und die Aussage (A, B2) ist falsch. So ähnlich kann man auch (nicht) erfüllte Wünsche und (nicht) realisierte Absichten analysieren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.02.2020 um 11.01 Uhr |
|
„Jeder Zustand legt selbst fest, unter welchen Bedingungen er wahr ist, falls es sich um eine Überzeugung handelt. - oder unter welcher Bedingung er erfüllt ist, falls es sich um einen Wunsch handelt, - oder unter welchen Bedingungen er ausgeführt ist, falls es sich um eine Absicht handelt.“ (Erhard Oeser/Franz Seitelberger: Gehirn, Bewußtsein und Erkenntnis. Darmstadt 1988:145) Aber inwiefern kann man von Zuständen sagen, sie seien wahr, erfüllt oder ausgeführt? Und das sollen sie auch noch selbst festlegen! Ich verstehe nichts mehr. (Es ist übrigens an Searle angelehnt.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.02.2020 um 06.27 Uhr |
|
Ich habe anderswo zitiert: "Gegenstand psychischer Prozesse" (http://www.sprachforschung/ig.org/ickler/index.php?show=news&id=1540#37688) Schon die Ersetzung von Prozeß durch Vorgang würde die Sinnlosigkeit aufdecken. Zweifelhafter Segen der Fremdwörter. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.10.2019 um 06.02 Uhr |
|
Ein Hund, eine Katze könnte doch mal ein Auge mit einer Pfote abdecken, um zu erleben, wie die Welt mit einem einzigen Auge betrachtet aussieht. Das wird aber nie geschehen, und es würde uns aufs äußerste überraschen und beunruhigen. – Darüber wiederum wundern wir uns zu wenig. Ich vermute, daß eine solche Willkürhandlung eine sprachliche Instruktion voraussetzt. Ganz ähnlich wie die Abstraktion (Achte auf die Farbe! usw.). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.08.2019 um 05.24 Uhr |
|
In seinem Buch über Tintenfische geht Godfrey-Smith auf Distanz zur Theorie des „Embodiment“, weil der Körper des Oktopus gar keine feste Gestalt habe. Aber das ist übertrieben, denn die Topologie steht ja fest, bei aller Biegsamkeit. Auch gehen die Nerven an bestimmte Orte usw.; der Oktopus ist kein beliebig verformbarer Klumpen Gallert. Es gibt bessere Argumente: Embodied cognition – solche und ähnliche Wendungen setzen den Dualismus schon voraus. Das kommt für eine biologische Untersuchung nicht in Betracht. Aus naturalistischer Sicht reagiert der ganze Organismus, nicht sein Körper und nicht sein Geist.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.08.2019 um 05.23 Uhr |
|
What does it feel like to be an octopus? To be a jellyfish? Does it feel like anything at all? Which were the first animals whose lives felt like something to them? (...) Many years ago Thomas Nagel used the phrase what it’s like in an attempt to point us toward the mystery posed by subjective experience. He asked: What is it like to be a bat? It’s probably like something, but very different from what it’s like to be a human. The term “like” is misleading here, as it suggests that the problem hinges on issues of comparison and similarity—this feeling is like that feeling. Similarity is not the issue. Rather, there is a feel to much of what goes on in human life. Waking up, watching the sky, eating—these things all have a feel to them. That’s what has to be understood. (Peter Godfrey-Smith: Other minds. The octopus and the evolution of intelligent life. London 2018:77f.) Immerhin lehnt er (wie Hacker, Dennett) die Vergleichs-Deutung ab. Aber daß es sich irgendwie anfühlt zu essen usw., scheint mir trotzdem keine sinnvolle Aussage zu sein. Es ist die Bekräftigung der Erlebnisrede durch Bekenntnis ("subjective experience") zu ihr leerstmöglichen Formel. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.06.2019 um 17.10 Uhr |
|
Ich kann besser als jeder andere ankündigen, was ich tun werde (aber nicht weil ich es „weiß“, sondern weil die Ankündigung ein Teil meines Tuns ist, dessen „Vorspann“); aber ein anderer kann besser als ich wissen, warum ich es tun werde.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.03.2019 um 06.36 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#41014 Zufällig stoße ich im Internet auf die Abbildung einer amerikanischen Scheune. Sie ist sozusagen einer Basilika nachgebildet, mit zwei Seitenschiffen. Die große Schiebetür auf der Giebelseite ist traditionell, der Rest neu. Den ursprünglicheren Formen der amerikanischen Scheune (American Barn) geht Jonnie Hughes in dem erwähnten Buch nach. Er zeigt, wie die Zuwanderer aus Deutschland, Holland, Skandinavien ihre traditionellen Scheunenformen in ihre bevorzugten Siedlungsgebiete Amerikas verpflanzten, wo sie sich dann unter den neuen Umweltbedingungen zu dem wohlbekannten Typ mit "Gambrel roof" (Mansarddach, selbsttragend bei größtmöglichem Raum für sehr viel Heu) entwickelten. Diesen Typ kennt man ja aus unzähligen Filmen, vor allem Stummfilmen, denn der Bautyp verschwindet neuerdings: https://americacomesalive.com/2014/01/28/barns-disappearing-american-icon/ Einzelheiten in dem sehr anregenden Buch. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.03.2019 um 16.57 Uhr |
|
Bei allem, was ich tue und erlebe, habe ich das Gefühl, daß ich es bin, der etwas tut oder erlebt, daß ich wach und ´bei Bewußtsein´ bin. (Gerhard Roth in Wulf Schiefenhövel u. a.: Vom Affen zum Halbgott. Stuttgart 1994:141) Das hatte ich im Haupteintrag bereits zitiert. Es ist einer jener philosophischen Versuche, eine unbestreitbare Grundlage zu schaffen, wie Descartes. Ist er gelungen? Einerseits kann ich nicht bestreiten, daß ich, wenn ich darüber nachdenke, das "Gefühl" (oder was auch immer es ist) habe, daß ich es bin, der das tut, was ich tue. Wer denn sonst? (Das alles klingt komisch, aber das ist nicht meine Schuld.) Andererseits stimmt es sicher nicht, daß ich dieses Gefühl immer habe, wenn ich etwas tue. Ich habe eigentlich normalerweise überhaupt kein besonderes Gefühl bei meinen alltäglichen Verrichtungen – solange ich mir nicht die Frage stelle oder stellen lasse, welches Gefühl ich dabei habe. Die Aussage stimmt hinten und vorne nicht. (Sie ist verdünnter Kant, aber darauf will ich hier nicht eingehen.) Wie immer bei solchem Leerlauf geht es eigentlich darum, die Teilnahme an der üblichen Sprache mit ihren psychologischen Konstrukten zu bestätigen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.03.2019 um 09.03 Uhr |
|
Zwischen "tun wollen" und "tun werden" ist ursprünglich kein Unterschied, wie ich im Anschluß an das Goethe-Zitat dargestellt habe. Erst die Unterbrechung des Verhaltensablaufs durch den Einspruch der anderen macht aus der Ankündigung ein Wollen, und das ist der evolutionäre Sinn des Ankündigens (und der Sprache, in der es geschieht). Man sieht es noch an Wörtern wie Vorhaben, auch Vorsatz (nach lat. propositum) usw. Dem Tun des Kindes wird durch das Nein der Erwachsenen Einhalt geboten, aber auch umgekehrt. Die Kinder lernen nein früher als ja, und René A. Spitz hat daraus weitergehende Schlüsse gezogen ("Nein und Ja"), allerdings schwer verklausuliert in die psychoanalytische Begrifflichkeit der "Ich-Entwicklung"). Das kleine Kind antwortet mit nein (und Kopfschütteln), wenn man fragt, ob es etwas Bestimmtes will; und es ruft nein!, wenn man beim gemeinsamen Spiel etwas anderes tut, als es sich in den Kopf gesetzt hat. In diesem Rahmen bildet sich Unterscheidung heraus zwischen dem, was geschehen wird, und dem, was geschehen soll (= gewollt wird). Alle anderen Absichtlichkeiten sind aus diesem Rahmen heraus übertragen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.03.2019 um 09.28 Uhr |
|
Vorläufige Bemerkung zur "Affenhocke" (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1477#41012) Früher ritten die Jockeys auch bei Rennen in der aufrechten Position wie die stolzen Fuchsjagdreiter. Vor 100 Jahren bemerkte einer, daß der Luftwiderstand sich verringerte, wenn er sich duckte. Das sah bestimmt nicht so toll aus. Einer berichtete aber, daß Jockeys mit dieser Technik siegten, auch wenn sie Mähren ritten, die andernfalls gerade noch als Hundefutter getaugt hätten. Wie wir heute wissen, ist der Luftwiderstand eine relativ unbedeutende Größe, der Hauptnutzen liegt in der Anatomie und Physiologie der Pferde, und heute hängen die Jockeys alle im monkey crouch auf deren Hälsen. Man könnte dies eine kulturelle Exaptation nennen. Mögliche Ausweitungen werde ich später diskutieren, im Zusammenhang mit Jonnie Hughes: On the origin of tepees. New York 2011. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.02.2019 um 09.01 Uhr |
|
Eine vorsprachliche „Formulierung des Gedankens“ ist ein hölzernes Eisen. Um das nicht einsehen zu müssen, lassen Philosophen gern im Dunkeln, was sie mit Begriffen und Propositionen eigentlich meinen. Manche sagen aber ausdrücklich, daß es sich um eine nicht-ethnische „Sprache des Geistes“ handele, also jedenfalls Sprache (und in der Praxis erweist sie sich meist als verdächtig ähnlich dem Englischen, früher Lateinischen...) Aus Linearität des Sprechens stammt offensichtlich auch die Ansicht, die Gedanken, Vorstellungen usw. seien zeitlich linear geordnet. Darin stimmen fast alle Philosophen überein. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.02.2019 um 07.21 Uhr |
|
Géza Révész meint, es gebe kein sprachloses Denken, aber wenn er von der „innerlichen Formulierung des Gedankens“ spricht, in die Satzschemata eingehen, gibt er beiläufig zu erkennen, daß er das Denken schon von Anfang an als sprachlich auffaßt, so daß es sich einfach um eine Petitio principii handelt. Das ist bei der Unbestimmtheit des folkpsychologischen Begriffs nicht zu vermeiden, braucht aber auch nicht weiter diskutiert zu werden.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.12.2018 um 09.32 Uhr |
|
Das Verhalten der staatenbildenden Insekten erklärt sich nicht aus einem Plan des Ganzen, der in jedem einzelnen Tier „repräsentiert“ wäre, sondern aus viel einfacheren Reaktionen im kleinen, die sich evolutionär herausgebildet haben, weil sie zu einem vorteilhaften Ganzen beitragen. An keiner Stelle gibt es einen Gesamtplan, nur die "unsichtbare Hand". – Fließbandarbeiter, die Autos montieren, brauchen auch keinen Gesamtplan, aber es gibt hier Ingenieure, die einen solchen Plan haben und die Arbeit in fließbandgeeignete Schritte zerlegen. – Soziale Systeme wie ganze Gesellschaften, Sprachen oder Religionsgesellschaften (Kultgemeinden usw.) haben eher keinen Gesamtplaner oder Gesamtplan, sondern haben sich „evolutionär“ (aber in historischer Dimension) herausgebildet und zu einer gewissen bewährten Organisation gefunden. Wäre die Rolle der einzelnen Mitglieder klar, brauchte man keine Soziologie, um es herauszufinden.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.11.2018 um 03.57 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#32356 „Als Pertinenzdativ deutet man persönliche Dativphrasen, die eine unveräußerliche Zugehörigkeit bezeichnen. Sie entsprechen einem Possessivartikel (oder einem possessiven Genitivattribut), der aus der Nominalphrase herausgezogen wurde und als eigene Dativphrase formuliert ist: Er hielt ihr die Hand. > Er hielt ihre Hand.“ (Hans Jürgen Heringer) Die beiden Sdätze sind aber nicht gleichbedeutend, und das „Herausziehen“ und „Entsprechen“ ist sehr vage. Ulrich Engel schreibt: "Der im Pertinenzdativ genannte Besitzer muß im Prinzip ein Mensch oder ein höheres Lebewesen sein. Daneben kommen aber auch unbelebte Dinge in Frage, die als diesem Lebewesen gleichwertig erachtet werden, Dinge, an denen man besonders hängt, die man wie seinen eigenen Körper schätzt. So kann man heute durchaus sagen: Der Ford ist dem Mercedes an den Kotflügel gefahren." In Wirklichkeit liegt hier die übliche Personifizierung von Autos vor, und das Ganze hat nichts mit der Wertschätzung zu tun, die man dem Auto entgegenbringt und die vielmehr in dem Satz Der Ford ist mir gegen den Mercedes/an den Kotflügel gefahren zum Ausdruck kommen würde. (Wobei wiederum von Unveräußerlichkeit keine Rede sein kann...) Die Literatur zum "Pertinenzdativ" ist sehr umfangreich und kann wegfallen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.11.2018 um 09.24 Uhr |
|
"Mentale Repräsentation findet statt, wann immer wahrgenommen oder gedacht, gewollt oder gefühlt wird. Denn all dies sind geistige Phänomene, und sie alle haben einen Inhalt; jedes von ihnen allein reicht aus, um den Schluß zu ziehen: Es gibt mentale Repräsentation. Jeder beliebige geistige Zustand, Vorgang oder Akt mit einem intentionalen Gehalt bezeugt unmittelbar das Phänomen der mentalen Repräsentation. Mentale Repräsentation, als Singulare tantum, leugnen, hieße den Geist, wie er uns vertraut ist, selbst leugnen. (...) Mentale Repräsentation gibt es, das ist unbestritten." (Andreas Kemmerling in Kognitionswissenschaft 1,2,1992:47f.) (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587) Ich versuche eine vernünftige Rekonstruktion. Zu unserem „transgressiven“ (auch „intentional“ genannten) Idiom, mit dem wir uns untereinander verständigen, gehören Ausdrücke wie Geist, Bewußtsein, wollen, denken, wissen, vorstellen usw. Sie hängen alle miteinander zusammen und sind feste Bestandteile der deutschen Sprache. Wenn jemand sagte: Ich denke nicht, ich weiß nichts, ich habe keine Vorstellungen und kein Bewußtsein – dann würde man ihm nicht in der Sache widersprechen, sondern an seiner Sprachkompetenz zweifeln. Das bedeutet aber nicht, daß es die Gegenstände, die in diesem Konstrukt scheinbar bezeichnet sind, „unbestritten“ gibt, sondern eben nur das unbezweifelbare Funktionieren der mentalistischen Redeweise. Zu „Repräsentationen“ gelangen die Philosophen auf zweierlei Weise: – durch eine Schlußfolgerung cartesianischer Art oder aufgrund des bilateralen Zeichenbegriffs; – durch vermeintliche unmittelbare Anschauung („Introspektion“ dies ist ebenfalls ein Teil der „Erlebnissprache“), d. h. in Wirklichkeit sprachverführt; so die Phänomennologie. Hier muß die Aufklärung ansetzen, nicht bei dem verfehlten Versuch einer „Übersetzung“ in die Sprache der Wissenschaft, sei es Verhaltensforschung oder gleich Neurologie. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.11.2018 um 04.47 Uhr |
|
An diese Ontologie schließt sich eine seit den eleatischen Philosophen quälende Frage an: Wie kann man von etwas sprechen, was es nicht gibt? Und in sophistischer Zuspitzung, die in der Negation ein Reden von Nichtseiendem sah: Wie kann man etwas negieren? Gar nicht! (Ouk estin antilegein.) Zugrunde liegt die falsche Theorie, daß die Bedeutung eines Wortes in einer realen Beziehung zum gemeinten Gegenstand bestehe – letzten Endes der bilaterale Zeichenbegriff. Bei Saussure ist dieser Gegenstand nur noch ein vorgestellter ("psychisch", wie er sagt), aber geben muß es ihn. Daher das ganze naive Gerede von "Repräsentationen". Erst die Gebrauchstheorie der Sprache, Wittgensteins behavioristische Position also, befreit uns von diesem Eleatismus. Die Bedeutung oder Funktion der Wörter besteht in ihrem Beitrag zur Kommunikation, nicht in ihrer "Referenz" auf Gegenstände. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.10.2018 um 05.26 Uhr |
|
„Der Begriff der Intentionalität bezeichnet die Fähigkeit des Menschen, sich auf etwas zu beziehen (etwa auf reale oder nur vorgestellte Gegenstände, Eigenschaften oder Sachverhalte).“ (Wikipedia) Das ist keine Erklärung, sondern eine Übersetzung, weil das gelehrte Wort Intentionalität nur mit seiner allgemeinsprachlichen Entsprechung gleichgesetzt wird. „Sich beziehen“ ist ebenso erklärungsbedürftig wie „Intentionalität“. Man spricht auch von Referenz oder Aboutness – alles supranaturalistisch, denn in der Natur gibt es dergleichen nicht, und das ist nach dem gleich darauf erwähnten Brentano gerade das Auszeichnende des Psychischen. Außerdem enthält der Satz eine undiskutierte Ontologie: Anscheinend zerfällt die Welt in zwei Arten von Gegenständen, reale und vorgestellte. Fraglich ist nicht nur die Rede von vorgestellten Gegenständen, sondern erst recht die Verbindung mit der Intentionalität. Wie kann man sich auf etwas beziehen, was es gar nicht gibt? Bekanntlich ist die Antwort der Phänomenologen: Irgendwie gibt es nicht-reale Gegenstände doch, und zwar gerade als Zielpunkte des Sichbeziehens, sie sind sozusagen im Sichbeziehen enthalten im Sinne einer „intentionalen In-Existenz“ (eines Darinseins). Wer es fassen kann, der fasse es; andere werden das logische Mißgeschick bedauern. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.07.2018 um 04.22 Uhr |
|
In der Psychologie sollen Gesetze gefunden werden, mit denen sich erklären läßt, warum Menschen sich unter bestimmten Umständen in bestimmter Weise verhalten. Menschliches Verhalten umfaßt Handlungen, und für deren Erklärung braucht man Begriffe wie "Überzeugung" und "Wunsch. (Andreas Kemmerling) Was wären das für Erklärungen, die sich derselben volkstümlichen Redeweise bedienten wie das zu Erklärende? Für eine naturalistische Erklärung menschlichen Verhaltens gehören Überzeugung und Wunsch zu den Explananda. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.07.2018 um 16.49 Uhr |
|
Die Diskussion geht seit 60 Jahren und ist zu kompliziert, um sie hier noch einmal aufzurollen. Damit der Nativismus gehaltvoll ist, muß er mehr als die Trivialität bieten, daß der Mensch, um Sprache zu lernen, offenbar fähig sein muß, sie zu lernen. Nach der lange vertretenen These der Generativisten umfaßt die angeblich angeborene Universalgrammatik eine ganze Reihe spezifischer Regeln, geradezu eine Theorie möglicher Sprachen. Die einzelsprachliche Umgebung sorgt dann dafür, daß einzelne "Parameter" gesetzt werden, also z. B. Attribute vor oder nach dem Substantiv u. ä. Das Ganze ist, soweit überhaupt noch verfolgt, bis heute im Fluß und hat mich auch nie besonders interessiert. Empirisch arbeitende Sprachwissenschaftler (zu denen Chomsky nicht gehörte) haben stets die Variabilität der Sprachen betont, nicht das angeblich Universale. Skinner hat dazu gesagt, daß universale Eigenschaften sich durch die gemeinsame Umgebung der Menschen und die immergleichen praktischen Aufgaben erklären lassen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 20.07.2018 um 15.07 Uhr |
|
Was ich sagen wollte, ist mehr so: "Sprache kann nicht gelernt [werden], sie muß angeboren sein", das klingt wirklich sehr naiv, m. E. zu naiv, als daß Chomsky es genau so gesagt haben könnte. Die Universalgrammatik ist sicher keine gute Idee, aber andererseits auch nicht so völlig naiv. Je nachdem, was man genau darunter versteht, könnte man Chomsky zugestehen: der Mensch ist vernunftbegabt, zumindest die Sprachfähigkeit und die Lernfähigkeit sind also angeboren. Wenn ihn das Sprachenlernen im engeren Sinne nicht interessiert, na ja, ich würde sagen, das ist halt sein Pech oder seine Sache. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.07.2018 um 11.33 Uhr |
|
Chomskys Nativismus ist viel spezifischer, s. Stichwort "Universalgrammatik". (Auf die Wandlungen der Theorie gehe ich nicht ein.) Aber das war gerade einer der Streitpunkte. Chomsky hat die Unterschiede zwischen den Sprachen für rein oberflächlich erklärt und die Tatsache, daß Kinder die Sprache ihrer Umgebung lernen, für "uninteressant". Einer der Gründe, warum viele – und immer mehr – Sprachwissenschaftler die Generative Grammatik allmählich selbst uninteressant fanden.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 20.07.2018 um 10.49 Uhr |
|
Ich habe viel zu wenig von Chomsky gelesen, um mir ein Urteil zu erlauben, kann mir aber nicht vorstellen, daß er meint, Deutschen sei die deutsche Sprache angeboren, Chinesen die chinesische usw. Er meint dies doch sicher in einem viel allgemeineren Sinne, nämlich daß dem Menschen gewisse körperliche und geistige Voraussetzungen zur sprachlichen Kommunikation angeboren sind? Er wird doch nicht bestreiten, daß ein Neugeborenes erst die konkrete Sprache seiner Umgebung lernen muß?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.07.2018 um 05.10 Uhr |
|
Wenn man die Stammesgeschichte ausklammert, kommt einem die Zweckmäßigkeit der Lebewesen wie ein Wunder vor. Man sagt dann, das könne nicht einfach entstanden, sondern müsse erschaffen sein (Kreationismus). Ebenso in ontogenetischer Dimension: Wenn man die Lerngeschichte (Konditionierung) ausklammert, erscheint schon das Verhalten eines Hundes oder Zirkustiers als Wunder, erst recht die Kunstfertigkeit des Menschen bis hin zur Sprache. Auf diesem naiven Standpunkt befindet sich Chomsky: Sprache kann nicht gelernt, sie muß angeboren sein – was man ohne weiteres als Bekenntnis zum Wunder verstehen kann, denn eine Erklärung ist es nicht, sondern der ausdrückliche Verzicht darauf. Der ungeschichtliche Standpunkt führt zur Übernahme der bewährten, aber vorwissenschaftlichen Hilfskonstruktionen wie „Absicht, Wille“ usw. Dennett daher: „Wenn die Wesen vom fremden Stern uns nicht aus der intentionalen Perspektive betrachten, dann verpassen sie etwas...“ usw. Diese hypothetischen Besucher von fremden Sternen verkörpern den geschichtslosen phänomenologischen Betrachter. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.07.2018 um 12.11 Uhr |
|
„Bei allen intentionalen Zuständen kann man also zwei Aspekte unterscheiden: die Art des Zustandes und seinen Inhalt. Mein Wunsch, ein neues Fahrrad zu erwerben, und mein Wunsch, einen alten Freund wiederzutreffen, sind intentionale Zustände derselben Art; beides sind Wünsche, allerdings Wünsche mit verschiedenen Inhalten. Meine Befürchtung, daß es heute regnen wird, und meine Überzeugung, daß es heute regnen wird, sind dagegen intentionale Zustände verschiedener Art. Aber auch sie haben etwas gemeinsam; sie haben denselben Inhalt: sie richten sich beide auf die Proposition, daß es heute regnen wird. (Ansgar Beckermann: „Ist eine Sprache des Geistes möglich?“ In: Gisela Harras, Hg.: Die Ordnung der Wörter. Berlin, New York 1995:120-137; S.121) Die sprachliche Seltsamkeit fällt dem Verfasser nicht auf: Wie können Zustände einen Inhalt haben oder sich auf etwas richten? Aber so reden alle in der Brentano-Nachfolge: „Intentionality is that property of many mental states and events by which they are directed at or about or of objects and states of affairs in the world.“ (Searle) usw. Unverständlich, sinnlos. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.07.2018 um 10.24 Uhr |
|
„Damit man sprachlich etwas meinen kann, muß man die Wörter der Äußerung in eine intentional gerichtete Struktur hineinstellen, die ihnen sozusagen Richtung und damit Wucht gibt.“ (Hans Hörmann: Einführung in die Psycholinguistik. Darmstadt 1991:55) Das ist die naive Psychologie des Sprechens als eines Zielens und Treffens, wie man es eben zu erleben glaubt: „das treffende Wort“ usw. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.07.2018 um 18.38 Uhr |
|
Zu Thomas Nagels sinnlosem Fledermaus-Aufsatz auch Alex Byrne: Here is another way of putting the point, using the example of the bat. It is misleading to say that we don´t know what batty experiences are like (actually, we don´t know what they´re like, but, then, we also don´t know what our own experiences are like). Rather, we don´t know what the bat´s environment is like. The bat perceives qualities of insects and obstacles that we do not, and the problem that Nagel has identified but misdescribed is that we can´t form a conception of what these qualities are. This may be a genuine and serious problem, or it may not; either way, it is a problem about insects and obstacles, not a problem about consciousness. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.07.2018 um 03.02 Uhr |
|
Gegen Thomas Nagels Formulierung und deren Abwandlungen, z. B. (schon zitiert): Eine Entität hat "Bewußtsein", wenn es für diese Entität irgendwie ist, diese Entität in dieser oder jener Weise zu sein. (Martin Kurthen in Sybille Krämer, Hg.: Bewußtsein. Philosophische Beiträge. Frankfurt 1996:17) Aber das haben wir nie an „Entitäten“ beobachtet, sondern verwenden diese Redeweise nur in bezug auf uns selbst als Dialogteilnehmer. Es ist nur eine gelehrt wirkende Umschreibung und Ableitung aus der naiven folkpsychologischen Ausdrucksweise, deren Funktion aber nicht darin besteht, über Subjektivität usw. zu räsonieren. Von einem Etwas können wir uns nicht einmal vorstellen, was heißen könnte, etwas sei „für“ dieses Etwas irgendwie. Und was bedeuten die Anführungszeichen? – Es ist eben alles nur begriffliche Taschenspielerei und keineswegs eine letzte Gewißheit. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.07.2018 um 18.01 Uhr |
|
Daß andere nicht wissen, was ich denke, gehört zu den Gebrauchsbedingungen von denken. Es ist kein Sachverhalt, der entdeckt werden könnte. (Konstrukt der radikalen Privatheit.) Viele verstehen das einfach nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.05.2018 um 04.38 Uhr |
|
„Stellen wir einem 13jährigen Schüler die Aufgabe: 5 Arbeiter benötigen 36 Arbeitsstunden, um eine Grube auszuheben. Wieviel Zeit sparen wir, wenn wir 8 Arbeiter einsetzen können? Dreisatzaufgaben werden im 7. Schuljahr lang und intensiv geübt, und unser Schüler kann die Aufgabe wahrscheinlich nicht nur lösen, sondern uns auch vor, während oder nach der Bearbeitung die Methode seines Vorgehens, eben den Dreisatz, angeben: wir haben allen Grund zu der Annahme, daß er wirklich danach verfährt. Was er aber beschreibt, ist nicht ein Inhalt, sondern ein Prozeß – eben der Prozeß der Lösung von Dreisatzaufgaben. Andererseits ist das natürlich nicht der vollständige Prozeß: was unser Schüler beschreibt, ist der Ablauf bzw. der Plan einer Handlung (vom Typ des Problemlösens) auf der strategischen Organisationsebene; auf anderen, vor allem niedrigeren Organisationsebenen mögen andere Prozesse ablaufen, die er nicht beschreiben kann, sofern sie nicht bewußt ablaufen.“ (Mario v. Cranach u. a.: Zielgerichtetes Handeln. Bern 1980:216f.) Der Schüler gibt eine standardisierte Beschreibung auf der logischen Ebene, orthodox stilisiert. Vielleicht spielen Teile davon tatsächlich als inneres Sprechen (verdecktes Verhalten) eine gewisse Rolle: Es könnte Reize schaffen, unter deren Kontrolle das übrige Verhalten gerät. In diesem Falle wäre die Handlungsdiktion auf verdecktes Verhalten anwendbar. Wie kann man glauben, etwas erklärt zu haben, wenn man sagt: „Er hat eine Regel angewendet“? Die Psychologie der Regelanwendung, des logischen Argumentierens ist selbst das Problem. („Er“ mag danach verfahren, aber „es“ in ihm?) Die Produktion von Zwischenergebnissen und Kommentaren zu ihrer genormten Form sind von derselben Art wie die Lösung selbst und erklären sie nicht psychologisch. Der Titel dieses Buches ist übrigens tautologisch, denn: „Mit dem Wort ‚Handeln‘ bezeichnen wir das zielgerichtete, bewußte, geplante und beabsichtigte Verhalten eines Handelnden (Aktors).” (S. 77) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.05.2018 um 07.21 Uhr |
|
Im Feuilleton der FAZ wird auch wieder Thomas Nagels Frage zitiert, wie es für eine Fledermaus ist, eine Fledermaus zu sein. Zu diesem Unfug sei nochmals auf Peter Hackers Aufsatz hingewiesen: http://info.sjc.ox.ac.uk/scr/hacker/docs/To%20be%20a%20bat.pdf |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.05.2018 um 08.21 Uhr |
|
Die Willkürbewegung (= durch Einspruch aufhaltbares Verhalten) setzt sich aus unwillkürlichen Bewegungen zusammen. Durch Biofeedback können bisher unwillkürliche Bewegungen unter die Steuerung des „Willens“ (= Steuerung durch andere) gebracht werden. Wenn ich jemanden bitte, das Gaumensegel zu senken, weiß er nicht, was er tun soll. Er tut es, wenn ich ihn bitte, ein n oder einen französischen Nasalvokal auszusprechen, weiß aber nichts davon, während er Lippen und Zungenspitze, die er beobachten kann, durchaus unter Kontrolle hat. Aber wenn er den Vorgang im MRT (https://www.mpg.de/12013900/echtzeit-filme-aus-dem-koerper) sieht, kann er möglicherweise das Gaumensegel ohne solche Umwege senken. (Ich weiß es nicht genau; man könnte auch andere Bewegungen nehmen, sogar die Herzfrequenz.)
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.04.2018 um 06.38 Uhr |
|
Zu einem Punkt im Haupteintrag: „Jedes intellektive Erlebnis und jedes Erlebnis überhaupt, indem es vollzogen wird, kann zum Gegenstand eines reinen Schauens und Fassens gemacht werden, und in diesem Schauen ist es absolute Gegebenheit. Es ist gegeben als ein Seiendes, als ein Dies-da, dessen Sein zu bezweifeln gar keinen Sinn gibt.“ (Edmund Husserl: Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen. Haag 1958:31) Husserl verwendet hier deiktische Ausdrücke wie ein Dies-da. Vgl. auch: „Ich kann klar feststellen, daß ich jetzt diese Empfindung, diese Wahrnehmung, diesen Gedanken habe. Mir sind diese Zustände so gegeben, daß es absurd erscheint, an ihrem Vorhandensein zu zweifeln. (Volker Gadenne/Margit E. Oswald: Kognition und Bewußtsein. Berlin u.a. 1991:23) Die Verfasser verweisen auch hier deiktisch (dies) auf ein Objekt. Wem könnte man etwas im privaten Innenraum des Bewußtseins zeigen? Zeigen findet in einem Zeigraum statt, der Hörer und Sprecher gemein ist. Es ist ein kommunikatives, soziales Verhalten. (Husserl drückt sich wie immer ganz sonderbar und verfremdend aus. Werden Erlebnisse vollzogen? Sind Erlebnisse Gegenstand eines „reinen Schauens und Fassens“ – und sind Schauen und Fassen dasselbe? Wohl eher Hilflosigkeit, dem Phantom einen Namen zu geben. „Our suspicions should be aroused by the odd phrases used to invoke something with which we are all supposed to be utterly familiar.” ) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.03.2018 um 06.11 Uhr |
|
Warum sollte man "erforschen", was Wissen, Belief usw. wirklich sind – es handelt sich doch nur um Konstrukte in einer inkonsistenten folk psychology. Es ist von vornherein verkehrt, diese Ergebnisse jahrtausendealter Kultivierung systematisieren zu wollen. Symptom ist z.B. der Strudel der Rekursivität: "Ich weiß, daß ich weiß, daß ich weiß" usw. (Man kann es an keiner Stelle bestreiten, spürt aber die Leere – ein müßiges Spiel.)
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.03.2018 um 06.09 Uhr |
|
Muß vielleicht, wird aber nicht. Gerade bei Ankündigungen in der ersten Person liegen Absicht und Vorhersage oft ununterscheidbar nebeneinander. Wir wollen/werden dieses Jahr in Deutschland Urlaub machen. Wie Goethe an der zitierten Stelle sagt: wir wollen es tun = wir werden es tun (wenn nichts dazwischen kommt [was er die "Umstände" nennt]).
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 10.03.2018 um 13.35 Uhr |
|
Das ist typisches Politiker- und Wahlkampf-Deutsch; im wirklichen Leben muß zwischen "ich will = beabsichtige" und "ich werde = ich tue das wirklich" genau unterschieden werden. Politiker wollen nicht für ihre Versprechungen beim Wort genommen werden.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.03.2018 um 12.26 Uhr |
|
Der Koalitionsvertrag, den ich anderswo wegen seiner Genderei erwähnt habe, bestätigt übrigens, daß "ich will es tun" und "ich werde es tun" ganz nahe beieinander liegen, oft gar nicht unterscheidbar.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.03.2018 um 05.53 Uhr |
|
Dennett weist mit Recht auf die Wichtigkeit der Frage „Warum tust du das?“ hin und führt „approval and disapproval“ ein. Das entspricht meinem Begriffspaar „Zuspruch und Einspruch“. Aber soweit kennt Dennett nur den Rechtfertigungsdialog, der für mich post factum einsetzt. Für mich gibt es vorher schon den Deliberationsdialog, der auf eine noch grundlegendere Fähigkeit baut, nämlich die Ankündigung einer Handlung: „Was hast du vor?“ „Warum tust du das?“ scheint zwar auf die Gegenwart bezogen, aber eigentlich muß der Adressat mit dem Verhalten schon begonnen haben, wenn man ihn um eine Begründung bittet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.03.2018 um 03.56 Uhr |
|
Zu "Belebtheit": Sprachwissenschaftler hatten nie Bedenken, Belebtheit im metaphorischen Sinne einer naiven "Beseelung" zu verstehen, und schon stimmt es wieder. Meine Korrektur ist ja auch für die traditionelle Auffassung nicht wesentlich, und die Russischschüler waren immer gut bedient, wie Sie ja erfahren haben. Nur für den Einbau in mein Naturalisierungsprojekt muß ich auf die begriffliche Klärung Wert legen. Das handlungsfähige Wesen muß in mein Handlungsschema passen: Ankündigung – (Zuspruch/Einspruch) – Ausführung. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.02.2018 um 22.17 Uhr |
|
Die Kategorie "Belebtheit" kenne ich bereits seit der Grundschule, weil sie sowohl in der russischen als auch in der englischen Grammatik eine Rolle spielt, und es ist ja auch ein sehr einfaches Prinzip und es geht um einfache Regeln. Dabei stimmt es natürlich, daß die wörtliche Bedeutung von "belebt" das eigentlich Gemeinte nicht genau trifft. Aber trotzdem war mir aufgrund der schulischen Beispiele immer klar, was gemeint war. Ich wäre niemals überhaupt auch nur auf die Idee gekommen, unter Belebtes in diesem grammatischen Sinne auch Bakterien, Pflanzen, ganze Staaten und Kolonien von Kleintieren aller Art, ja sogar von solchen Lebewesen bewohnte Behausungen zu zählen. Geschweige denn Teile von Lebewesen wie Hände und Füße usw. Wir sagten "belebt", verstanden darunter aber selbstverständlich das, wie Prof. Ickler sagt, was im gegebenen Kontext als personhaft bzw. beseelt gilt (durchaus auch Märchenhafte Wesen). Mir ist aber schleierhaft, wie sogar Sprachwissenschaftler wie der hier zitierte Meillet die unterschiedlichen Arten von "Belebtheit" alle in einen Topf werfen können. Ob wir es nun belebt oder beseelt oder personenhaft nennen, das sind doch nur Bezeichnungen, die letzteren mögen zwar besser geeignet sein, aber trotzdem sollte ein Sprachwissenschaftler doch wissen, was grammatisch unter "belebt" zu verstehen ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.02.2018 um 16.10 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#33548 Die Theorien zur Entstehung des grammatischen Genus sind stark von Meillet beeinflußt. Allerdings hatte schon Grotefend eine sehr ähnliche These: Die europäischen (idg.) Sprachen hätten zuerst belebt und unbelebt unterschieden und dann das Belebte in Maskulinum und Femininum aufgespalten. Meillet schreibt: Ein aktives Organ ist belebt; die „Hand“, die empfängt, ist feminin, der „Fuß“ hingegen maskulin. Das zeigt noch einmal, wie ungeeignet die Kategorie Belebtheit ist. Es geht um Agentivität, wie man sagt, Handlungsfähigkeit, damit eigentlich um Personhaftigkeit. Das Thema wird heute noch diskutiert. Gegenüber dem 19. Jahrhundert mußte der Befund der altanatolischen Sprachen (Hethitisch vor allem) eingearbeitet werden. Auch das Neutrum war zu berücksichtigen (Schema attikon: Neutrum im Plural mit dem Verb im Singular). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.02.2018 um 07.56 Uhr |
|
Daß manche Aussagen und Fragen nur scheinbar einen sachlichen Gehalt haben, in Wirklichkeit aber die "Geschäftsordnung der Sprache" betreffen, läßt sich an harmlosen Beispielen erläutern. "Es ist möglich, jemandem etwas zu schenken." Wer das bestreitet, kann die Bedeutung des Verbs schenken nicht verstanden haben. Es mag Gesellschaften geben, in denen die Sitte des Schenkens nicht eingeführt ist (z. B. weil stets ein Gegenwert zu entrichten ist, also nur ein Kaufen möglich ist). Gerade daran zeigt sich aber, daß es um die "Geschäftsordnung" geht. So dann auch bei den philosophischen Paradebeispielen: "Der Mensch hat Bewußtsein." So funktioniert eben die Sprache, durch das folkpsychologische Teilsystem. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.02.2018 um 04.47 Uhr |
|
Der Rechtfertigungsdialog zwingt uns, das eigene Verhalten auf das Format der Handlung zu bringen. (Was hast du vor? bzw. Warum hast du das getan?) Vor Gericht wird untersucht, ob der Täter sich sein Verhalten als Handlung aneignen kann (So!) oder ob es ihm nur unterlaufen ist (Hoppla!). Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#24391 Unter "Handlungsformat", um es zu wiederholen, verstehe ich das Schema von Ankündigung – (Einspruch/Zuspruch) – Durchführung. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.02.2018 um 10.49 Uhr |
|
Wenn jemand glaubt, es regne, so wird er sich beim Verlassen seines Hauses wahrscheinlich anders verhalten, als wenn er der Überzeugung ist, es scheine die Sonne. Wenn jemand also beim Verlassen des Hauses zum Regenschirm greift, so würde dies alltagspsychologisch dadurch erklärt, daß man ihm die Überzeugung zuschreibt, es regne. Die Erklärung erfolgt durch die Annahme mentaler Zustände mit bestimmten Gehalten, d.h. sie bedient sich intentionaler Begriffe. Es ist eine der zentralen Behauptungen der Kognitionswissenschaft, daß dieser Typus von Erklärungen das erfolgreichste verfügbare Modell für Verhaltenserklärungen darstellt. (Martin Carrier/Jürgen Mittelstraß: Geist, Gehirn, Verhalten. Das Leib-Seele-Problem und die Philosophie der Psychologie. Berlin, New York 1989:205) Natürlich sind solche „Erklärungen“ bis zu einem gewissen Grade erfolgreich, denn dafür wurde ja die alltagspsychologische Verständigungstechnik entwickelt. Diese Art Psychologie zapft einfach das Plausibilitätsreservoir der Alltagssprache an. Fraglich ist seine Wissenschaftsfähigkeit. Wieso ist es überhaupt eine Erklärung, wenn man sagt: „Er greift zum Regenschirm, weil er glaubt, daß es regnet“? Die verhaltensanalytische Herleitung (frühere Erfahrung mit Regen und erfolgreicher Benutzung eines Schirms) wäre begrifflich sparsamer und anschlußfähiger an anderes gelerntes Verhalten, auch bei Tieren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.02.2018 um 04.02 Uhr |
|
Schon im Haupteintrag zitiert: „Mentale Repräsentation findet statt, wann immer wahrgenommen oder gedacht, gewollt oder gefühlt wird. Denn all dies sind geistige Phänomene, und sie alle haben einen Inhalt; jedes von ihnen allein reicht aus, um den Schluß zu ziehen: Es gibt mentale Repräsentation. Jeder beliebige geistige Zustand, Vorgang oder Akt mit einem intentionalen Gehalt bezeugt unmittelbar das Phänomen der mentalen Repräsentation. Mentale Repräsentation, als Singulare tantum, leugnen, hieße den Geist, wie er uns vertraut ist, selbst leugnen. (...) Mentale Repräsentation gibt es, das ist unbestritten.“ (Andreas Kemmerling in Kognitionswissenschaft 1,2,1992:47f. ) Ich expliziere die zwei Tricks: erstens die phänomenologische Konstruktion eines „Phänomens“ aus der folkpsychologischen Redeweise, zweitens die seltsame Rede vom „Inhalt“, ebenfalls aus der Grammatik abgeleitet. Beispiel: 1. Ich bin der festen Überzeugung > Es gibt ein geistiges Phänomen „Überzeugung“. 2. Ich bin von etwas überzeugt > Meine Überzeugung hat einen Inhalt/richtet sich auf etwas. Dieses Etwas muß es in irgendeiner Weise geben, sonst könnte sich der Geist nicht darauf richten. (Die Schachtel kann nicht leer sein.) Also: Es gibt geistige Phänomene mit einem Inhalt. Aus diesem „mentalistischen Sumpf“ (Hans J. Heringer) findet so gut wie niemand heraus. Es liest sich gar zu überzeugend. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.02.2018 um 17.00 Uhr |
|
Ich bin sogar der Meinung, daß die gesamte indische Kultur die spezifisch griechische und abendländische Kategorie des "Geistes" nicht besaß.(Max Scheler) Natürlich nicht! Solche "Kategorien" sind Teil kulturspezifischer Sprachspiele und haben keine Entsprechung in anderen Sprachen und Kulturen. Darum sind sie unübersetzbar. Es sind Konstrukte, nützliche Fiktionen, die nicht ineinander überführbar oder aufeinander abbildbar sind. Das ist wie mit anderen Fiktionen, z. B. Göttern. Die Interpretatio romana der griechischen oder germanischen Götter war eine künstliche Nachbildung bzw. theologische Gleichsetzung und widerspricht der These nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.02.2018 um 19.37 Uhr |
|
„In every known culture, people explain behavior in mentalistic terms, i.e., by ascribing mental states such as beliefs and desires.“ Fraglich, ob die Deutung zutrifft, denn das Wollen kann auch ohne eine Psychologie zugeschrieben werden: als Voraussage zuzüglich der Modifizierbarkeit durch Einspruch – also rein funktional, nicht als „mentaler Zustand“, wie man in unserer neueren Tradition sagt. Solche mentalen Zustände kann man aus der Redeweise herausspinnen und als Konstrukt pflegen, aber die Redeweise selbst kann unpsychologisch funktionieren: "Er will das tun" - das wäre ungefähr = "Er wird das tun, aber man kann es ihm noch ausreden". (Zu den Einzelheiten s. Haupteintrag) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.01.2018 um 07.15 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#33544 Der hantierende und der kommunikative Umgang mit der Welt sind zwei Verhaltensrepertoires, zwischen denen wir wechseln, je nachdem, ob wir es mit Dingen oder mit Personen zu tun haben. Kognitivisten stellen den Sachverhalt anders dar: „Our dualism is a natural by-product of the fact that we have two distinct cognitive systems, one for dealing with material objects, the other for social entities. These systems have incommensurable outputs. Hence dualism emerges as an evolutionary accident.“ (Paul Bloom: „Religion is natural“. Developmental Science 10/2007:147–151, S. 149) Wenn man auch mit reiner Verhaltensbeschreibung auskommt, ist die Einführung mentalistischer Konstrukte wie „kognitiver Systeme“ überflüssig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.01.2018 um 04.23 Uhr |
|
Tiere können nicht sprechen, folglich ihr Verhalten auch nicht ankündigen und nicht durch den Einspruch anderer davon abgebracht werden. Kurz gesagt: Das Handlungsschema ist nicht anwendbar. Man sollte ihnen also keine Absichten zuschreiben – was zwar möglich, aber überflüssig und nicht weiterführend ist. Damit hängt zusammen, daß Tiere keinen Selbstmord begehen können. Daß Tiere etwas "wollen", ist gleichwohl ein ziemlich zwingender Eindruck. Ich sitze auf einem Stuhl und bin mit den anderen am Tisch beschäftigt. Der Hund, eine Französische Bulldogge, stellt sich neben mich und drückt die Flanke fest gegen meine Wade. Ich streichele also seinen Rücken und kraule ihm den Kopf zwischen den Ohren, wobei er ganz still steht wie in Trance, mit glasigem Blick. Wenn ich aufhöre, macht er einmal kurz und leise „Wuff“, wendet den Kopf, sieht mich an und wackelt heftig mit dem Stummelschwanz (nicht kupiert, die Rasse ist so gezüchtet), bis ich weitermache. Nach ein paar Minuten höre ich wieder auf, und diesmal ist es genug, er trollt sich. Behavioristisch zu erklären, ohne Verwendung des intentionalen Vokabulars. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.01.2018 um 05.08 Uhr |
|
Bei Fluchtbewegungen von Fliegen soll es sich nicht um Reflexe handeln: „So konnten die Wissenschaftler beobachten, dass die Tiere einen Start vorbereiteten, diesen dann aber doch nicht ausführten, wenn die Gefahr sich als harmlos erwies. Reflexe laufen dagegen automatisch ab und wären nicht willentlich unterbrechbar.“ (SZ 30.8.08) Sinnlose Unterscheidung. Die Fliege kann nicht sprechen, deshalb ist die Unterstellung eines „Willens“ sinnlos. Die Umstände, die zu verschiedenen Reaktionen führen, sind eben verschieden. Erst wird ein Start vorbereitet, dann wird etwas anderes vorbereitet. Wir erleben ständig, wie Fliegen sich bei Annäherung der Hand usw. in Abflugstellung bringen. Losfliegen ist wieder etwas anderes. In beiden Fällen läuft das Geschehen unaufhaltsam ab, die Fliege "kann nicht anders". (Man kann richtig zusehen, wie unnütze Probleme erzeugt werden.) Wenn man den Begriff des "Reflexes" überhaupt noch verwenden will: Es gibt Bewegungsabläufe, die noch durch neue Reize unterbrochen werden können, und solche, die automatisch bis zu Ende ablaufen, z. B. der Schluckreflex oder der Ejakulationsreflex. Das hat mit Willensfreiheit usw. nichts zu tun, sondern ist reine Physiologie. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.01.2018 um 05.39 Uhr |
|
Die beste Zusammenfassung der sprachkritischen Antithese zur "Bewußtseinsforschung" findet man hier: http://info.sjc.ox.ac.uk/scr/hacker/docs/Consciousness%20a%20Challenge.pdf Was noch fehlt, ist die sprachwissenschaftliche Untersuchung: Wie wächst ein Kind in die zwar junge, aber heute tief verwurzelte mentalistische Redeweise hinein, oder andersherum: Wie wird sie in das Kind hineingeredet? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.01.2018 um 06.26 Uhr |
|
In der FAS (14.1.18) versucht sich eine norwegische Forscherin am „harten Problem“ des Bewußtseins und kommt ungefähr zu dem Schluß, daß nicht das Bewußtsein, sondern die Materie erklärungsbedürftig sei oder so ähnlich. Sie legt es sich nach Philosophenart irgendwie zurecht, mit Galilei, Leibniz, Kant und Neueren wie Crick und Chalmers, Hardware und Software. Aber schon die Frage, wie Bewußtsein (das sie auch Tieren zuschreibt) in die Welt komme, ist falsch gestellt. Ihre tiefe Gewißheit von der Gegebenheit des Bewußtseins dürfte allerdings nicht zu erschüttern sein, sie ist weit vom sprachanalytischen Denken entfernt. Ich konnte es darum nicht gründlicher lesen, weil ich Satz für Satz nicht verstehe, worum es geht, außer um die sattsam bekannte Wortemacherei. – Gegenrede ist zu erwarten, aber ebenso uninteressant. (Bewußtsein ist keine Tatsache, sondern eine sprachliche Konvention. Innerhalb der Sprache kann man deren „Grammatik“ [Wittgenstein] bzw. „Geschäftsordnung“ [Ickler] nicht anfechten.)
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.01.2018 um 09.52 Uhr |
|
Wolfgang Prinz glaubt auch, daß die Untersuchung von Handlungen stärker die Umgebung berücksichtigen muß als die Untersuchung der Wahrnehmung. Der „Wahrnehmungsinhalt“ z. B. hänge einfach von den Eigenschaften des Reizmaterials ab (13). Das wird aber der Vielfalt der Bedingungen nicht gerecht, unter denen wir etwas klassifizieren (und entsprechend benennen). Eine Tasse, ein Henkel usw. sind nicht einfach durch Merkmale gekennzeichnet (vgl. Wierzbickas Untersuchung zu Gefäßbezeichnungen). Erst recht ist die Verwendung von "Vorstellung" und anderen scheinbar rein deskriptiven Ausdrücken in einen Typ von komplizierten Geschichten (Dialogspielen) eingespannt. Kurzum: Wahrnehmung ist ebenso konstruktiv wie Handlung.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.01.2018 um 06.05 Uhr |
|
Wolfgang Prinz ist ein typischer Vertreter der "kognitiven Psychologie". Er erkennt also die Alltagspsychologie grundsätzlich an mit ihren "Vorstellungen" und "Absichten", die an "Handlungen" mitwirken: "Dass sie daran mitwirken, daran besteht kein Zweifel.“ (Wolfgang Prinz, Hg.: Experimentelle Handlungsforschung. Stuttgart 2014:14) Natürlich nicht, aber das ist keine Erkenntnis, sondern die Explikation unseres Sprachgebrauchs. Wer deutsch spricht, kann nicht bestreiten, daß Absichten zu Handlungen führen usw. – "Experimente", die man unter diesen Voraussetzungen anstellt, können auch nichts anderes ergeben, weil sie ja die "Folk psychology" immer schon enthalten und weitertragen. Kognitive Psychologen fragen dann, wie Absichten usw. "repräsentiert" sind, als wären es wirkliche Objekte und nicht sprachliche Konstrukte (s. Haupteintrag). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.01.2018 um 20.54 Uhr |
|
Rot und Grün schließen einander aus, so die übliche Ansicht. Brentano bestritt das (Untersuchungen zur Sinnespsychologie). Er meinte, Olivgrün sei ein Grün mit Rotbeimischung. Ich halte das für eine Täuschung. Hier ist zunächst das Farbmuster: https://www.ralfarbpalette.de/ral-6003-olivgrun Das Grün ist in Richtung eines Graubraun eingetrübt, und von da aus wäre ein Übergang zu Rot vorstellbar (über braune und dann rotbraune Zwischenstufen). Aber im Maße dieser Eintrübung kann man auch schon nicht mehr von Grün sprechen, eher von Grüngrau bis Braungrau. (Diese Probleme wurden im 19. Jahrhundert breit diskutiert und haben noch Wittgenstein beschäftigt.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.12.2017 um 17.51 Uhr |
|
Erst nach hunderttausend Jahren sollen die Menschen entdeckt haben, womit sie am vertrautesten sind – ihr „Bewußtsein“ oder „Ich“, die „Tatsachen des Bewußtseins“, ihre ganz private „innere Welt“ (vgl. die anderen Phrasen, die im Haupteintrag angeführt sind). Das leuchtet von vornherein nicht ein. Die Spätheit erklärt sich so: Die philosophische Sondersprache mußte erst so weit ausgearbeitet werden, daß ihre Sprecher es nicht mehr bemerkten, wenn sie Leerlauf hervorbrachten (in meiner Redeweise: die Geschäftsordnung der Sprache mit einem Geschäft verwechselten). Dazu trug die Existenzform bezahlter akademischer Stellungen bei, die sich mit dem Lesen und Verfassen von Texten begnügt und daher nicht von der Folgenlosigkeit ihres Tuns widerlegt werden kann. Urbild ist Husserl, der am Schreibtisch sitzt und die ganze Welt „ausschaltet“ oder „einklammert“. Riddikulus! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.09.2017 um 05.40 Uhr |
|
Evolution erklärt die „anscheinende Absichtlichkeit“ (Schopenhauer) in der Natur. Damit erledigt sich der Schöpfungsglaube samt teleologischen Gottesbeweisen. „Intelligent Design“ usw. sind Versuche zu retten, was nicht zu retten ist. Strukturell gleichartig ist die Konditionierung des Verhaltens, und die Aufgabe besteht darin, auch hier die Intentionalität zu naturalisieren und damit den Anschluß an die Naturwisenschaften zu gewinnen. Dem steht vor allem die gewohnte Sprache entgegen, die ein untilgbares intentionales (folkpsychologisches) Idiom umfaßt. Trotzdem ist es möglich, für wissenschaftliche Zwecke den eingebauten Mentalismus zu vermeiden. Nicht die „Absicht“, sondern die Konditionierungsgeschichte erklärt, warum ein Organismus sich so oder so verhält. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.09.2017 um 19.03 Uhr |
|
Ob Systeme (Organismen oder Maschinen) Bewußtsein haben, ist keine sachliche Frage und läßt sich nicht empirisch entscheiden. Es geht vielmehr darum, ob und ab wann wir Systemen zweckmäßigerweise eine „innere Welt“ (im metaphorischen, „transgressiven“ Sinn) zuschreiben. Das „Zuschreiben“ wird aber oft zu theoretisch-philosophisch aufgefaßt, als bestünde es in Aussagen oder expliziten Annahmen über „andere Geister“ (other minds). Es handelt sich mehr um ein praktisches Verwenden einer nicht besonders konsistenten psychologischen Redeweise in Dialogspielen. Die bloße Beobachtung von noch so komplizierten Problemlösungen (Gesichtererkennung usw.) genügt nicht, das kann immer rein „mechanisch“ sein. |
Kommentar von , verfaßt am 05.06.2017 um 17.01 Uhr |
|
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 07.05.2017 um 23.37 Uhr |
|
Übergangslose Kraftänderungen finden z.B. in allen Waschmaschinen beim Ein-, Aus- und Umschalten des Motors während des Waschprogramms statt. (Bei Elektromotoren sind die Einschaltströme ein Vielfaches der Betriebsströme.) Die dabei entstehenden elektrischen Oberwellen (Störfrequenzen) müssen an der Rückwirkung ins Stromnetz und der Einwirkung auf den Stromzähler und die Strommessung mittels eines Störschutzfilters, also eines Tiefpasses aus Kondensatoren (Kapazitäten) und Spulen (Induktivitäten), gehindert werden, der gleich am Strom-Eingang jeder Waschmaschine sitzt und aussieht wie ein großer Elektrolytkondensator. Diese durch rechteckförmige Stromänderungen entstehenden Oberwellen sind also nicht nur Theorie, sondern meßtechnisch nachweisbar.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 07.05.2017 um 22.33 Uhr |
|
Für einen wirklichen Ruck, z. B. wenn sich die Kraft oder Beschleunigung übergangslos von null auf einen konstanten Wert größer als null ändert oder umgekehrt, braucht man keine komplizierte Rechnung, das können Schüler im 6. oder 7. Schuljahr. Kompliziert kann es erst werden, wenn es eigentlich gar keinen idealen Ruck gibt, sondern allmähliche (mehr oder weniger schnelle) Übergänge. Die würde ich gar nicht Ruck nennen, aber ich bin für die Benennung in der Physik nicht zuständig. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 07.05.2017 um 12.19 Uhr |
|
Eine "ruckartige" Bewegung oder Kraftänderung (Kraft = Masse mal Beschleunigung) oder Signaländerung kann mathematisch nur erfaßt (berechnet) werden, indem sie mittels Fourier-Analyse in einzelne sinusförmige Funktionen zerlegt wird. Extrembeispiel Dirac-Stoß. Das war Grundlage für die Bandbreitenberechnung in der analogen Nachrichtentechnik: je rechteckiger die Zeitfunktion, desto breiter das zugehörige Frequenzspektrum von Sinusfunktionen, genannt "Oberwellen". (Welche genau, ergibt die Fourier-Analyse.)
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 07.05.2017 um 00.28 Uhr |
|
Die Bedeutung von Ruck wird in etymologischen Wörterbüchern (Paul oder dtv) als plötzliche, durch einen Stoß verursachte Bewegungsänderung beschrieben. Daher ist die fachsprachliche Verwendung in der Physik für eine allmähliche Änderung der Beschleunigung schon recht seltsam. Wikipedia behauptet aber sogar: "Diese physikalische Bedeutung von Ruck ist weitgehend gleich der umgangssprachlichen Wortbedeutung." Mit der umgangssprachlichen ist wohl die übliche, nicht fachsprachliche Bedeutung gemeint. Ich halte das für Unsinn. Ein Ruck ist im normalen Sprachgebrauch immer etwas Plötzliches, Sprunghaftes, Stoßartiges, Unstetiges. Das hat mit der physikalischen Verwendung (Ableitung der Beschleunigung) gar nichts zu tun. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 06.05.2017 um 22.39 Uhr |
|
Wann wurde eigentlich der "Ruck" als die Beschleunigungs-Änderung in die Physik-Lehrbücher und -Formelsammlungen eingeführt? j(t) = da/dt = d²v/dt² = d³x/dt³ [m/s³]. Roman Herzog hat ihn nicht erfunden.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.05.2017 um 07.34 Uhr |
|
Unser typischer Kausalsatz mit weil geht, wie die durchsichtige Etymologie verrät, auf einen Temporalsatz zurück. Die Konjunktion da halte ich anders als alle Grammatiken überhaupt nicht für kausal, sondern für einen Evidenzmarker, der es dem Hörer überläßt, die Beziehung zwischen zwei Sachverhalten selbst herzustellen. Genau ebenso wirkt ja, die umgangssprachliche Begründung schlechthin (mit Hauptsatzstellung, s. syntaktische Ruhelage). Die "menschliche" Komponente kommt auch in anderen Wörtern kausaler Bedeutung zum Ausdruck, etwa dank und Entsprechungen in anderen Sprachen: lat. gratia usw. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.05.2017 um 06.44 Uhr |
|
Man könnte auch hier noch einmal anknüpfen: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#33544 Der Physiker (Naturwissenschaftler überhaupt) "schubst die Dinge herum" und faßt das, was er dabei beobachtet, in eine nicht-intentionale, wenn möglich mathematische Sprache. Aber mit seinen Kollegen unterhält er sich im intentionalen Idiom, sonst würden sie es nie schaffen, sich mittags in der Kantine zu treffen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.05.2017 um 04.42 Uhr |
|
Sehr viel. Es ist ja gerade das Interessante, daß unsere Sprache ganz von anthropomorphistischen Bildern durchdrungen ist oder, wie ich lieber sage und anderswo schon ausgeführt habe, zur Hälfte ein "intentionales Idiom" ist. Wir können nun zum Beispiel nachsehen, wie die einzelnen Sprachen im Laufe ihrer Geschichte die Vorstellung eines Verursachens ausdrücken. Wie Sie mit Recht in Erinnerung bringen, gehört auch "Gesetz" in diesen Zusammenhang, aus dem Rechtswesen und damit "soziomorph". Auch die Modalitäten "Notwendigkeit" und "Möglichkeit" sind menschlich-allzumenschlich. Ich habe schon gezeigt, wie sie auf Dialogspiele (Wollen als Ankündigen usw.) zurückgeführt werden können. An Ihren Beispielen "Druck" und "Kraft" kann man sehen, wie die Physik die Begriffe von allzumenschlichen Komponenten zu befreien versucht. Es sind jetzt nur noch aus praktischen Gründen beibehaltene Zusammenfassungen. Der elektrische "Widerstand" ist ein weiteres Beispiel. S.a. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1548 (Eine reichhaltige, wenn auch im Kern naive und fehlerhafte Diskussion dieser Probleme bietet Geert Keil: Kritik des Naturalismus. Berlin, New York (1993). Keil hat auch zum Homunkulus Lesenswertes geschrieben.) |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 05.05.2017 um 23.06 Uhr |
|
Ich glaube, physikalische "Gesetze" wurden entwickelt, um technische Vorgänge berechenbar und vorhersagbar zu machen und um diese Berechnungen allgemein nachprüfbar zu machen.
|
Kommentar von Klaus Achenbach, verfaßt am 05.05.2017 um 19.11 Uhr |
|
Ernst Mach: "In der Natur gibt es keine Ursache und keine Wirkung." Das mag – so wie Mach es gemeint hat, was ja noch näher im Zusammenhang zu untersuchen wäre – richtig sein. Aber Physik ist keine Naturerscheinung, sondern eine menschliche Geistestätigkeit. In der Natur gibt es auch keine physikalischen Gesetze, übrigens ein Begriff aus dem Rechtswesen, das aber in der Physik eine neue Bedeutung angenommen hat. Überhaupt gibt es in der Physik wie auch in der Mathematik und anderen Wissenschaften viele „anthropomorphistische“ Begriffe, so etwa „Druck“ oder „Kraft“, die deshalb nicht aufhören, physikalische Begriffe, ja physikalische Größen zu sein. Natürlich könnte der Laplacesche Geist ein Gas mit einigen Trilliarden Bewegungsgleichungen für die Gasmoleküle vollständig beschreiben, ohne jemals vom „Druck“ des Gases zu reden. Der Physiker kann das nicht und zieht es vor, vom meßbaren „Druck“ zu reden. Was hat diese etwas esoterische Angelegenheit denn mit Sprache und speziell mit dem „Kausalsatz“ zu tun? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.05.2017 um 04.19 Uhr |
|
Vielen Dank, Herr Riemer, Sie haben genau formuliert, was ich sagen wollte, aber anscheinend nicht klar genug ausgedrückt habe. Gegen die Trivialisierung des Problems darf ich vielleicht noch einmal auf das Zitat aus dem großen Werk Ernst Machs hinweisen, der bestimmt kein Dummkopf war. Man könnte die Zerlegung natürlicher Abläufe in Ursache und Wirkung anthropomorphistisch nennen; aus meiner Sicht eher personalistisch und damit "soziomorph", wie denn auch der gerichtliche Ursprung unserer Ursachen-Begriffe auf die Gesellschaft verweist. Wie ich schon unter "Naturalisierung der Intentionalität" gezeigt habe, ist die Ursituation der Rechtfertigungsdialog: Wer hat das getan – und warum? Dieses Schema übertragen wir dann auf die Natur. Auch in der griechischen Naturphilosophie gibt es das Erklärungsschema nach Schuld und Versöhnung, immerhin schon ohne einen Gott und damit einen Schritt weiter in Richtung Naturwissenschaft (Entmythologisierung). Je genauer man hinschaut, je stärker die Lupe, desto schwerer fällt es, von Ursache und Wirkung zu sprechen. Die "Wahlverwandtschaften" (Affinitäten) der chemischen Elemente können einen auf poetische (alchemistische) Gedanken bringen, aber die Atomphysik treibt uns solche Flausen aus. Machs kritischer Gedanke bestreitet natürlich weder die Alltagstauglichkeit des Ursachenbegriffs noch die Naturgesetze. Ich muß hier immer an die zauberischen ersten Absätze von Stifters "Abdias" denken. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 04.05.2017 um 21.58 Uhr |
|
Jeder weiß, was mit Ursache und Wirkung gemeint ist, niemand bestreitet ja, daß es beides gibt und daß man Abläufe so bezeichnen kann. Die Frage ist nur, ob es physikalische oder subjektive, philosophische Sachverhalte/Kategorien sind. Ich meine auch, es sind keine physikalischen Sachverhalte. Die Physik beschreibt die Bewegung der Materie. Keine Bewegung ist "Ursache" einer anderen. Alle Bewegungen laufen so ab, wie sie aufgrund der physikalischen Gesetze nicht anders können, oder eben mit den Freiheiten, die sie aufgrund der Physik haben. Wir sehen von unserem subjektiven Standpunkt die Bewegung in ihrem zeitlichen Ablauf und nennen das Frühere die Ursache und das Spätere die Wirkung. Aber rein physikalisch ist das eine schon im andern enthalten. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 04.05.2017 um 19.39 Uhr |
|
Statt von strengen Kausalitäten würde ich lieber von Wahrscheinlichkeiten sprechen.
|
Kommentar von Klaus Achenbach, verfaßt am 04.05.2017 um 19.35 Uhr |
|
Gestern bin ich gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen; seitdem habe ich sehr starke Kopfschmerzen. Woran mag das wohl liegen? Vielleicht ein quantenmechanischer Zufallseffekt? Oder pures Chaos wegen nichtlinearer Gleichungen? Ist das Semikolon im ersten Satz womöglich falsch, weil es einen Ursache-Wirkung-Zusammenhang suggerieren könnte? Auch die darauf folgende Frage ist wohl unzulässig, da sie auch einen nichtexistenten Kausalzusammenhang nahezulegen scheint. Jedenfalls brauche ich mir über die Klimaerwärmung keine Gedanken zu machen. Da es keine Ursachen gibt, kann das Kohlendioxid nicht schuld daran sein – erst recht nicht der Mensch. Also trete ich ich noch fester aufs Gaspedal meines Achtzylinders. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.05.2017 um 04.34 Uhr |
|
Die Etymologie verrät schon, daß es sich bei "Ursache" um einen Begriff aus dem Gerichtswesen handelt (ebenso wie beim lateinischen Vorbild und im Griechischen). "Wer ist schuld?" – Darum geht es. Aristoteles hat die menschlich-allzumenschlichen Bedeutungsvarianten als erster herausgearbeitet. Bei Kant bleibt ein "gesetzmäßiger" Zusammenhang der Phänomene übrig, ohne den wir eben nicht von Wirklichkeit sprechen würden. "Kausalität" ist ein philosophischer Oberbegrifft; ungefähr dasselbe wie "Determinismus" oder "Determiniertheit". Außer den philosophischen "Klassikern" hatte ich dazu in letzter Zeit gelesen: https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/.../zufall_notwendigkeit.pdf (Schlichting) https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/fachbereich_physik/didaktik_physik/publikationen/kausalit_t___die_verpflichtung.pdf (Schlichting) https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P331.PDF (Engler) http://www.physik.uni-leipzig.de/~uhlmann/PDF/Uh63bb.pdf (Uhlmann) https://edoc.bbaw.de/files/36/II_05_Reich.pdf (Reich) www.burghardt-koeln.de/franzj/publik/kausalge.pdf (Burghardt) Das ist durchweg verständlich und recht interessant geschrieben. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 03.05.2017 um 21.07 Uhr |
|
Man kann fast alle physikalischen Ereignisse mit den Wechselwirkungen von Feldern, Wellen und Teilchen erklären.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.05.2017 um 14.27 Uhr |
|
Ich meinte (nicht besonders originell), daß die Zerlegung von Wirklichkeitsausschnitten in zwei Teile, die wir dann Ursache und Wirkung nennen, nur einem allzu menschlichen Mangel an Übersicht entspringt. Die Dinge sind, wie sie sind; die Ereignisse laufen einfach ab. Die Schrägstellung der Erdachse und die Unterschiede in der Beleuchtung werden nur willkürlich als zweierlei ausgedrückt. Die Schwerkraft ist nicht verschieden von der Bewegung der Körper unter ihrer Wirkung (wie man sagt). Die Physik stellt alle möglichen Zusammenhänge fest und beschreibt sie als Funktionen. Ursache und Wirkung sind überflüssig. Gerade läuft Wasser an den Fensterscheiben herunter ("Mai kühl und naß..."); was mag die Ursache sein? Es ist aber nur ein Teil der Gesamterscheinung, daß es eben regnet. |
Kommentar von Gunther Chmela, verfaßt am 03.05.2017 um 11.18 Uhr |
|
"Gibt es z. B. ein Symbol für "Ursache" wie für "Zeit" oder "Beschleunigung"?" Diese Frage, als Argument betrachtet, entkräftet doch das Kausalitätsprinzip nicht. Für "Ursache" kann es kein Symbol in der Physik geben, da hierfür ja von Fall zu Fall ganz unterschiedliche physikalische Größen in Frage kommen (Licht, Kraft, Magnetismus usw.), die dann allerdings genau definierbar und u. U. bestimmbar sind. Es kann aber sein, daß ich die hier angesprochene Problematik nicht verstehe. Wenn Sie z. B. einen Nagel in ein Brett schlagen wollen, dann werden Sie doch ohne weiteres nach einer geeigneten Ursache suchen, die genau diese Wirkung hat, nämlich den Nagel ins Holz zu treiben. Sie werden also ohne lang nachzudenken nach einem Hammer greifen und eben diese Ursache (Kraft) wirken lassen. Daß in der Natur jede Ursache selbst wieder die Wirkung von etwas anderem sein kann (meistens auch ist), das ändert doch am Kausalitätsprinzip nichts. Auch Kreisprozesse, bei denen sich Ursache und Wirkung regelmäßig abwechseln, stellen für mich keinen Widerspruch dar. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, man solle die Aussage, die Schiefstellung der Erdachse sei die Ursache für das Auftreten von Jahreszeiten, nicht allzu ernst nehmen? Man braucht sich doch nur einmal vorzustellen, was geschehen würde, wenn die Erdachse sich plötzlich senkrecht zur Ekliptik stellte. Aber wie sagt, es mag sein, daß ich die Problematik nicht verstehe. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.05.2017 um 19.53 Uhr |
|
Im Zusammenhang mit Kausalsätzen habe ich schon mal den berühmten Satz von Ernst Mach zitiert: "In der Natur gibt es keine Ursache und keine Wirkung." (Ernst Mach: Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt, Darmstadt 1988:524, 1883:459) Wir trennen Ursache und Wirkung nur aus Mangel an Übersicht. Die regelmäßige Folge der Jahreszeiten stellt uns zunächst vor ein Rätsel. Wenn wir den Zusammenhang erkannt haben, sagen wir wohl: "Die Schrägstellung der Erdachse zur Ekliptik ist die Ursache der Jahreszeiten." Das darf man aber nicht so ernst nehmen. Angeblich ist Kausalität ein physikalischer Begriff, aber soviel ich weiß, kommt er in der Physik nicht vor und wird nicht benötigt. Freilich steht im Lexikon der Physik (Spektrum): "Kausalität, eines der grundlegenden Konzepte der modernen Physik, welches besagt, daß in der Natur nichts ohne Grund passiert, d.h. zu jedem Ereignis (Wirkung) ein anderes (Ursache) existiert, das a) in seiner Vergangenheit liegt und b) zwingende Voraussetzung für das Eintreten der Wirkung ist. Ursache und Wirkung bilden somit eine kausale Kette, die unter gleichen Bedingungen immer gleich abläuft." Aber das ist nicht Physik, sondern Philosophie der Physik. (Gibt es z. B. ein Symbol für "Ursache" wie für "Zeit" oder "Beschleunigung"?) „Der Begriff der kausalen Notwendigkeit ist nichts anderes als ein letzter Rest einer animistischen Weltauffassung.“ (Wolfgang Stegmüller) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.04.2017 um 16.29 Uhr |
|
In einem sonst nicht weiter erwähnenswerten Aufsatz erklärt Hans-Werner Eroms herunterwerfen für ein „nichtintentionales Verb“: Er hat mir die schöne Vase heruntergeworfen. Da er kein Kriterium intentionaler Verben angibt, könnte man die Sache auf sich beruhen lassen. Ich glaube aber zu wissen, welcher Gedanke dahintersteht. Meistens fällt einem ja die Vase versehentlich herunter, also ohne Absicht. Aber gerade dies, daß man sagen kann Er hat die Vase versehentlich heruntergeworfen, beweist, daß herunterwerfen ein Handlungsverb, also intentional ist. Dagegen ist verlieren nichtintentional, und man kann nicht sagen: Er hat den Schlüssel versehentlich verloren. Das passiert einem einfach, man tut es nicht. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 15.10.2016 um 23.17 Uhr |
|
zu "mein Vater", #33502: Dazu paßt auch: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=347#24673 |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.10.2016 um 17.11 Uhr |
|
Wenn unsere Grammatiken von "Belebtheit" sprechen, meinen sie meistens so etwas wie Personhaftigkeit. Die Dudengrammatik unterscheidet in naiv-ontologisierender Weise Konkreta und Abstrakta, als ob das zwei Arten von Objekten wären. Die Konkreta umfassen dann Belebtes und Unbelebtes, und unter den Belebten werden Bäume und Algen genannt. Das ist also rein biologisch gedacht. Aber es ist linguistisch völlig belanglos, denn welche grammatischen Folgen soll es haben? Wenn anschließend auch Abstrakta wie Firma als u. U. belebt eingeordnet werden (Die Firma lädt ein...), ist ein ganz anderes Kriterium der Belebheit zugrunde gelegt, nämlich die sprachliche Behandlung von Substantiven als Subjekt von Handlungsverben. "Person" dagegen brauchen wir bei der Passivbildung, bei der Kasuslehre usw.
s. auch hier: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1124 http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=347#24596 |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.10.2016 um 14.13 Uhr |
|
"physische" fehlt. Durch den Oberbegriff wirkt es tautologisch, ist es aber nicht. Das Auto simuliert nur Kommunikation, die Zeichen sind ja von uns eingebaut. Anders wäre es, wenn Maschinen in Interaktion miteinander und auch mit uns ein Zeichensystem entwickelten. Dazu müßten sie in einer gemeinsamen Welt leben und unter Selektionsdruck stehen (ums Überleben kämpfen). Bisher müssen wir dem Roboter beibringen, wann er zur Steckdose laufen und den Akku aufladen soll. Das ist keine Evolution. Evolvierte Roboter würden zur Steckdose laufen, weil alle, die das nicht getan haben, ausgestorben sind. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 15.10.2016 um 13.52 Uhr |
|
Übersetzt: Gegenstände, mit denen wir nicht in gesellschaftlichen Verkehr treten können, sind bloß Gegenstände. Allerdings kann man heute seinem Auto Fragen stellen und auch Antworten bekommen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.10.2016 um 13.14 Uhr |
|
"Jene Objekte, mit denen wir keinen gesellschaftlichen Verkehr abwickeln können, sind physische Objekte." ("The objects with which we cannot carry on social intercourse are the physical objects of the world." George H. Mead: Mind, Self, and Society. 1934:184) Anders gesagt: Wesen, mit den wir kommunizieren können, statt sie bloß herumzuschubsen, sind Personen, wenn auch nicht im juristischen Sinn. Dieser Personbegriff zieht sich durch die ganze Sprache (soweit eben "Intentionalität" reicht). Wenn wir mit jemandem reden, lösen wir nicht einfach eine Reaktion aus, sondern unterbreiten gewissermaßen die Rede einem Adressaten, so daß er darauf zustimmend oder ablehnend reagieren kann (s. Haupteintrag). Tieren können wir in abnehmendem Grade solche Empfänglichkeit zuschreiben. Natürlich ist mit "reden" hier jeder Austausch von Zeichen, jede Kommunikation gemeint (erweiterter Begriff von Sprachverhalten wie bei Skinner, s. Kap. 1 von "Verbal Behavior"). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.10.2016 um 04.07 Uhr |
|
Leider kommt es immer wieder vor, daß ein Jäger seinen Waidgenossen erschießt, obwohl er eigentlich einen Hirsch schießen wollte. In solchen Fällen löste sich nicht etwa versehentlich ein Schuß aus der unglücklich gehaltenen Waffe, sondern der Schütze zielte nur zu gut und drückte ab, mit Absicht also. Trotzdem würde man nicht sagen, er habe absichtlich seinen Jagdfreund erschossen. Das Schießen erfolgte also zugleich absichtlich und unabsichtlich. Philosophen stellen den Fall gern so dar, als sei ein und derselbe Vorgang „unter einer Beschreibung“ absichtlich geschehen, „unter einer anderen Beschreibung“ unabsichtlich. So etwas komme nur bei Handlungen vor. „Im Bereich der sogenannten natürlichen Phänomene ist es nicht möglich, daß ein und dieselbe Sache unter verschiedenen Beschreibungen verschiedene Eigenschaften hat.“ (Edmund Runggaldier: Was sind Handlungen? Eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Naturalismus. Stuttgart 1996:43) Auch natürlichen Phänomenen können verschiedene und sogar widersprüchliche Eigenschaften zukommen. Zum Beispiel kann etwas zugleich hell und dunkel sein. Das hängt vom Vergleichspunkt ab, denn hell und dunkel sind relationale Begriffe. Dasselbe gilt für die „Absicht“. Wenn man nur sagt, der Schuß sei mit Absicht abgegeben worden, behandelt man den Relationsbegriff wie einen Eigenschaftsbegriff. Man läßt offen, worauf die Absicht gerichtet war, und spielt dann nur noch mit Worten. Das taten schon die Sophisten, wie man in Platons „Euthydemos“ sehen kann: Wenn mein Hund Kinder hat, ist er „Vater“, und da er auch „meiner“ ist, ist er mein Vater, und ich bin der Sohn eines Hundes usw. Das ist genau dasselbe wie das absichtliche Erschießen eines Jagdgenossen und lohnt kaum der Mühe logischer Aufklärung. Trotzdem diskutieren Philosophen endlos weiter. |
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 07.09.2016 um 09.28 Uhr |
|
»Peter will/soll/darf singen« drückt nicht aus, daß Peter in der aktuellen Welt singt, sondern daß er in der aktuellen Welt singen will/soll/darf. Wenn man den Unterschied zwischen Singen und Singen-Wollen/-Sollen/-Dürfen erklären will, wird man nicht umhinkönnen, die Bedeutung von Wollen, Sollen und Dürfen zu beschreiben. Die Einführung einer zweiten Welt erscheint mir nutzlos, solange damit nur gesagt werden soll, daß Tun und Wollen/Sollen/Dürfen nicht identisch sind, denn das ist ja schon gleich zu Anfang festgestellt worden (»drückt nicht aus, dass Peter in der aktuellen Welt singt«). Außerdem: Wieso besteht das Ereignis von Peters Singen in einer Welt, in der alles wahr ist [= in der alles geschieht?], was er will? Dieses Ereignis könnte sich ebensogut in einer Welt vollziehen, in der nur ein Teil dessen wahr ist, was er will, darunter eben auch das Singen, aber zum Beispiel nicht das Tanzen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.09.2016 um 07.31 Uhr |
|
„(26) Peter will/soll/darf singen. (26) drückt nicht aus, dass Peter in der aktuellen Welt singt; vielmehr besteht das Ereignis von Peters Singen in einer Welt, in der alles wahr ist, was Peter will, soll oder darf.“ (Rapp/Wöllstein in Jörg Meibauer/Markus Steinbach/Hans Altmann (Hg.): Satztypen des Deutschen. Berlin, Boston 2013:347) Ist diese Darstellung im Rahmen einer „Mögliche-Welten-Semantik“ wirklich besser als eine naturalistische Erklärung von Intentionalität? Kann man sich unter einer „Welt, in der alles wahr ist, was Peter will, soll oder darf“, etwas vorstellen, oder soll und darf man das gar nicht, weil es nicht so gemeint ist, sondern als rein logisches Konstrukt – aber was ist damit gewonnen? Was heißt überhaupt, alles, was Peter will, soll oder darf, sei in dieser Welt „wahr“? Ist das, was er nicht soll oder darf, vielleicht auch wahr, oder braucht man dazu wieder eine andere Welt? Und so für jeden erdenklichen Satz? Ich lasse mich ungern mit so etwas abfertigen. Ich bilde mir geradezu ein, besser erklären zu können, was der Ausgangssatz bedeutet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.08.2016 um 04.12 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#28099 Die Präpositionen aus und vor können die Ursache eines Verhaltens ausdrücken, aus bei einer Absicht (aus Gier), vor bei einem Zwang (vor Kälte/Hunger). Aber gerade die Unabsichtlichkeit setzt voraus, daß das betreffende Agens einer Absicht fähig ist. Wasser kann nicht vor Kälte gefrieren. Ob eine Spinne sich vor Kälte nicht bewegen kann, ist doch recht zweifelhaft. Wenn Wollen (Absichtlichkeit) so mit Ankündigung, also Sprache, verbunden ist, wie ich es dargestellt habe, können nur sprachfähige Organismen im eigentlichen Sinn etwas wollen. Sagen wir, ein Hund verkrieche sich "vor Angst", dann personifizieren wir ihn schon. Typisch sind Ausdrücke wie vor Hunger nicht schlafen können, was ja auch ein Wollen voraussetzt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.07.2016 um 17.04 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#28099 Auch vor Geldgier kommt zwar oft vor, aber die meisten Belege sind nicht einschlägig (vor Geldgier warnen usw.) oder archaisch. etwas aus Geldgier verraten deutet auf Berechnung hin, etwas vor Geldgier verraten auf Unvorsichtigkeit. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.05.2016 um 06.45 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#28802 Zum Unterschied von Geschäftsordnung und Geschäft (in meinem Sinne): 1. Der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesversammlung gewählt. (GG Art. 54,1) 2. Der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesversammlung gewählt. (Protokoll) Derselbe Satz in grundverschiedenen Funktionen. Man hält den Satz Es fühlt sich für mich irgendwie an, ein Mensch zu sein/Th. I. zu sein oder den Satz Ich habe Bewußtsein für Typ 2, während sie in Wirklichkeit Typ 1 sind. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.04.2016 um 05.20 Uhr |
|
In unzähligen neueren Abhandlungen habe ich gelesen, daß "jemandem etwas geben" zu analysieren sei als "verursachen, daß jemand etwas hat". Ein Beispiel: Emil gibt Anna seine Brieftasche wird aufgelöst in „Emil macht, dass Anna die Brieftasche hat. CAUSE (Emil, POSS (Anna, Brieftasche))“ (Klaus Welke: Einführung in die Satzanalyse. Die Bestimmung der Satzglieder im Deutschen. Berlin, New York 2007:178; fehlende Klammer ergänzt) Die pseudo-logische Notation täuscht darüber hinweg, daß schon die Übersetzung grundfalsch ist. Man kann auf viele Arten dafür sorgen, daß Anna die Brieftasche hat, ohne sie ihr zu geben. Der springende Punkt ist die Eliminierung des Dativs. mit dem diese Logizisten nichts anfangen können. Ähnlich funktioniert die Auflösung des Pertinenzdativs: Er klopft mir auf die Schulter soll dasselbe sein wie Er klopft auf meine Schulter, was natürlich nicht stimmt. Ich habe auch schon daran erinnert, daß "POSS" nur ein Kürzel für einen Ausschnitt der sozialen Ordnung ist, auch wenn die Logizisten irrigerweise dazu neigen, es in eine Teil-Ganzes-Relation aufzulösen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.04.2016 um 17.40 Uhr |
|
Sprechen und Denken können nicht dasselbe sein, aber das ist keine Tatsachenfrage, sondern eine philosophische, also begriffskritische. Sprechen ist ein beobachtbares Verhalten, Denken dagegen ein Konstrukt, und zwar wurde es gerade deshalb in die naive psychologische Sprache (folk psychology) eingeführt, weil man es vom Sprechen unterscheiden wollte. "Ich habe es nicht gesagt, aber gedacht" usw. sind Äußerungen, die den unverrückbaren Platz dieses Wortes in der Allgemeinsprache markieren. Natürlich kann jemand kommen und das Wort völlig anders definieren ("Denken ist Informationsverarbeitung im Gehirn" usw.), aber das wäre dann eben ein ganz anderer Begriff und hätte nichts mit der traditionellen Ausgangsfrage zu tun. Beweis: "Wenn du sagst, du hast es nicht gesagt, aber gedacht – meinst du dann die Vorgänge in deinem Gehirn?" "Nein, davon weiß ich nichts." Allgemeiner: Man braucht nicht das geringste vom Hirn zu wissen, um das Wort denken perfekt zu beherrschen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.03.2016 um 06.20 Uhr |
|
Die Unhintergehbarkeit der Erlebnissprache ist kein Hindernis. Wir sind ja auch an die Sinnesorgane gebunden, mit denen wir aber Meßgeräte beobachten, die darüber hinausgehen. Infrarot und Ultraviolett lassen sich ebenso gut untersuchen wie die sichtbaren Farben. Wir beobachten die mikroskopische Welt mit makroskopischen Geräten. So können wir auch in der Verhaltensanalyse von der Erlebnissprache absehen, was beim Verhalten von Tieren selbstverständlich ist. Es ist kein Widerspruch, auch kein „pragmatischer“, wenn ich das menschliche Verhalten untersuchen „will“, ohne den Begriff „Wollen“ zu benutzen, d. h. ohne Absichten zu unterstellen. Ich kann auch „über“ etwas sprechen, ohne Referenz („Aboutness“) anzuerkennen usw.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.01.2016 um 10.33 Uhr |
|
„Eine Geste ist ein absichtliches, gerichtetes kommunikatives Verhalten. Woher aber will man wissen, welche Handbewegung eines Schimpansen intendiert und welche reiner Zufall ist?“ (FAS 3.1.16, über Affen) Der Text zeigt die philosophische Unbelehrtheit, die man auch in der Fachliteratur sehr oft antrifft. Absichtlichkeit, Intentionalität und Gerichtetheit lassen sich aus begrifflichen, nicht aus empirischen Gründen nicht beobachten, es sind mentalistische Interpretationen. Auch ist Zufälligkeit nicht das Gegenteil von Intentionalität. Es fehlt ein naturalistischer Zeichenbegriff (s. meinen Haupteintrag). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.11.2015 um 12.37 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#28802 Ich hatte schon mal zitiert: "Eine Entität hat 'Bewußtsein', wenn es für diese Entität irgendwie ist, diese Entität in dieser oder jener Weise zu sein." Es gibt aber zahllose Varianten desselben Gedankens (der auf Thomas Nagel zurückgeht), so daß es auf den Autor nicht ankommt. Mir ist schlecht. Ich fühle mich wohl – das hat Sinn, aber Mir ist irgendwie. Ich fühle mich irgendwie – das hat keinen Sinn. Es ist derselbe Unterschied wie zwischen einem ausgefüllten und einem unausgefüllten Bestellschein. Die sehen einander sehr ähnlich, aber der ausgefüllte ist eine Anweisung an die Bibliothek, der unausgefüllte nicht – ein Unterschied ums Ganze. Wie anderswo gesagt: Die Geschäftsordnung ist nicht das Geschäft, man kann das nicht einmal vergleichen. Gäbe es niemals einen ausgefüllten Bestellschein, dann wüßte man auch nicht, was ein unausgefüllter zu bedeuten hat. Wenn man nicht wissen kann, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, weiß man auch nicht, ob es überhaupt "irgendwie" ist, ob nun "für" die Fledermaus oder nicht – das fügt auch nichts mehr hinzu. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.09.2015 um 06.46 Uhr |
|
Ob die neuentdeckten Reste einer Frühmenschenart in Südafrika nun eine oder zwei Millionen Jahre alt sind – da sie Bestattungsbräuche, also Kultur hatten, müssen sie auch Sprache gehabt haben. Manche Forscher nehmen ja an, daß die Sprache vor 30.000 oder auch 100.000 Jahren entstand, wir also mit unserer Rekonstruktion doch immerhin ein Fünftel oder etwas weniger der Geschichte zurückgelangen; aber ich habe immer angenommen, daß wir uns eher im Promille-Bereich bewegen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.07.2015 um 11.18 Uhr |
|
Nehmen wir zwei beliebige Verben: schütteln und helfen. Man kann etwas auf unendlich viele Weisen schütteln, mit der rechten oder der linken Hand, dreimal oder siebenmal usw. Das Verb "abstrahiert" also in gewisser Weise, so wie man auch bei Kugel oder rauh abstrahiert oder in der Wahrnehmung durch Reizgeneralisierung. Anders bei helfen. Das kann darin bestehen, daß man jemanden füttert, ihm eine Zange reicht, ihm einen Geldbetrag überweist oder sein Testament ändert. Zwischen diesen und tausend anderen Verhaltensweisen gibt es keine Ähnlichkeit, keinen gemeinsamen Kern. Oder? In allen Fällen will ein anderer etwas, kann es aber allein nicht (oder nicht so gut) erreichen. So zeichnet sich das allgemeine Handlungsschema ab, wie unter "Intentionalität" erläutert. Das ist ein gesellschaftliches Konstrukt. Damit muß vertraut sein, wer das Verb helfen verwendet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.06.2015 um 07.22 Uhr |
|
Man spricht viel von Arbeitsteilung, aber kaum von etwas, was für uns Menschen doch auch charakteristisch ist: der Arbeitseinteilung, wie man es nennen könnte. Ich arbeite bis zum Abend, am nächsten Morgen mache ich genau an derselben Stelle weiter. Ich füge ein Lesezeichen ein usw. – gleichsam die Zukunft vorwegnehmend. Das Ganze auch sprachlich. Müßte mal durchdacht werden.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.05.2015 um 05.14 Uhr |
|
Ich nehme also mit Goethe an, daß die Äußerung einer Absicht nichts anderes ist als die Voraussage eigenen Verhaltens; das allerdings, eben durch die Ankündigung, dem Einspruch oder Zuspruch anderer offen ist und dadurch verändert werden kann. Woher weiß ich aber, was ich tun werde? Aus demselben Grund, wie ich das Verhalten anderer im voraus weiß. Unser Verhalten folgt Konventionen, die es stabilisieren und berechenbar machen. Die Ausführung im einzelnen wird dann durch die Natur der Dinge, vor allem aber durch das Außenskelett der zahllosen Artefakte bestimmt. Ich werde/will also beispielsweise nächsten Sonntag nach Nürnberg fahren. Die einzelnen Untertätigkeiten ergeben sich durch die Beschaffenheit des Fahrkartenautomaten usw. Weil das so ist, kann die Sprache sich auf Andeutungen beschränken. Das bemerken wir gar nicht; erst in sehr fremden Kulturen fällt es uns auf. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.05.2015 um 04.06 Uhr |
|
Im Haupteintrag habe ich Thomas Nagel erwähnt, im Anschluß daran die kanonischen Formeln der letzten Gewißheit, wie sie heute überall zu finden sind: "Es fühlt sich für mich irgendwie an/ist für mich irgendwie, ein Mensch (Th. Ickler) zu sein" usw. - Damit soll die Subjektivität oder das Bewußtsein ein für allemal gerettet werden. „But when it is logically impossible to doubt – when it makes no sense to doubt, then it equally makes no sense to be certain either.“ (Peter M. S. Hacker: "The Sad and Sorry History of Consciousness: being among other things a challenge to the “consciousness studies community”" (Royal Institute of Philosophy Supplement 70, 2012:149-168) Wenn es nicht sinnvoll ist zu sagen "Ich habe kein Bewußtsein", dann ist es auch nicht sinnvoll, geschweige denn eine unbezweifelbare Wahrheit, zu sagen: "Ich habe Bewußtsein". Genauer gesagt: Solche Sätze und Texte haben sehr wohl eine Funktion, aber eine andere, als die Philosophen meinen. Es sind gewissermaßen Blindtexte wie "Lorem ipsum": Formulare, die den eigentlichen Text vorbereiten. Man vergewissert sich, daß der Kanal frei ist, nämlich der Kanal der mentalistischen Redeweise insgesamt. Wer den Nagel-Satz akzeptiert, reiht sich ein in die mentalistische, folk-psychologische Verständigungstechnik. Es ist wie eine Mikrofonprobe. Anders gesagt: Man bestätigt die Geschäftsordnung der Sprache, indem man ihre inhaltliche leere Form unterschreibt. Aber die Geschäftsordnung ist nicht das Geschäft, nur Philosophen verwechseln das. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.05.2015 um 05.49 Uhr |
|
Ich habe eigentlich nicht von richtig und falsch reden wollen, sondern von der Beobachtung, daß wir erstens Teilnehmende an der Versammlung nicht ganz richtig finden – im Gegensatz zu Teilnahme an der Versammlung. Wie Sie mit Recht sagen, lieber Herr Riemer, ist Reise, Teilnahme einfach eine syntaktische Transposition und enthält als Verbalabstraktum nichts anderes als das Verb. Dagegen wird bei Teilnehmender, Teilnehmer, Reisender, Passagier etwas hinzugefügt, sozusagen eine neue Substanz, an der die verbal ausgedrückten Tätigkeiten nur wie Merkmale haften. Das zweite ist eher eine philosophische Deutung: Gegenstände als solche können keine Gerichtetheit haben. Das Flugzeug als Gerät ist nicht "nach Mallorca", dorthin geht vielmehr die Reise, für die das Gerät benutzt wird. Ich habe die geraffte Ausdrucksweise Flugzeug nach Mallorca nicht beanstanden, sondern erklären wollen, gegen die allgemeine Betrachtung, daß Gegenstände und daher auch Flugzeug zwar irgendwo, aber nicht irgendwohin sein können, "genau genommen" in dem angedeuteten Sinn. Ausgangspunkt ist der vermutete Konsens, daß Teilnehmender an der Veranstaltung nicht ganz richtig ist, daß es vielmehr, wenn schon, an der Veranstaltung Teilnehmender heißen müßte. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 01.05.2015 um 21.43 Uhr |
|
Wir hatten hier (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1278#17364) eine ähnliche Diskussion. Wenn Er ist nach Frankreich ein rundum korrekter Satz ist, dann kann man doch eigentlich genauso Dieser Gegenstand ist nach Frankfurt und Der Reisende ist nach Mallorca sagen, oder warum nicht? Ist Reisende nach Mallorca wirklich nur eine Abkürzung? Die Reise zu den Planetenräumen soll hingegen erlaubt sein. Inwiefern ist ein Reisender in diesem Zusammenhang etwas anderes als eine Reise? Beides sind Substantivierungen zu reisen. Daß wir Reise zu den Planetenräumen für gut befinden, liegt wohl auch nur daran, daß man zu den Planetenräumen reisen kann, was schließlich nur substantiviert wird. Jemand könnte also reisend zu den Planetenräumen sein. Wieso dann letzteres nicht einfach substantivieren? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.05.2015 um 18.13 Uhr |
|
Zur Valenz der Substantive: Wie gesagt, Gegenstände können nicht "gerichtet" sein, sondern sind einfach da. Allerdings können sie eine Geschichte haben. Wie in der Biologie nichts Sinn hat außer im Lichte der Evolution (Dobzhansky), so ist bei Artefakten die funktionale Betrachtung die einzig sinnvolle, d. h. die Einbeziehung des Herstellers und des Nutzers der Gegenstände. Deren Absicht ist in der gezeigten Weise naturalisierbar. Insofern kann man abkürzend dem Gegenstand eine Intentionalität zuschreiben, die gewissermaßen in ihn eingebaut ist. Mausefallen sind für Mäuse, zielen auf Mäuse. Aber das ist nur so dahingesprochen, nicht die ganze Wahrheit, die vielmehr in der Konditionierungsgeschichte steckt. Zug aus Frankfurt ist beschreibend: der Zug war vorher in Frankfurt, jetzt ist er hier. Zug nach Frankfurt ist intentional, geht normalerweise darüber hinaus, daß der Zug jetzt in Nürnberg ist und später in Frankfurt sein wird. Das kann nur mit der Vorgeschichte der Eisenbahnfahrt objektiviert werden. Man kann nicht sagen: dieser Gegenstand ist nach Frankfurt, folglich kann auch der Zug nicht als Gegenstand nach Frankfurt sein. Ein Mensch kann nicht nach Mallorca sein, folglich auch kein Passagier oder Reisender. Nur abkürzend sagt man Reisende nach Mallorce bitte zu Gate 12. Die Rakete zu den Planetenräumen. Auch bei genauester Betrachtung der Rakete wird man nicht feststellen, daß sie zu den Planetenräumen ist. Das ist keine intrinsische Eigenschaft, sondern man packt die in Aussicht genommene Reise zu den Planetenräumen verkürzend in den Gegenstand hinein. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.04.2015 um 06.08 Uhr |
|
Wie besonders Peter Hacker klargestellt hat, sind die Objekte "intentionaler" Verben oft keine wirklichen Gegenstände, sondern es handelt sich um verkappte Nominalisierungen von Objektsätzen. Deshalb ist mit ihrer Nennung auch keine Existenzpräsupposition verbunden. Also zum Beispiel "Ich glaube an die Klimaerwärmung/den Teufel" usw. = "Ich glaube, daß es die Klimaerwärmung/den Teufel gibt." Allerdings muß man gerade bei "glauben" hinzufügen, daß die Menschen über weite Strecken darunter nicht das Annehmen der Existenz verstanden haben, sondern ein Vertrauen zu etwas, dessen Existenz einfach vorausgesetzt wurde. An Gott glauben hieß: diesem Gott vertrauen, gehorchen usw. (und keinem anderen). Sprachverführt ist man auch, wenn man zwei Personen, die Verschiedenes glauben, einen gemeinsamen Zustand unterstellt, eben die gemeinsame "Einstellung", nur mit verschiedenem Inhalt. Wenn einer glaubt, daß die Erde sich erwärmt, und ein anderer, daß sein Kaffee kalt geworden ist, haben sie nichts gemein, befiinden sich nicht in gleichen Zuständen. Ein Haus, das einstürzen kann, und ein Kaffee, der kalt werden kann, haben keinen gemeinsamen Zustand des Könnens usw. (Kurz und gut: AN ORRERY OF INTENTIONALITY von Hacker, herunterladbar; bestes Heilmittel gegen Brentano usw.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.02.2015 um 06.32 Uhr |
|
Varoufakis strotzt vor Selbstbewusstsein (Welt 17.2.15) Ich hatte die Überschrift wieder mal mit leichtem Befremden gelesen, überzeugte mich dann aber aufs neue, daß strotzen heute fast ausschließlich mit der Präposition vor gebraucht wird. Laut Duden konkurriert sie mit von, und dies ist nach meinem Sprachgefühl die richtigere. Ich verstehe nämlich strotzen als relational, etwa wie "voll sein", wozu natürlich eine Ergänzung gehört. Die meisten Sprecher rechnen es aber anscheinend zu den selbständigen Verben, zu denen eine freie Kausalangabe paßt. Hier ist die Konkurrenz bekanntlich vor/aus, und zwar so, daß aus eine psychische Kausalität unter Beteiligung des Verstandes oder der Überlegung andeutet, also ein "Motiv": Aus Geldgier verriet er die Bonner Ostpolitik. (SZ 21.2.95) Aber: Er zittert vor Gier. (Tausende von Belegen) Man zittert auch vor Kälte, aber man tut etwas aus Berechnung. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.02.2015 um 08.54 Uhr |
|
Nach den berechtigten Korrekturen meiner Vorredner möchte ich die Tempusdiskussion dort fortsetzen, wo wir sie schon begonnen hatten: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1440 |
Kommentar von Horst Ludwig, verfaßt am 02.02.2015 um 08.43 Uhr |
|
Wir dürfen uns von den Bezeichnungen, die wir bestimmten sprachlichen Formen und Strukturen gegeben haben, nicht verführen lassen anzunehmen, daß damit aller Gebrauch festgelegt ist. Das gilt fürs "Präsens" hier genauso wie für "maskulin", "feminin", "aktiv und passiv" und was weiß ich. Wenn ich sage, "Ich arbeite im Büro", dann kann es sein, daß ich dabei im Büro sitze. Aber es kann auch sein, daß ich auf die Frage antworte, was ich am nächsten Tag mache, oder aber auch ohne Zeitadverbial vor dem Fernseher zu Hause verärgert auf eine telefonische Aufforderung reagiere, irgendein Problem zu lösen, das in meine Büroarbeit fällt, und daß ich damit also deutlich sage, daß ich in der Gegenwart gerade *nicht* arbeite.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 02.02.2015 um 00.31 Uhr |
|
Hier liegt m. E. ein Kategorienfehler vor. Präsens und Futur 1 sind verschiedene Zeitformen. Zu behaupten, die eine werde mit der anderen gebildet, ist ein innerer Widerspruch. Das gleiche gilt für Perfekt und Futur 2. Morgen gehe ich zur Arbeit ist formal Präsens, kein Futur 1. Bis zum Abend habe ich das geschafft ist formal Perfekt, kein Futur 2. Daß mitunter das Präsens benutzt wird, um sinngemäß das gleiche wie mit dem Futur 1 auszudrücken, oder daß entsprechend mit dem Perfekt das Futur 2 umschrieben werden kann, meist unter Zuhilfenahme geeigneter Adverbiale o. a., ist etwas ganz anderes. |
Kommentar von Klaus Achenbach, verfaßt am 01.02.2015 um 14.02 Uhr |
|
As soon as I've eaten (up), ... Demain, je vais au travail. Dès que j'ai complètement lu le livre, ... |
Kommentar von Horst Ludwig, verfaßt am 01.02.2015 um 13.17 Uhr |
|
Zu #27953 ("Das Deutsche ist die einzige mir bekannte indoeuropäische Sprache, in der das Futur 1 mit dem Präsens und einem Zeitadverb gebildet werden kann") wohl ganz natürlich: Tomorrow I can't come. Tomorrow I'm working.
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 01.02.2015 um 12.24 Uhr |
|
Das Deutsche ist die einzige mir bekannte indoeuropäische Sprache, in der das Futur 1 mit dem Präsens und einem Zeitadverb gebildet werden kann und das Futur 2 mit dem Perfekt und einem Adverb wie "fertig" u. ä. oder einem perfektiven Verb-Präfix. Beispiele: Morgen gehe ich zur Arbeit; Wenn ich fertig gegessen habe, ... Wenn ich aufgegessen habe, ... Bis zum Abend habe ich das geschafft. Aber: Ich werde das schaffen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.02.2015 um 07.11 Uhr |
|
Man spricht manchmal von entleerten Bräuchen u. ä., aber nie von geleerten Bräuchen. Sonst müßte ja jemand sie geleert haben, also absichtlich.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.02.2015 um 07.08 Uhr |
|
Mit den "ältesten noch lebenden indogermanischen Sprachen" können nur die vermutlich altertümlichsten gemeint sein; denn die idg. Sprachen sind ja alle gleich alt. Eine Kollegin von mir hat mal versucht, das deutsche werden-Futur aus tschechischem Sprachkontakt zu erklären, aber das scheint nicht mit der geographischen Verteilung vereinbar zu sein und ist auch gar nicht nötig. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 26.11.2014 um 13.03 Uhr |
|
Nach Nikolaos Trunte, Kirchenslavisch, nimmt die Umschreibung des Futurs mit dem Hilfsverb "wollen" ihren Anfang im Mittelgriechischen des 7. Jahrhunderts. Seit dem 10. Jahrhundert ist die Ersetzung des Infintivs durch einen Finalsatz auch bei der Futurperiphrase zu finden. Vom Mittelgriechischen breitete sich das wollen-Futur ins Altbulgarische (Altkirchenslavische), Serbische, Kroatische, Albanische und Rumänische aus ("Balkanismus"). Im Neugriechischen, Neubulgarischen, Mazedonischen, Albanischen und Rumänischen ist das Hilfsverb zu einer festen Partikel vor den Präsensformen erstarrt, nur im Serbischen und Kroatischen ist noch das volle wollen-Paradigma-Futur erhalten. Nach Trunte entstand das in den übrigen slavischen Sprachen übliche "werden-Futur" mit den perfektiven Präsensformen von "sein" erst später. (Das Präsens perfektiver Verben gilt als Futur.) (Interessant ist vielleicht, daß das altgriechische "s-Futur" noch im Litauischen und Lettischen als den ältesten lebenden indogermanischen Sprachen die Norm ist.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.10.2014 um 09.12 Uhr |
|
Indem die Vögel ein Nest bauen, „kündigen sie an“, daß sie dort brüten werden. Der Nestbau ist eine vorgeschaltete Phase des Brütens. Aber sie „wollen“ nicht brüten, denn es gibt keine Möglichkeit des Einspruches, der sie von ihrem „Vorhaben“ abbringen könnte. Darum ist das „Ankündigen“ in Wirklichkeit nicht kommunikativ. Das ist der allgemeine Handlungsrahmen, und wir nennen einen Willen „frei“, wenn er in diesen Rahmen paßt. (Die verschiedenen Zwänge, die mich sagen lassen: „Ich konnte mich nicht frei entscheiden“, sind philosophisch unproblematisch.) Daran kann keine Hirnforschung etwas ändern, weil die Freiheit des Willens keine Tatsachenfrage ist, sondern eine sprachliche Konvention. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.09.2014 um 09.02 Uhr |
|
The closest thing to a synonym for ‘intentionality’ is ‘aboutness’; something exhibits intentionality (to a first approximation) if and only if it is about something. The relevant sense of ‘about’ is best elucidated by example: the name ‘Saul Kripke’ is about Saul Kripke; my belief that the weather in South Bend is dreary is about the city of South Bend, Indiana; the black lines and curving blue stripe on the map in my hand are about the streets of South Bend and the St. Joseph River; the position of the needle gas gauge in my car is about the amount of gasoline in the tank of my car. (Speaks down. - http://www3.nd.edu/~jspeaks/papers/intentionality.pdf) Eine von unzähligen Stellen dieser Art. Bis auf eine Ausnahme werden Ausdrucksweisen vorgeführt, die es weder im Englischen noch im Deutschen gibt. Der Name Kripke ist nicht über Kripke und handelt auch nicht von ihm. Folglich ist diese Ausdrucksweise ohne Sinn, aber fast niemand bemerkt es, so sehr ist der phänomenologische Jargon eingebürgert. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.04.2014 um 11.52 Uhr |
|
Besonders die generativistischen Semantiker haben lange Zeit versucht, die Kausativität so aufzulösen: to kill = to cause to die. Das ist längst widerlegt, aber noch immer gibt es Versuche in dieser Richtung. "legen" bedeutet keineswegs "verursachen, daß etwas liegt". Denn wenn ich an ein Bücherregal stoße, so daß ein Buch herausfällt und dann auf dem Tisch liegt, kann man trotzdem nicht sagen, ich hätte es auf den Tisch gelegt. Wenn ich dagegen sage: "Paß mal auf, wie ich ein Buch auf den Tisch lege" - und dann mit genau derselben Bewegung ans Regal stoße, so daß das Buch herausfällt und dann auf dem Tisch liegt, dann habe ich es tatsächlich auf den Tisch gelegt. Zur Kausalität gehört also hier die Intentionalität, und die ist nur im Zusammenspiel mit wirklichen oder möglichen Ankündigungs-Sprechakten möglich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.11.2013 um 05.05 Uhr |
|
Das wäre sicher am einfachsten. Immerhin gilt die Absicht den erst in der Zukunft zu erwartenden Fällen, insofern finde ich das Futur auch angemessen.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.11.2013 um 00.21 Uhr |
|
Verkürzt lautet das Zitat: Die Bischofskonferenz hat beschlossen, auf die Ausübung verzichten zu wollen. Prof. Ickler: "Man kann eigentlich nicht beschließen, etwas tun zu wollen. Das Modalverb steht hier im Sinne von werden." Meiner Ansicht nach ist hier wollen genauso überflüssig wie werden. Wer verzichten will/wird, wer also ankündigt zu verzichten, der hat bereits verzichtet! Für mich läuft das unter unnötigem Gebrauch von Hilfs- und Modalverben, den ich im Diskussionsforum schon oft kritisiert habe. Ist der folgende Satz bei exakt gleicher Aussage nicht viel besser? Die Bischofskonferenz hat beschlossen, auf die Ausübung zu verzichten. |
