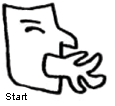


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
09.11.2009
Nature, Nurture und Skinner
Haltlose Behauptungen
Die Süddeutsche Zeitung bringt heute auf der ersten Seite folgenden Unsinn:
"Jeder Mensch könne ein erfolgreicher Musiker werden, behauptete der Psychologe Frederic Skinner vor 50 Jahren, man müsse nur früh genug ein intensives Training beginnen. Wie viele seiner Zeitgenossen glaubte Skinner fest an die Macht der Umwelt über die Entwicklung des Menschen."
Es ist ja spätestens seit Chomsky üblich, von Skinner zu behaupten, er habe den Einfluß der Vererbung (Phylogenese) geleugnet. Zuletzt hat der Pop-Linguist und Psychologe Pinker in seinem Buch "The Blank Slate", wie schon der Titel verrät, sich den Pappkameraden eines Leugners der Vererbung aufgebaut, um ihn mit großem Getöse umstoßen zu können. Darauf haben die Sachkundigen mit dem angebrachten Spott reagiert.
Die SZ-Autorin scheint ein berühmtes und berüchtigtes Zitat von Watson, dem Begründer des Behaviorismus, im Ohr gehabt zu haben, das aber kein anderer als Skinner an mehreren Stellen in den rechten Zusammenhang gerückt hat. Skinner hat das ihm Unterstellte nie behauptet, sondern tausendmal das Gegenteil gesagt. (Ich habe das andernorts ausführlich gezeigt.)
Der Artikel der SZ liest sich wie eine Rehabilitierung des Lamarckismus, aber bei genauerem Hin- und Nachsehen geht es bei den neuen Forschungen von Holsboer und anderen gar nicht um Veränderungen der Erbsubstanz in diesem Sinne, sondern ausdrücklich um "epigenetische" Veränderungen in der Aktivierung der Gene. Das verträgt sich selbstverständlich ohne weiteres mit dem operanten Konditionieren nach Skinner, denn Skinner sagt kein Sterbenswörtchen über die physiologische Grundlage des Lernens, das er untersucht hat. Aus diesem Grunde nennt er seine Richtung ja auch "radikalen Behaviorismus".
| Kommentare zu »Nature, Nurture und Skinner« |
| Kommentar schreiben | neueste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 10.11.2009 um 05.20 Uhr |
|
Aus den bisherigen Bemerkungen über Skinner in diesem Tagebuch komme ich zu dem Eindruck: "Skinner ist der deutschen Sprachwissenschaft kaum bekannt, er wird falsch verstanden, unterschätzt, verkannt, obwohl er einen genialen und stimmigen Zugang zum Verständnis der Sprache eröffnet hat, nämlich die Anwendung der Verhaltenswissenschaft auf die Sprache." Ich frage mich: Wenn das stimmt, daß Skinner verkannt wird, warum ist es so? Normalerweise setzen sich richtige Ansätze in der Wissenschaft doch schnell durch, und Geniales wird begeistert aufgegriffen. Aus der Sicht eines Laien, der sich zugegebenermaßen nicht viel länger als eine Stunde mit Skinner beschäftigt hat, möchte ich den ersten Erklärungsversuch beisteuern, der mir persönlich eingefallen ist. Sprachliches Verhalten (Verbal Behavior) wird wie alles Verhalten geformt: durch die Umwelt und die Interaktion mit der Umwelt, hier durch die Interaktion mit anderen Sprechern. Ich drücke mich unverständlich aus und erlebe den Mißerfolg meines sprachlichen Versuchs, also probiere ich es das nächste Mal (zum Beispiel sofort) mit anderen sprachlichen Mitteln. Dann klappt die Verständigung, ich bemerke es: Durch den Erfolg wird mein zweiter Versuch verstärkt. Auf diese Weise werden Wörter und Ausdrucksweisen gelernt und befestigt; so entsteht sprachliche Übereinstimmung und eine funktionierende Sprachgemeinschaft. Soweit Skinner in ein paar Sätzen. Es ist genial, wenn jemand als erster auf so eine Sichtweise kommt und die Sprachwissenschaft damit bereichert. Und nun mein Verdacht: Schon nach kurzer Zeit ist das doch selbstverständlich. Natürlich ist es so, wie sollte es anders sein? Könnte es sein, daß man sich nicht viel mit Skinner beschäftigt, weil es sich heutzutage um Selbstverständliches handelt? Also, woran liegt es, daß Skinner nicht angemessen gewürdigt worden ist, oder habe ich das falsch verstanden? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.11.2009 um 12.24 Uhr |
|
Der Grund ist, daß die naturalistische Sichtweise und Begrifflichkeit Skinners in unversöhnlichem Gegensatz zur mentalistischen steht, und letztere ist tief in der "folk psycholoy" der Alltagssprache verwurzelt. Skinner hat daher die "Wiederkehr des Geistes" (so Searles triumphalistischer Buchtitel) als "flight to laymanship" bezeichnet. Näheres dazu in meinem Aufsatz "Geborgter Reichtum – ehrliche Armut. Psychologische Sprache als semiotisches Problem zwischen Mentalismus und Behaviorismus" (Sprache & Kognition 13 (2), S. 103–112 [1994]). Die Sprachwissenschaft findet erst allmählich zum Naturalismus zurück, der Kognitivismus beherrscht noch weithin das Feld, weil er sich auf die scheinhafte Plausibilität der Alltagspsychologie stützen kann. Leider ist hier nicht der richtige Ort, das Thema weiter auszuarbeiten.
|
Kommentar von Jan-Martin Wagner, verfaßt am 10.11.2009 um 15.50 Uhr |
|
Th. Ickler: „(Ich habe das andernorts ausführlich gezeigt.)“ Meinten Sie mit diesem „andernorts“ den jetzt erwähnten Aufsatz oder noch einen anderen Text? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.11.2009 um 16.24 Uhr |
|
Entschuldigung! Ich meinte meinen Skinner-Aufsatz, der verschiedentlich im Internet herumspukt, z. B. hier: http://ltsc.ph-karlsruhe.de/Ickler.pdf |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.11.2009 um 16.29 Uhr |
|
Ich kann ja den fast gleichzeitig (also 1994) erschienenen anderen Aufsatz auch mal hier einrücken – er läßt sich ja jederzeit wieder löschen: Geborgter Reichtum – ehrliche Armut Psychologische Sprache als semiotisches Problem zwischen Mentalismus und Behaviorismus "Science has developed unevenly." (Skinner, 1953, 4) Zusammenfassung Der Mentalismus in der Psychologie rekonstruiert Verhalten in Handlungsbegriffen. Damit findet er Anschluß an die hohe Plausibilität einer nicht von ihm selbst, sondern von der jeweiligen Sprachgemeinschaft erarbeiteten kommunikativen Erschließung einer "Innenwelt". Aus der Sicht einer empirischen Verhaltenswissenschaft handelt es sich dabei um eine Erklärung nach dem Muster "ignotum per ignotius". Den tatsächlichen Fundierungsverhältnissen wird die umgekehrte Forschungsrichtung gerecht: Handlungen müssen als Verhalten erklärt werden. Der radikale Behaviorismus B. F. Skinners ist die konsequenteste Formulierung dieses Programms. 1. Psychologische Sprache als semiotisches Problem Die Psychologie ist mehr als andere Wissenschaften gehalten, sich immer wieder ihrer eigenen Fachsprache zu versichern. Der Gegenstand der Psychologie, also das wie auch immer konzipierte "Psychische", ist nämlich nicht nur jederzeit schon durch die Allgemeinsprache vorkategorisiert (das trifft auf die Gegenstände vieler anderer Wissenschaften ebenfalls zu), sondern es besteht der Verdacht, daß ohne diese Vorleistung der Allgemeinsprache überhaupt nicht von einem solchen Gegenstand gesprochen werden würde. Die Psychologie könnte sich dann grundsätzlich nicht von der Allgemeinsprache und den in ihr sedimentierten Vorannahmen (der sog. "folk psychology") emanzipieren, wie es alle anderen empirischen Wissenschaften mit Erfolg getan haben und weiterhin tun. Das Problem wird noch dadurch kompliziert, daß bereits die Allgemeinsprache einen doppelten Zugang zum Menschen eröffnet. Neben der im eigentlichen Sinne psychologischen Sprache, in der beispielsweise von Vorstellungen, Absichten und dergleichen, also gleichsam innerlich erlebbaren Phänomenen, die Rede ist, steht eine das Verhalten gleichsam von außen charakterisierende, "objektivistische" Redeweise. Die wissenschaftliche Psychologie neigt dazu, beide Redeweisen zu vermischen und zieht dadurch jenen Vorwurf auf sich, den Theo Herrmann in einem außerordentlich bedeutsamen Aufsatz (Herrmann, 1982) gegen gewisse Richtungen der neueren Kognitionspsychologie erhoben hat. Herrmann stellte der Kontamination von wesensmäßig inkompatiblen Akteurs- und Systemmodellen die Forderung einer "stilreinen" Begrifflichkeit entgegen. Der vorliegende Beitrag versteht sich als Fortführung und Verschärfung von Herrmanns kritischem - übrigens auch selbstkritischem - Vorstoß. (Ich muß aus Platzgründen davon absehen, die weitere, den Lesern dieser Zeitschrift bekannte Diskussion zu kommentieren; einige ergänzende Belege und Beobachtungen finden sich in Ickler, 1987.) Warum gibt es überhaupt die beiden Redeweisen, und woher stammen sie? Der Mensch setzt sich von Anfang an auf zweierlei Weisen mit seiner Umwelt auseinander: Einerseits manipuliert er sie "technisch", andererseits beeinflußt er sie durch zeichenhaftes Verhalten. Das letztere, also die Kommunikation, läßt sich zwar als Regelungs- oder Steuerungsvorgang begreifen und hat durchaus einen energetischen Aspekt, doch ist das Verhältnis von Ursache und Wirkung hier für den normalen Verstand so inkommensurabel, daß der Eindruck einer kategorial verschiedenen "Welt der Zeichen" wohl verständlich ist. Während in der Welt der technischen Kausalität ein Hammerschlag allenfalls einen Nagel verbiegt, kann in der Welt der Kommunikation, wie schon antike Sprachtheoretiker von Griechenland bis Indien bemerkten, ein leichter Flatus vocis Kriege entfesseln. Es ist plausibel anzunehmen, daß beide Weisen des Umgangs, der technische und der kommunikative, unablässig weiterentwickelt werden, ontogenetisch im Lernprozeß, kulturgeschichtlich als Wandel und Vervollkommnung von Technik und Zeichensystemen, schließlich auch in phylogenetischer Dimension. Man muß lernen, gegenüber welchen Gegenständen technische Manipulation und gegenüber welchen anderen kommunikative Beeinflussung, also "Ansprache" in irgendeiner Form, erfolgreich ist. Die Ansichten darüber wechseln bekanntlich, und unser Verhalten ist in dieser Hinsicht wenig konsistent. Einen Nagel versuchen wir nicht durch gutes Zureden in die Wand zu treiben; dagegen sind wir nicht abgeneigt, ihn zu verfluchen, wenn er sich wieder einmal krummgelegt hat. Weitere Beispiele für schwankende Abgrenzung zwischen physischen Objekten einerseits, "Personen" andererseits lassen sich leicht finden. Es bleibt noch zu erwähnen, daß der Mensch nicht nur auf Zeichen, sondern auch auf Schläge reagiert und folglich aus zwei "Phasen" zu bestehen scheint, einer personalen und einer physischen, - womit wir uns nicht nur das Leib-Seele-Problem einhandeln, sondern eben auch den einleitend erwähnten Grundlagenstreit der Psychologie. Anstelle von Kommunikation werde ich von jetzt an Sprache sagen, diesen Begriff in einem sehr weiten Sinn verstehen und alle anderen Kommunikationsweisen aus rein praktischen Gründen beiseitelassen. Die Sprache dient primär der Koordination des Verhaltens innerhalb einer Gemeinschaft. Ihre Entwicklung steht unter dem Kriterium, diese Verhaltenskoordination zu verfeinern, deren Vorteilhaftigkeit für die Gruppen-Fitneß auf der Hand liegt. Nun erschöpft sich die Sprache bekanntlich nicht im Austausch von Symptomen der inneren Befindlichkeit, sondern gerade auch der manipulative Umgang mit physischen Objekten wird durch Sprache koordiniert. Wir sprechen, indem wir über die Objekte sprechen, mit und zu anderen Personen. Selbst wenn wir uns aus theoretischen Erwägungen auf die physikalistische Seite schlagen wollen, also nur physische Objekte anerkennen, müssen wir praktisch anerkennen, daß wir auch diese Position im personalen Umgang mit anderen vertreten - oder verstummen müßten. Man kann dies als praktische Unaufhebbarkeit des Mentalismus deuten oder als Nichtreduzierbarkeit des Mentalen auf das Physische. Ein theoretisches Argument zugunsten des Mentalismus (vgl. v. Cranach et al., 1980, 22) folgt daraus jedoch m.E. nicht; denn Thesen widersprechen immer nur anderen Thesen, nicht aber einem sonstigen Verhalten. Ich habe bisher zu rekonstruieren versucht, wie es überhaupt zu dem unabweisbaren Eindruck kommen kann, daß die Welt in wenigstens zwei Bereiche zu zerfallen scheint, den physischen und den "mentalen". Als letzter Grund erwies sich die Sprachlichkeit des Menschen. Nun werden aber beide Bereiche (deren "Gegebensein" ich an dieser Stelle einfach hinnehme und erst später problematisieren will) auch zum Gegenstand des Sprechens. Die Sprache "handelt von" ihnen, "bezieht sich auf" sie - und wie die Redensarten sonst lauten mögen. Das ist an sich schon mysteriös. In der Welt der physischen Objekte gibt es kein "Sich-Beziehen-auf-Etwas", keine "Intentionalität" (im phänomenologischen Sinne, aber auch im gewöhnlichen), keine "Aboutness", keinen "arrow of reference" (Dennett, 1987, 240) - um nur einige geläufige Ausdrücke für die eigentümliche "Gerichtetheit" der Erlebnissphäre zu erwähnen. Folgerichtig hat der radikale Behaviorismus den Begriff der "Referenz" (und alle seine Quasi-Synonyme) ausgemerzt. Der Gegenstand, der in mentalistischer Diktion Referenzobjekt ist, wird behavioristisch umgedeutet zum Bestandteil der Umgebung, unter deren Kontrolle das Verhalten steht. Obwohl B. F. Skinner (1957; 1978 passim) diese Umdeutung als "Übersetzung" einer mentalistischen in eine objektivistische Redeweise aufgefaßt wissen will, stellt sie keine Explikation dessen dar, was ein mentalistisch argumentierender Sprecher "meint" (so daß er es als seine Meinung wiedererkennen müßte, wenn die Übersetzung korrekt ist), sondern einen Wechsel in eine völlig andere Begrifflichkeit. Während nun in der Rede über physische Objekte diese Objekte entweder (mentalistisch) als Referenzgegenstände oder (behavioristisch) als Teile der das Verhalten kontrollierenden Umgebung vorkommen, ist dies bei den inneren Zuständen der Person ein großes Problem. Daß die Mitteilung innerer Zustände für die Verhaltenskoordination sehr nützlich ist, steht außer Zweifel. Aber wie können sie zum "Gegenstand" einer Kommunikation gemacht werden? Sie sind ja nicht zeigbar und können folglich nicht ostensiv definiert werden. L. Wittgenstein hat daraus bekanntlich einigermaßen destruktive Konsequenzen gezogen, was die Ausdrückbarkeit "privater" Empfindungen betrifft. Wir sehen nun, daß zumindest in den modernen Kultursprachen immer schon eine ungemein differenzierte Erschließung des Inneren für die Mitteilung geleistet ist. Der erste Schritt besteht in der Benennung von Zuständen und Ereignissen "innerhalb der Haut". Selbst ein Radikalbehaviorist wie Skinner hält introspektive Daten wie Schmerz-, Hunger- und andere Empfindungen für unproblematisch. Zwar seien sie nicht zeigbar und ihre Benennungen folglich der Verstärkung durch die Sprachgemeinschaft nicht direkt zugänglich, doch gebe es eine Reihe von regelmäßigen Begleitumständen, die der Gemeinschaft die Identifikation der inneren Ereignisse, z.B. des Schmerzes, mit einiger Sicherheit ermögliche: Jemand wird geschlagen, hält sich die Backe usw. (Skinner, 1957, 130ff.). Metaphorische und metonymische Benennungen (stechender Schmerz) sind häufig und scheinen leicht erklärbar. Ein Kind, das sich bei einem Sturz das Knie aufschlägt, hat "Schmerzen"; wenn es lange nichts gegessen hat, empfindet es "Hunger"; wenn es gähnt und sich die Augen reibt, sagt man ihm, daß es "müde" sei: So interpretieren die Erwachsenen das Private anhand seiner öffentlich zugänglichen "Geschichte", und so lernt das Kind die Sprache des Ausdrucks der Empfindungen, wie jede Sprache, von anderen: "Strangely enough, it is the community which teaches the individual to 'know himself'." (Skinner, 1957, 134) Das gilt im Prinzip auch für Zustände oder Vorgänge, denen im Gegensatz zu Schmerz, Wärme oder Geschmack keine interozeptiven Nervensysteme zugeordnet werden können. Bei Ausdrücken wie Angst (eigentlich "Beengung") ist der metaphorische Prozeß noch deutlich rekonstruierbar, bei anderen ist er undurchschaubar geworden, doch hat man mit Recht gesagt, daß das gesamte Vokabular zur Bezeichnung des "Inneren" (wie auch diese "Innen"-Begrifflichkeit selbst) aus Bezeichnungen für Äußeres stammt. Man spricht von "Metaphern der Innenschau" (Holenstein, 1980). Da die Metapher auf einem Vergleich beruht (zur Verteidigung dieser herkömmlichen Auffassung vgl. Ickler, 1993), "Inneres" und "Äußeres" jedoch nicht in der Weise unabhängig von einander gegeben sind, daß man sie vergleichen könnte, wäre vielleicht dem Vorschlag H. Kronassers zuzustimmen, diesen einzigartigen "Sphärenwechsel" durch einen besonderen Begriff wie "Transgression" auszuzeichnen. Bisher haben wir uns den Ausdruck des Psychischen so vorgestellt, als entspreche den Wörtern jeweils ein definierbarer Innenzustand, wobei das "Innere" letztlich ganz unmetaphorisch der Raum "innerhalb der Haut" wäre. Ein naiver Physikalismus fordert bekanntlich, zu jedem so benannten psychischen Phänomen die physische, d.h. in der Regel neurophysiologische Entsprechung aufzusuchen. Das kann nicht gelingen. Ausdrücke wie Bewußtsein, Absicht, Einstellung, Glaube usw. beziehen sich nämlich gar nicht auf innere Zustände allein, sondern schließen funktionale Interpretationen ein. Das heißt: Diese Ausdrücke haben einen konventionellen Ort in sozialen Interaktionen, wo sie dazu beitragen, das Verhalten des Individuums für andere berechenbar zu machen. Wenn wir fragen, ob jemand eine bestimmte Handlung "bewußt", "mit Absicht" o.ä. vollzogen hat, meinen wir ungefähr folgendes: Hat er vor der Tat nachgedacht, sich die Sache überlegt, das Für und Wider abgewogen, die Folgen bedacht usw.? Wäre er in einem Beratungsdialog durch Einwände davon abzubringen gewesen? - Wir entwerfen also ein Handlungsschema, durch das jede Handlung grundsätzlich so dargestellt werden kann, als ginge ihr eine Deliberation voran. Man kann dasselbe auch vom anderen Ende her konstruieren. Dann fragt man sich, ob und wie ein Täter bereit wäre, sich für die vollbrachte Tat zu verantworten. In dieser sozusagen "forensischen" Situation würde er regelmäßig auf die deliberative Situation zurückverwiesen werden, die sich dadurch als der prototypische Fall der Verwendung mentalistischer Begriffe erweist. (Auf einer rationalen Rekonstruktion der Deliberations-Situation beruht auch die "naive Verhaltenstheorie", vgl. etwa v. Cranach et al., 1980, sowie, mit Abweichungen im Detail, Laucken, 1973. Kritisch dazu: Ickler, 1993a.) Für Philosophen wie J. Searle sind "Absichten" usw. "im Gehirn realisiert"; das ist nach der hier vorgestellten Auffassung unmöglich. Auch die von Searle und vielen anderen angenommenen "intentionalen Zustände" sind aus diesen und anderen Gründen ein Ding der Unmöglichkeit. Bei Begriffen wie Ekel, Scham oder Reue wird noch deutlicher, daß sich in die Klassifizierung körperlicher Zustände eine Berücksichtigung der "Geschichte" einmischt, innerhalb deren solche Zustände auftreten, sowie der Funktion, die sie in einer Gesellschaft haben. Dafür ein neurophysiologisches Korrelat aufsuchen zu wollen, wäre offenkundig verfehlt. Verschiedene menschliche Gemeinschaften sind durch verschiedene Handlungs- und Sprachspiele gekennzeichnet. Daraus ergeben sich ebenso verschiedene Typen von "Geschichten", in die das Verhalten des einzelnen eingebettet werden kann. Es dürfte daher bei genauerer Analyse schwer fallen, irgendeinen genuin psychologischen Begriff zu finden, der sich nicht als "Nationalbegriff" im Sinne der linguistischen Semantik erwiese. Verschiedene "folk psychologies" sind daher nicht direkt in einander übersetzbar. Die Ausdifferenzierung eines psychologischen Vokabulars muß man sich so vorstellen: Die Sprecher unternehmen intuitive Vorstöße zum Ausdruck einer zunächst diffus wahrgenommenen Befindlichkeit, wobei sie vorhandene Wörter in mehr oder weniger uneigentlicher, "transgressiver" Bedeutung verwenden. Das meiste verhallt folgenlos, doch einige Versuche finden Anklang in der Sprachgemeinschaft, wobei nicht nur das anthropologisch-konstante Fundament, sondern auch die historisch-gesellschaftlichen Verhältnisse den "Resonanzboden" bereitstellen. Man denke an besonders fruchtbare Epochen eines solchen Ausbaus der sprachlichen Möglichkeiten: Mystik, Pietismus, Romantik; auch neue gesellschaftliche Verhältnisse spielen nach Auskunft der Mentalitätengeschichte eine Rolle. Mir kommt es hier nicht auf die Einzelheiten an, sondern auf die grundsätzlich immer gleiche Weise, in der sich eine solche Erweiterung vollzieht: durch eine Art "Evolution", mit zahllosen "Mutationen" (jenen Vorstößen einzelner Sprecher) und selektiven Verstärkungen durch die "Kontingenzen des Überlebens" (hier: die Übernahme der Neuerung durch andere Angehörige der Sprachgemeinschaft). Unsere Ausgangsfrage war - um sie hier einmal mit den Worten eines Sprachphilosophen zu paraphrasieren: "Ist eine begrifflich kontinuierliche Fortsetzung der Alltagspsychologie mit wissenschaftlichen Mitteln möglich?" (Kemmerling, 1990, 154) Wenn meine bisherige Darstellung der Evolution psychologischer Kommunikation im großen und ganzen zutrifft, ist sie geeignet, das Vertrauen in die Wissenschaftsfähigkeit "alltagspsychologischer" Begriffsbildungen nachhaltig zu erschüttern. Diese Begriffsbildungen haben ihren Ort in der Konversation, wo sie der Verhaltensabstimmung dienen. Unter dieser Zielbestimmung können sie beliebig verfeinert werden; Kultivierung wäre eine passende Bezeichnung für diesen Vorgang, der wesentlich mit Appell und Rhetorik zusammenhängt. Wissenschaft hat einen anderen Ort und andere Funktionen; ihre Begriffe werden nicht durch Kultivierung ausgebaut, sondern durch Operationalisierung und Logik. Auch der Versuch, die wildwüchsige folk psychology rückwirkend wissenschaftlich zu nobilitieren, indem man sie "rational rekonstruiert", scheint mir so wenig glaubwürdig zu sein wie jede andere Art von rationaler Rekonstruktion des Historisch-Kontingenten. Ein zweiter Einwand gegen den Versuch, auf dem Boden der naiven Psychologie eine Wissenschaft aufzubauen, bezieht sich auf ihre logische Inkonsistenz. Eine Wissenschaft ist gezwungen, ihre Aussagen widerspruchsfrei zu halten und alle Einzelbegriffe dementsprechend zu definieren. Nun ist aber die Gesamtheit der in einer Sprachgemeinschaft üblichen psychologischen Redeweisen durchaus kein System. Vielmehr sind einzelne Domänen dieses Ausdrucksrepertoires zu verschiedenen Zeiten und zu verschiedenen Zwecken ausgebaut worden, und niemals ergibt sich von selbst eine Notwendigkeit, das Ganze unter das Gebot logischer Konsistenz zu zwingen. Eine wissenschaftliche Psychologie müßte derartige Inkonsistenzen bereinigen, würde sich damit aber grundsätzlich von den naiv-psychologischen Begriffen distanzieren müssen. Es gibt (entgegen W. Sellars, P. M. Churchland, P. S. Churchland, D. C. Dennett u.a.) keinen Grund anzunehmen, daß die volkspsychologischen Redeweisen sich bei genauerer Betrachtung zu einer "Theorie" zusammenfügen könnten. Folk psychology ist ein Teil des alltäglichen Verhaltens, nicht dessen Theorie. Mit dem zweiten Einwand hängt ein dritter zusammen: Die naiv-psychologischen Begriffe erfüllen ihren Zweck in einer Zone der Normalität, wie sie eben die alltäglichen Situationen ausmachen. Man darf sie jedoch nicht allzu scharf interpretieren wollen, etwa indem man extreme Situationen konstruiert und dann fragt, ob die naiven Begriffe hier noch zutreffen. Z.B. so: "Glaubt" jemand das, was er glaubt, auch dann, wenn er gerade schläft? "Kann" ein Mensch, der eine Aphasie erleidet, sein Sprachvermögen jedoch ohne Neulernen wiedererlangt, seine Sprache auch während des aphatischen Zustandes? Die Begriffe des "Glaubens", des "Könnens" usw. sind einfach nicht für solche Extremfälle ausgelegt, die Frage ihrer Anwendbarkeit darauf ist unentscheidbar. Die psychologischen Ausdrücke, die unmittelbar aus inneren Sinneswahrnehmungen stammen und diejenigen, die eher Projektionen von handlungsbegrifflichen Deutungen sind, haben etwas Gemeinsames. Sie werden vom einzelnen Sprachteilhaber als innere "Phänomene" erlebt und in einer Erlebnissprache berichtet. Daß ich Vorstellungen, Absichten usw. habe, kann ich nicht leugnen, aber nicht etwa deshalb, weil es die Vorstellungen, Absichten usw. wirklich gäbe und ich sie "hätte", sondern weil eine solche Ausdrucksweise ein nicht-aufgebbarer Bestandteil der deutschen Sprache ist und ich gegen diese meine Muttersprache verstoßen würde, wenn ich jene Begrifflichkeit nicht zu verstehen vorgäbe. Es ist paradox: Vorstellungen usw. gibt es nicht, aber die Rede von Vorstellungen ist durchaus sinnvoll. Aber dies gilt nur für jenes Verständigungs-Sprachspiel, das ich als "Konversation" bezeichnet habe, nicht für das Sprachspiel "Wissenschaft". Eine dritte Ebene psychologischer Begrifflichkeit ergibt sich aus Versuchen, das Innere mit Modellen aus der Technik zu füllen. Je nach deren Stand haben hydraulische, mechanische, elektrische oder elektronische, neuerdings besonders Computermodelle den Stoff solcher Konstrukte geliefert. Obwohl der neuere Mentalismus sich auch der "Computer-Metapher" bedient und die Gleichsetzung des "Geistes" mit der "Software" eines Rechners sogar zu einem Hauptpunkt ausgearbeitet hat, kann ich mich mit der Problematik dieser Modelle hier nicht näher beschäftigen. Stattdessen möchte ich an einigen Beispiele zeigen, wohin der Versuch führt, konversationelle psychologische Ausdrucksweisen in die wissenschaftliche Psychologie zu übernehmen, also die Verständigungstechnik zu einer Theorie umzudeuten. 2. Beispiele 2.1 "Kognitive Prozesse" Ein kognitiver Psychologe wie U. Neisser möchte sich etwa in gleicher Distanz zur behavioristischen Verhaltensanalyse wie zur Neurophysiologie halten. Er bestreitet beiden keineswegs ihre Berechtigung, glaubt aber nach der "Software-Analogie" einen Zwischenbereich bearbeiten zu können, der seiner Natur nach etwas ganz anderes sei. Zweifler werden so beschieden: "Der Hauptgrund, kognitive Prozesse zu studieren, hat sich als genauso klar herausgestellt wie der Grund für das Studium aller Dinge; weil es sie gibt. (...) Kognitive Prozesse existieren mit Sicherheit, und deswegen kann es kaum unwissenschaftlich sein, sie zu erforschen." (Neisser, 1974, 21) Was existiert, das ist einerseits das beobachtbare Verhalten eines Organismus - in Neissers Buch stets unter Laborbedingungen, zwar unter großzügigerer Berücksichtigung verbaler Reaktionen, grundsätzlich aber nicht anders als bei Skinner - , und das ist andererseits der physiologische Prozeß, der dem Verhalten zugrundeliegt. "Dazwischen" gibt es nichts. Man kann natürlich sowohl das Verhalten wie die physiologischen Abläufe in einer allgemeinen, abstrakten, logischen Weise analysieren, so wie man auch das Funktionieren eines Motors oder eines Radioapparates logisch analysieren und in Funktionsschaltbildern darstellen kann, wobei die Art der konkreten Realisierung keine Rolle mehr spielt (darauf beruht das Argument der "multiple instantiability"). Damit entdeckt man jedoch keinen neuen Gegenstand, sondern wählt eben lediglich ein bestimmtes Format der Darstellung. Wenn Neisser von einem "kognitiven Prozeß" spricht, so verwendet er das Wort Prozeß in einer äquivoken Weise, etwa so, wie man eine logische Ableitung oder die Operationen der Transformationsgrammatik als "Prozesse" bezeichnet. Logische "Schritte" sind ja keine wirklichen, in Echtzeit stattfindenden Teile eines Prozesses, sondern rein strukturelle Beziehungen, die lediglich infolge einer bestimmten Darstellungsweise als quasi prozeßhaft erscheinen. Was die Kognitive Psychologie wirklich analysiert und worauf sich auch die experimentell festgestellten zeitlichen Parameter (meist Reaktionszeiten) beziehen, das ist einfach das Verhalten des Organismus. Das gilt für alle Ansätze, die funktionale Verhaltensanalysen in die z. Zt. modische Diktion der Software-Analogie kleiden. Die undurchschaute Prozeß-Metaphorik ist offenbar noch etwas verschieden von jenen begrifflichen Schwierigkeiten, die Herrmann seinerzeit herausgearbeitet hat und für die sich auch bei Neisser Belege finden. Z.B. spricht dieser Autor von "aktiven", "produktiven" und "konstruktiven" Prozessen bei der Wahrnehmung, was nach Herrmann sinnlos ist, solange niemand sagen kann, was eigentlich einen "aktiven" Prozeß von einem nichtaktiven unterscheidet. Sieht man genauer hin, was wirklich geschieht, wenn z.B. die visuelle Wahrnehmung mehr hergibt, als die optische Abbildung eines Gegenstandes auf der Netzhaut erwarten läßt, so stoßen wir auf die relativ gründlich erforschten Vorgänge der lateralen Inhibition usw., die eine Kontrastverstärkung und dementsprechend eine Konturenverschärfung erzeugen. Kein Physiologe hat sich je veranlaßt gesehen, hier ebenso anspruchsvolle wie unklare Vokabeln wie aktiv, produktiv, konstruktiv oder gar kreativ zu verwenden. Die Nervenzellen funktionieren einfach so, wie es ihre Struktur erwarten läßt. Neissers Argument ist ein Beispiel für die von allen phänomenologisch orientierten Theoretikern geteilte Grundüberzeugung, daß mentale Phänomene schlechthin gegeben seien: "Introspection reveals a domain of thoughts, sensations, and emotions." (Churchland, 1988, 29) Diese Evidenzbehauptung bezieht jedoch ihre Überzeugungskraft nur aus der unüberbietbaren Vertrautheit der mentalistischen, pseudoreferentiellen Redeweise über jene vermeintlichen "Phänomene". 2.2 "Unbewußtes" Die Lehre von unbewußten seelischen Vorgängen hat die naive Bewußtseinspsychologie in den Bereich des Organischen hinein fortgesetzt. Entstanden ist eine ganze Mythologie und Dämonologie personalistisch aufgefaßter Instanzen. Was die hier besonders erfinderische Psychoanalyse betrifft, so haben zahlreiche Autoren (z. B. Eysenck, Grünbaum) die Fragwürdigkeit solcher Projektionen aufgedeckt. Aber auch in ganz anderen Bereichen der Psychologie setzt man unbekümmert "unbewußte" Verlängerungen des personalen Verhaltens an, z.B. wenn man mit dem "unbewußten" Befolgen von "Regeln" rechnet, Regeln, die nicht einmal in irgendeiner Sprache formuliert zu sein brauchen, "unbewußten Schlüssen" (modisch Inferenzen genannt) usw. Es handelt sich hier um ein "Pressen" alltagspsychologischer Begriffe über jede Vorstellbarkeit hinaus. Die Rede von unbewußten Motiven (als Sonderfall der Rekonstruktion von Gründen) ist eine Extrapolation der Begründung von Handlungen überhaupt in forensischen bzw. deliberativen Dialogen und aus demselben Grunde plausibel wie diese. Denn es ist immer dasselbe, unter den Kontingenzen von natürlicher und sozialer Umwelt geformte und berechenbar gewordene Verhalten, zu dessen Beschreibung, Voraussage und Kontrolle die mentalistische Diktion entwickelt worden ist. - Als Sprachwissenschaftler interessiert man sich natürlich besonders für die "Grammatik", die sich ein Kind angeblich "unbewußt aneignet" (oder gar schon angeborenermaßen besitzt). Aber die Grammatik besteht aus Sätzen, die, wie alle Sätze, Sprachverhalten sind und in diesem Falle ihren Ort in der dialogischen Rechtfertigung, Beurteilung und Simulation von anderem sprachlichen Verhalten haben. Grammatik ist also etwas Interaktionales, und ihre Projektion in den kognitiven Apparat hinein ist nichts anderes als ein "soziomorpher" Mythos. 2.3 "Repräsentation" "Repräsentation" ist wohl der zentrale Begriff der kognitivistischen Psychologie und zugleich der mentalistischen Philosophie des "Geistes". Der naive phänomenologische Ansatz verbindet sich hier mit der ebenso naiven Abbildtheorie der Sprache. Autoren, die sich ein wenig vom naiven Realismus absetzen möchten, legen sich innerhalb dieses Modells auch den oben bereits kritisch besprochenen Begriff der "Referenz" zurecht: "Referenten sind nicht die Objekte in der Welt selbst, sondern die Vorstellungen von solchen Entitäten, die bei der Produktion bzw. Rezeption der Äußerung bei Sprecher und Hörer bestehen". (Dietrich, 1992, 18) "Das, worüber wir sprechen, ist das interne Modell." (Bierwisch, 1983, 51) Vielleicht spielt ein internes Modell beim Sprechen über die Dinge eine Rolle, es ist aber keinesfalls dasjenige, "worüber" man spricht. Ausdrücke wie über etwas sprechen haben schließlich eine bestimmte Verwendung in der Sprache, eine "Grammatik" im Wittgensteinschen Sinne, über die man sich nicht ungestraft hinwegsetzt. Z.B. führt die zitierte "Korrektur" der naiven Redeweise augenblicklich in einen unendlichen Regreß; denn um "über" das interne Modell zu sprechen, braucht man ja ein weiteres internes Modell dieses Modells, eine Vorstellung der Vorstellung usw. - Derselbe Einwand trifft auch jene Autoren, die "Begriffe" als vermeintliche Referenzobjekte ansetzen, vgl. z.B.: "Ein zentraler Punkt in der Kommunikation besteht darin, sicherzustellen, daß jeder Teilnehmer über dieselben Begriffe spricht." (Norman & Rumelhart, 1978, 78) "Repräsentation" geht auf den traditionellen und populären Begriff der "Vorstellung" zurück, und an den Repräsentationstheorien läßt sich auch die Nähe der mentalistischen Psychologie zur folk psychology besonders klar erkennen. Wenn man im Alltag sagt, man könne sich etwas genau vorstellen, man sehe es geradezu vor sich, man habe es wie eine Landkarte vor dem inneren Auge usw., so bestätigt die Kognitionspsychologie dem common sense bereitwilligst diesen Eindruck, indem sie innere Bilder, Karten usw. als wissenschaftliche Konstrukte ernst nimmt. Manchmal wird das Unzulässige solcher Begriffsverpflanzung dadurch dissimuliert, daß man die äquivok gebrauchten Ausdrücke in Großbuchstaben schreibt (so IMAGE und PLAN bei Miller, Galanter & Pribram 1960). Die so gekennzeichneten Begriffe sollen zwar etwas anderes als ihre Dubletten in der Alltagssprache bezeichnen, doch wird unterderhand die Vertrautheit und das bewährte Funktionieren der alltagssprachlichen Begriffe auch für die angeblich neuen Begriffe in Anspruch genommen. Dazu nur ein beliebig herausgegriffenes Beispiel: "Der Unterschied zwischen dem Tier und dem Menschen hat natürlich darin ein zentrales Merkmal, daß die Menschen die Sprache haben, womit sie ihre Pläne vom Könner zum Neuling und von einer Generation auf die andere übertragen können." - "Die noch in Worten gefaßte Strategie des Anfängers kann zum gleichen Resultat führen wie die unwillkürliche, gewohnheitsmäßige Strategie des Geübten. Daran kann man erkennen, daß die beiden Strategien der 'gleiche' Plan sind." (Miller, Galanter & Pribram, 1973, 87f.) Pläne und Strategien von Personen werden hier ohne weiteres mit den gleichbenannten Konstrukten identifiziert, die innerhalb des Organismus angenommen werden. Der Mentalismus erfindet zur Erklärung des Verhaltens ein "Wissen", das ihm angeblich zugrunde liegt. Daraus ergibt sich das künstliche Problem, wie der Organismus vom Wissen zum Handeln kommt. Miller, Galanter und Pribram finden nichts dabei zu behaupten: "Sprachliche Pläne (...) gehen in die Muskeln über (...)" (Miller et al., 1973, 88) Die spekulative Kybernetik des menschlichen Verhaltens, die bei den drei Autoren ganz wesentlich auf Begriffskontaminationen der von Herrmann beanstandeten Art beruht, grenzt hier an unfreiwillige Selbstparodie. H. Hörmann gesteht wenigstens offen ein, es sei "weitgehend unbekannt", wie das dem Verhalten angeblich zugrundeliegende Wissen "aktiviert" werde (Hörmann, 1981, 63). Wie man von den Konstrukten wieder zu dem Verhalten gelangt, zu dessen Erklärung sie doch eigens erfunden wurden, erscheint als großes Problem. Diese Ratlosigkeit als Quintessenz jahrzehntelanger Forschung sollte den Gedanken nahelegen, daß bereits mit dem mentalistischen Grundansatz etwas nicht stimmt. Besondere Erwähnung verdienen noch die "Propositionen" als eines der Formate, die man für mentale Repräsentation angenommen hat. Ich habe schon angedeutet, daß Propositionen m. E. nichts anderes sind als Sätze und damit etwas Interaktionales. An dieser Stelle weiche ich auch von Th. Herrmann ab, der "propositionale Speicherung" für einen legitimen Bestandteil "systembezogener" Modellbildung hält (Herrmann, 1982, 11), während sie für mich eindeutig zur "akteursbezogenen" Begrifflichkeit gehört. In der physischen Wirklichkeit gibt es keine Entsprechung zum Begriff der "Proposition". Es ist sinnlos, von "motorischen Propositionen" zu sprechen (Birbaumer & Schmidt, 1991, 622). N. Birbaumer und R. F. Schmidt folgen in ihrem Buch sehr konsequent dem Grundsatz: "Eine Biologische Psychologie des Lernens sollte alle aus der Lern- und Gedächtnispsychologie bekannten Phänomene in physiologische Prozesse übersetzen können." (Birbaumer & Schmidt 1991, 533) Nur in dem Kapitel "Denkprozesse, Sprache und Vorstellung" werden sie ihrem Programm untreu, vielleicht weil sie unter die zu berücksichtigenden "Phänomene" auch die mentalistischen Phantome subsumieren. Das genannte Kapitel empfindet man daher als schockierende Entgleisung, gerade so, als sei in ein modernes Zoologiebuch ein Abschnitt aus dem mittelalterlichen "Physiologus" hineingeraten. 3. Einige Folgerungen Der Grundfehler des Mentalismus besteht darin, das "Innere", verstanden als eine Kluft zwischen Physiologie und Verhalten, mit hypothetischen Konstrukten zu füllen, die aus der Begrifflichkeit interpersonaler Verständigung stammen, kurz: aus der Handlungssprache. Dort haben sie ihren guten Sinn, denn die Koordination von Handlungen ist der Zweck, zu dem sich diese Redeweise herausgebildet hat. Welchen Sinn solche Begriffe, die ihrer gemeinschaftsbezogenen Funktion wegen "soziale" Begriffe genannt werden dürfen, jedoch haben - und ob sie überhaupt noch einen haben -, wenn man sie benutzt, um hypothetische "kognitive Prozesse" zu modellieren, das ist mehr als fraglich. Die Übertragung beruht allerdings auch nicht auf einer wohlüberlegten wissenschaftlichen Konzeption, sondern geschieht naiv. Man versäumt es schlicht, sich Rechenschaft davon zu geben, was Regel, Absicht, Ziel, Proposition, Hypothese usw. überhaupt heißen könnten, wenn damit bewußtseinsfremde innere Entitäten oder Prozesse gemeint sein sollen. Man scheint zu denken: Wenn jemand - als Person - einer Regel folgt, Schlüsse zieht und Absichten hat, dann liegt das daran, daß der kognitive Apparat in ihm einer Regel folgt, Schlüsse zieht und Absichten hat. Daß die Erklärung des Verhaltens ganz andere Wege gehen und sich von derart soziomorphen Begriffen völlig emanzipieren muß, ist die Überzeugung des Behaviorismus. Er weigert sich, die handlungstheoretische Simulation des Verhaltens mit dem Simulierten, die Form der Darstellung mit der Form des Dargestellten gleichzusetzen. Ein Biologe war es, der einmal festhielt: "Nicht alles, was gemessen und berechnet werden kann, beruht auf Messung und Berechnung. Wenn ein Lichtstrahl von einer Wasseroberfläche gebrochen wird, nehmen wir ja auch nicht an, daß das Wasser den Brechungswinkel vorher berechnet hat." (Gradmann, 1971, 917) Dieser Fehlschluß tritt in ungezählten Varianten auf. Verhalten läßt sich natürlich immer als Handlung darstellen, d.h. in einer Normalform, die mit der forensischen Fiktion von Zielsetzung, Deliberation (Bedenken der Folgen, Wahl der Mittel) und Durchführung arbeitet. Sprachverhalten läßt sich immer so darstellen, als ob es im Befolgen grammatischer Regeln bestehe usw. (vgl. Skinner 1969, bes. 166-171 und Segal, 1975). Hier eines von zahllosen Beispielen: "LINDE und LABOV haben uns die regelhafe Strukturiertheit von Wohnungsbeschreibungen gezeigt: die hier wirksamen Gesetzmäßigkeiten lassen sich durch etwa 20 Regeln beschreiben. Etwa 20 Regeln muß der kompetente Sprecher des amerikanischen Englisch also beherrschen und befolgen, um eine übliche Wohnungsbeschreibung zuliefern." (Hörmann, 1981, 88) Die linguistische Simulation wird ganz offen in den Gegenstand selbst projiziert. Die handlungsbegriffliche Normalform hat etwas ungemein Suggestives, da sie das Vertrauteste schlechthin ist. Wir lesen z.B.: "Wenn jemand spricht, dann beabsichtigt er, den Partner darüber zu informieren, was er meint." (Herrmann, 1982a, 22) und denken: 'So muß es wohl sein.' Zwar hatten wir beim Sprechen nicht ausdrücklich an dergleichen gedacht, aber die Rekonstruktion nach dem Muster eines "pragmatischen Kalküls" ("Grice-Kalküls") scheint in jedem Fall überzeugend. Wir sind einfach sehr daran gewöhnt, unser Tun jederzeit in diejenigen Komponenten zu zerlegen, die es sozusagen justiziabel machen. Eine modische Variante dieses Verfahrens ist die "Skript"-Theorie: Verhalten wird so dargestellt, als ob es einem Drehbuch folge. - Miller et al. haben die handlungstheoretische Normalform in Gestalt der TOTE-Einheit psychologisch und scheinbar auch physiologisch diskussionsfähig gemacht. Das Handlungsformat, auf das wir das Verhalten gebracht haben, projizieren wir dann in das "Innere". Wer etwas lernt, dessen Nervensystem verändert sich selbstverständlich; aber welchen Sinn soll es haben, diese Veränderung als "neuronale Hypothese" zu bezeichnen? Hypothesen werden von Menschen gebildet, nicht von Gehirnen oder Nerven (vgl. Skinner 1978, 91). Außerdem wird auch die genaueste physiologische Untersuchung nichts entdecken, was einer "Hypothese" entspricht, denn die Charakterisierung eines Verhaltens als "Hypothese" umfaßt die Funktion dieses Verhaltens in gesellschaftlich normierten Dialogspielen, und dafür gibt es kein physiologisches Substrat. Im Rahmen des pragmatischen Kalküls, also in Handlungsdiktion, haben auch Begriffe wie "Motivation" einen Sinn. Für die objektive Analyse des Verhaltens sind sie überflüssig. Aber auch die Physiologie kann damit nichts anfangen: "Je besser (die) organismusinternen Zustände quantifizierbar sind, umso überflüssiger wird die Annahme einer intervenierenden Variablen 'Motivation' oder 'Emotion'." (Birbaumer & Schmidt 1991, 563) Es ist auch nicht so, daß die Physiologie das organische Substrat der Motivation aufdeckte, sondern das Konstrukt "Motivation" verschwindet einfach; es wird als - wissenschaftlich gesehen - obsolete Redeweise durchschaut. Gleiches läßt sich von der gesamten mentalistischen Begrifflichkeit erwarten. Als Verständigungstechnik miteinander handelnder Personen bleibt sie natürlich nützlich, ja unentbehrlich. Die traditionelle Psychologie glaubte sich mit jener einzigartigen Welt beschäftigen zu müssen, die man metaphorisch eine "innere Welt" nannte: die Welt des "Bewußtseins", des "Erlebens". Sie scheint unvergleichlich reicher und subtiler zu sein als das beobachtbare Verhalten, das wir mit den Tieren gemein haben. Noch in seinem Buch "Sprechen und Situation" (1982a, 2f.) bestimmt Th. Herrmann den Gegenstand der "(Human-)Psychologie" als "das Verhalten und das daraus erschließbare Erleben". Aus empiristischer Sicht ist damit schon alles verdorben. Das "Erleben" sollte als eine Fiktion angesehen werden, die aus der "Erlebnissprache" herausgesponnen ist; diese selbst aber ist ein Verhalten wie jedes andere. Die - für den Mentalismus ungemein charakteristische und wissenschaftsgeschichtlich erstaunliche - Abkoppelung der Humanpsychologie von der Tierpsychologie ist unnötig und schädlich. Übrigens müßte auch die Logik, nach der aus dem Verhalten ein Erleben "erschlossen" wird, wohl erst noch geschrieben werden. (Später ersetzt Herrmann das "Erleben" stillschweigend durch "kognitive Prozesse". Diese "Prozesse" sind transphänomenale Konstrukte, sie werden jedoch in Begriffen einer Handlungs- und Erlebnissprache expliziert: Der Sprecher "selektiert semantischen Input", hat "Absichten", "Ziele", "meint" etwas usw. - All dies ist im Sinne von Herrmanns eingangs angeführtem Aufsatz aus dem gleichen Jahr sicherlich verfehlt.) Die Herausbildung einer intuitiv-psychologischen Sprache war ein großer Erfolg für die Kommunikation, unter dem Gesichtspunkt einer wissenschaftlichen Erforschung des Verhaltens jedoch, mit Skinners drastischem Wort, ein "Desaster" (1978, 188). Sie funktioniert vorzüglich - in ihrem angestammten Bereich. Das ist kein Wunder, denn dafür hat sie sich ja entwickelt. Könnten wir uns nicht mithilfe unserer psychologischen Sprache effizient über unsere Befindlichkeit verständigen und unser Verhalten wechselseitig abstimmen, so gäbe es sie gar nicht. Die wissenschaftliche Psychologie kann diese vorgegebene intuitiv-psychologische Sprache jedoch weder durch rationale Rekonstruktion einholen noch produktiv ausbauen. Denn die Begriffe der intuitiven Psychologie müssen jeweils der "Ratifizierung" durch die Kommunikationsgemeinschaft ausgesetzt werden. Der Ausgang dieser Prozedur ist in jedem einzelnen Fall so ungewiß wie das historische Geschehen überhaupt, von dem sie ein Teil sind. Der Reichtum und die Plausibilität der mentalistischen Psychologie beruhen nicht auf eigener theoretischer Leistung, sondern sind aus den Vorgaben einer bereits funktionierenden, in geschichtlicher Evolution gewachsenen Verständigungstechnik hergeleitet, ja erschlichen. (Vgl. die ähnlich gerichtete Bemerkung von Herrmann, 1988, 168, sowie Skinner, 1957, 44f.) Modelliert man das Verhalten so, als benutze es "Skripts", "Pläne", "Bilder", "Vorstellungen", "Repräsentationen", "Frames", "Konzepte", "Merkmalslisten", "kognitive Karten", "Propositionen" usw., so wird man dafür stets eine gewisse empirische, auch experimentelle Bestätigung erhalten, denn alle diese Begriffe (bzw. ihre Vorläufer) sind bereits in der Alltagspsychologie entwickelt, um das Verhalten zu "erklären", d.h. zu koordinieren und berechenbar zu machen, und haben sich dort bewährt. Man leiht mit den Metaphern auch deren Effizienz und Plausibilität aus. Wenn Paul Churchland (1988, 57) meint: "(Folk psychology) embodies the wisdom of thousands of generations' attempts to understand how we humans work." - so gilt das nur in dem Sinne, in dem die Kunst des Radfahrens ein "Wissen" über ein beträchtliches Stück der Physik manifestiert, nämlich in einer für die Wissenschaft völlig nutzlosen Weise. Folk psychology ist keine Theorie, sondern eine Praxis, und mentalistische Psychologie ist eine Verlängerung dieser Praxis: Konversation, nicht Wissenschaft. Die Psychologie als Wissenschaft muß sich daher auf einen vollkommen anderen Standpunkt begeben, um das menschliche Verhalten zu analysieren. Dabei nimmt sie zunächst eine einschneidende Verarmung ihres Gegenstandsbereichs und ihrer Erklärungsmöglichkeiten in Kauf. Es ist die Grundüberzeugung des Behaviorimus, daß eine solche ehrliche Armut dem geborgten Reichtum des Mentalismus vorzuziehen sei. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.11.2009 um 16.37 Uhr |
|
Zu meiner Unterstützung möchte ich noch auf die guten Arbeiten von Christoph Bördlein hinweisen (vieles davon im Internet), auch der Wiki-Artikel "Verbal Behavior" ist im wesentlichen von ihm. In Deutschland gibt es nicht viel Vergleichbares, aber Bördlein verweist (wie auch ich) auf ausländische Literatur, die man mit Gewinn lesen kann.
|
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 13.11.2009 um 04.17 Uhr |
|
Vielen Dank für diesen hochinteressanten Aufsatz!
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.12.2009 um 18.01 Uhr |
|
Auf einer Internetseite der Universität Köln finde ich die folgende verfasserlose Übersicht: "Behaviorismus • Führt alle Leistungen auf Lernvorgänge zurück • Nichts ist ererbt außer einem universalen Lernmechanismus • Sprache lernen Kinder, weil sie die Sprache der Erwachsenen imitieren • Richtige Imitationen werden (direkt oder indirekt, z.B. durch Erfolg) belohnt und dadurch verstärkt." Also vier Merksätze, alle kraß falsch oder sinnlos, und das ist durchaus verbreiteter Lernstoff, vor allem in der Sprachwissenschaft. Durch die Vereinheitlichung aller Studien im Zeichen von "Bologna" wird der Unsinn flächendeckend verbindlich. (Hier wäre auch das Zeichenmodell der Linguisten nach Saussure zu erwähnen.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.07.2011 um 08.43 Uhr |
|
Aus einer sprachwissenschaftlichen Seminararbeit: "Vgl. dazu den sog. Nürnberger Trichter, mit dem ein Lehrer Wissen in seinen Schüler unvermittelt einspielen konnte. Dieses Modell entspricht in etwa dem Blackbox-Modell des Behaviorismus, wie es u.a. von John B. Watson Anfang des 20. Jahrhunderts begründet und in den 1950er Jahren von Burrhus Frederic Skinner weiterentwickelt wurde. Weiterführende Literatur: Wissenschaft und menschliches Verhalten. Science and Human Behavior, Skinner, Burrhus Frederic, München: Kindler, 1973." Der Nürnberger Trichter hat nichts mit dem Blackbox-Modell zu tun und beide nichts mit Skinner. Das angeführte Buch kann auch nicht gelesen worden sein, die (formal sonderbare, offenbar irgendwo rauskopierte) Literaturangabe ist bloßer Schein. Aber solche hochstaplerischen Texte werden offenbar als Leistung anerkannt und sogar ins Netz gestellt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.02.2012 um 18.08 Uhr |
|
I need hardly point out that Pinker doesn’t really believe anything of what he writes. Hübsch gesagt, und der ganze Aufsatz von Theodore Dalrymple (= Anthony Daniels) ist lesenswert: www.city-journal.org/html/16_4_urbanities-language.html |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.02.2012 um 10.45 Uhr |
|
D. E. Zimmer: Auszug aus dem Kapitel: "Die Sprache, die den Kindern zuwächst" »Bei der Erklärung des kindlichen Spracherwerbs konkurrieren also heute, grob sortiert, vier Denkrichtungen miteinander. I. Der Behaviorismus. Lange Zeit beherrschte er die Psychologie und auch die Spracherwerbsforschung. Alle Leistungen führt er auf Lernvorgänge zurück. Nichts ist ererbt außer einem universalen Lernmechanismus, alles wird durch Lernen erworben. Eine Sprache lernen Kinder, weil sie die Sprache der Erwachsenen imitieren. Richtige Imitationen werden belohnt und damit verstärkt, oder sie belohnen und verstärken sich selber durch den größeren Erfolg, den sie bescheren. Die extremste behavioristische Position behauptet, daß das Kind irgendwie registriert, wie häufig in der Erwachsenensprache, die es zu hören bekommt, einzelne Wörter neben anderen einzelnen Wörtern erscheinen. So erwerbe es ein Sprachmodell, das alles über die relativen Häufigkeiten der einzelnen Wörter weiß. Bringt das Kind selber Sprache hervor, verknüpfe es die Wörter nach diesen ihren relativen Häufigkeiten zu Ketten, und das seien dann seine Sätze. Dem behavioristischen Ansatz war kein Erfolg beschieden. Das Kind imitiert die Erwachsenensprache in keinem nennenswerten Maß. Es lernt augenscheinlich überhaupt nicht Einzelfälle von Sprachanwendung. Es entnimmt der Tiefe der Sprache Regeln (oder kennt diese schon vor jeder Bekanntschaft mit einer bestimmten Sprache), die es anwendet, um neue, nie dagewesene Sätze zu bilden. Ob es irgendein Wort oder irgendeine grammatische Form lernt, hängt nicht oder jedenfalls nicht hauptsächlich von der Häufigkeit ab, mit der einzelne Wörter oder Satzmuster in der ihm zu Ohren gekommenen Erwachsenensprache aufgetaucht sind. Manchmal lernt es das häufig Gehörte viel schwerer und später als etwas selten Gehörtes. Der Behaviorismus wird also vor allem einem Faktum in keiner Weise gerecht: der Offenheit und Kreativität der Sprache. Wer ihn ganz ernst nehmen wollte, müßte der Meinung sein, daß niemand jemals etwas wirklich Neues sagen könne. Daß Kinder auf sprachliche Belehrungen nicht oder sogar negativ, durch Nichtlernen reagieren, spricht auch nicht gerade für den behavioristischen Ansatz. Schließlich behauptet er, der Lernmechanismus selber sei bei allen höheren Tieren der gleiche; dann aber müßten alle Tiere, nur in verschiedenem Umfang, auch das gleiche lernen können: die Menschen, über weite Entfernungen sicher nach Hause zu finden wie die Tauben, die Tauben, zumindest ein wenig Sprache zu erwerben wie die Menschen. Nichts dergleichen kommt vor. Den Beitrag des Behaviorismus zur Sprachforschung hat Noam Chomsky in seiner Besprechung von B. F. Skinners "Sprachverhalten" 1959 so demoliert daß er sich nie wieder erholt hat als: "eine unnütze Tendenz in der modernen Spekulation über Sprache und Geist".« (Dieter E. Zimmer: So kommt der Mensch zur Sprache, Heyne Bücher 310, Sachbuch, Best.-Nr. 19/310, Auszug aus dem Kapitel: "Die Sprache, die den Kindern zuwächst" (S. 63–71) — Dazu ist zu sagen: – Skinner nimmt nicht an, daß nichts ererbt sei außer einem allgemeinen Lernmechanismus. Vielmehr nimmt er ein phylogenetisch erworbenes artspezifisches Verhalten an, das dann durch Lernen verändert wird; außerdem gibt es selbstverständlich artspezifische Verstärkungsmöglichkeiten, so daß z. B. ein Löwe nicht durch Salatblätter belohnt werden kann, ein Kaninchen nicht durch Fleischbrocken. – Bei Skinner spielt Nachahmung (vor allem als Echoverhalten) eine sehr geringe Rolle. Heute wird gerade die Nachahmung wieder sehr intensiv erforscht. – Es werden keine identischen „Lernmechanismen“ angenommen, sondern man hat festgestellt, daß verschiedene Tiere (einschl. Menschen) auf bestimmte Verstärkungspläne bemerkenswert ähnlich reagieren (übereinstimmende Lernkurven). – Aus ähnlichen „Lernmechanismen“ würde keineswegs folgen, daß alle Tiere dasselbe lernen können müßten. – Daß ein Kind sich die Häufigkeit der Sprachelemente in der Erwachsenenrede merke und demgemäß zu Ketten verknüpfe, ist jedenfalls nicht die Ansicht Skinners. Ich weiß auch nicht, wer sie sonst vertreten haben könnte. – Skinner widmet einen großen Teil seines Buches der Frage, wie neue Sprachäußerungen entstehen. – Schließlich spekuliert Skinner naturgemäß nicht über „Sprache und Geist“, sondern befaßt sich mit dem Sprachverhalten, und immer mehr Sprachforscher sind der Ansicht, daß Chomskys Rezension weitgehend verfehlt war. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.03.2012 um 09.44 Uhr |
|
Die Entwicklungspsychologin Barbara H. Boucher schreibt: Strict behaviorist B.F. Skinner is probably rolling in his grave while I write about the influence of genetics on child development. I read about his death in the newspaper in 1990. He went to his grave believing in ‘tabula rasa’ or the blank slate. He believed that every child was born a ‘blank slate’, and that through conditioning alone, the child could be raised to be anything. You want your baby to be a violinist or a gymnast? Dr. Skinner would have said it is possible. Dr. Skinner was wrong. Some babies are born with the potential to become a violinist, some are not. (www.therextras.com) Also wieder genau das Gegenteil dessen, was Skinner selbst geschrieben hat. Frau Boucher hat offenbar keine Zeile von Skinner gelesen, sondern sich mit der Folklore begnügt. Das liegt aber nicht etwa daran, daß Skinner sich unklar ausgedrückt hätte (niemand schreibt klarer), sondern daran, daß Chomsky und andere Vertreter des mentalistischen Zeitgeistes das Gerücht verbreitet haben, es lohne sich nicht, den Rattomorphisten Skinner zu lesen. Ich staune seit Jahrzehnten darüber. ("Science and human behavior" steht inzwischen übrigens auch im Netz.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.10.2012 um 17.15 Uhr |
|
Bei Google findet man über tausend Belege dafür, daß Romanautoren ihren Figuren eine "gelungene Charakterzeichnung" zuteil werden lassen. Auch sonst wird oft gelobt, wie "treffend" Schriftsteller ihren Gegenstand behandeln. Niemand scheint zu bemerken, wie seltsam das ist. Wenn jemand sich eine Figur ausdenkt, ist er der einzige, der sie kennt. Niemand sonst kann beurteilen, wie treffend die Darstellung ist. Wahrscheinlich empfindet man eine Darstellung als "treffend", wenn sie dem eigenen Klischee entspricht. So befestigen sich die Klischeevorstellungen ständig selbst. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.10.2012 um 18.16 Uhr |
|
Was die Psychologen zu einem Entführungsfall sagen, der zur Zeit durch die Presse geht, zeigt die völlige Hilflosigkeit dieser Pseudowissenschaft: „Solche Schwersttäter haben in den meisten Fällen eine ausgeprägte psychische Störung, oft eine sogenannte Borderline-Störung“, sagt Lorenz Böllinger. „Sie fühlen sich in ihrem tiefsten Inneren leer, ohnmächtig und depressiv.“ Böllinger ist Psychologe und emeritierter Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Bremen. Er sagt, dass vor allem Allmachtsphantasien Mario B. zu dieser brutalen Tat getrieben haben könnten. „Macht ist in diesen Fällen häufig das zentrale Motiv.“ Tagelang hat der Täter sein Opfer eingesperrt, gequält und missbraucht. Böllinger glaubt, dass der Täter dadurch seine innere Ohnmacht kompensiert haben könnte und bezeichnet dieses Verhalten als „manische Abwehr des Gefühls des Ausgeliefertseins.“ Die Kriminologin Rita Steffesenn betont ebenfalls, dass das Motiv der sexuellen Befriedigung bei einer derartigen Tat nicht im Vordergrund stehen muss. „Es kann dem Täter auch darum gehen, Frustrationen aus dem Alltag zu kompensieren.“ Sexualdelikte hätten häufig auch einen Kontrollaspekt. „Anderen Grausamkeiten und Verletzungen zuzufügen geschieht dann, um ein Gefühl der Kontrolle zu erleben.“ Zu dem Bedürfnis nach absoluter Macht und Kontrolle komme dann noch der Aspekt der sexuellen Erregung, die ein Mensch wie Mario B. möglicherweise empfindet, wenn er sein Opfer wieder und wieder vergewaltigt und misshandelt. Das Streben nach Dominanz trage zudem nicht selten sadistische Züge, nämlich dann, wenn die Gewalt den Täter sexuell errege. (...) Der Psychologe kann sich vorstellen, dass Rebeccas Peiniger auch vor einem Mord nicht zurückgeschreckt wäre. „Je länger eine Gefangennahme dauert, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter die Ausweglosigkeit seines Tuns realisiert.“ Dann krieche die Depression langsam im Täter hoch und könne dazu führen, dass er sein Opfer tötet – im „ultimativen Versuch sich selbst zu retten.“ Man weiß nichts, kleidet sein Unwissen aber in die romanhafte Sprache der "folk psychology". Lauter Metaphern und vorgespiegelte Kausaliäten. Das war im 19. Jahrhundert noch verzeihlich, aber gibt es denn gar keinen Fortschritt? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.11.2012 um 06.49 Uhr |
|
Was für ein Schrott in die Seminarbibliotheken gestellt wurde und zum Teil bis heute eifrig genutzt wird! Jean Aitchison: Der Mensch – das sprechende Wesen. Eine Einführung in die Psycholinguistik. Tübingen 1982. Das erste Kapitel „basiert zum großen Teil auf Chomskys Rezension von Skinners Buch ‚Verbal Behavior‘.“ (253) Sogar die Skinner-Zitate sind sekundär. Kann man sich so etwas vorstellen? Alles übrige konventionell wie in den 70er Jahren üblich. Die späteren Bücher derselben Autorin sind auch nicht besser. (Das Buch aus der Institutsbibliothek ist zerlesen wie sonst nur noch die populärwissenschaftlichen Schmöker von Dieter E. Zimmer. Es wundert mich nicht mehr, daß Magisterarbeiten meistens nichts anderes enthalten und all unsere Mühe in den Lehrveranstaltungen vergeblich war.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.11.2012 um 11.19 Uhr |
|
Vom beklagenswerten Zustand der Psycholinguistik zeugt auch das "Mannheimer Modell" der Schule Theo Herrmanns. Dazu meine Rezension, die 1995 in "Sprache & Kognition" erschienen ist: Herrmann, Th. und Grabowski, J.: Sprechen. Psychologie der Sprachproduktion. Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg: 1994 In immer neuen Anläufen arbeitet Theo Herrmann an einer psychologischen Theorie des mündlichen Sprechens, die sich seit geraumer Zeit mit berechtigtem Selbstbewußtsein als „Mannheimer Modell“ vorstellt. Die neueste Fassung steht in deutlicher Kontinuität zu den Vorgängerwerken (vgl. besonders Herrmann 1982, Herrmann 1985), enthält aber auch wiederum einige Neuerungen und Erweiterungen. Solchen Beziehungen genauer nachzugehen, als es die Verfasser selbst tun (vgl. vor allem S. 337ff.), würde allerdings den Rahmen dieser Besprechung sprengen. Auch ein Vergleich mit dem ebenso repräsentativen Werk von Willem Levelt (1989) muß unterbleiben, obwohl die Beziehungen zwischen den beiden Büchern oft geradezu den Charakter eines (nicht immer offengelegten, besonders in ihrer Stellung zum Konnektionismus auch kontroversen) Dialogs annehmen. Noch größer ist die Verwandtschaft mit dem unabhängig, aber in steter gegenseitiger Kenntnisnahme entwickelten Modell von Friedhart Klix. Auch hier muß es leider mit dem bloßen Hinweis sein Bewenden haben. Es sei immerhin angemerkt, daß die Verfasser des vorliegenden Werkes im Gegensatz zu vielen ihrer Mitstreiter weder die Versprecherforschung noch die Patholinguistik in nennenswertem Umfang heranziehen. Das Buch umfaßt zwei Hauptteile: Im ersten werden empirische Befunde zur Sprachproduktion (Objektbenennung, Lokalisierung, Auffordern, Reden über Ereignisse) vorgestellt, im zweiten wird die eigentliche Theorie entwickelt. Eingerahmt werden diese Teile von einer Einleitung über die verschiedenen Aspekte des Begriffs „Sprechen“ und von einem Schlußkapitel über Anwendungsfälle (Zweitspracherwerb und Telefonkommunikation), das nach Art eines Anhangs eher locker mit der Theorie zusammenhängt. Die Besprechung beschränkt sich auf die Hauptteile. Was die empirischen Befunde betrifft, so bestehen sie einerseits aus den durch zahlreiche Veröffentlichungen bereits bekannten Untersuchungen, andererseits aus neuen Arbeiten, die von der Mannheimer (früher: Marburger) Gruppe in bemerkenswerter Kontinuität, zum Teil auch als Qualifikationsschriften, vorgelegt werden. Nebenbei lernt der Student hier einiges über psychologisches Experimentieren. Von den zahlreichen Einzelbefunden scheinen mir die Ergebnisse der Untersuchungen zum partnerbezogenen Lokalisieren besonders interessant, da sie die traditionelle Rede von „mentaler Rotation“ in neuem Licht erscheinen lassen. Es zeigt sich z.B., daß angesichts von Personen, die rechtwinklig zum Sprecher sitzen, die Identifizierung der rechten bzw. linken Hand kaum schwerer ist als bei einer mit dem Sprecher gleichsinnigen Orientierung, daß jedoch bei gegenübersitzenden Personen ganz erhebliche Probleme auftreten. Eine ausdrücklich als spekulativ dargestellte Interpretation dieses Befundes mithilfe des sprechereigenen „Manipulationsbereichs“ dürfte das Richtige treffen. Ob allerdings die Metaphern vom „Sich-in-den-Partner-Hineinversetzen“ und von den „mentalen Kosten“ etwas erklären, sei dahingestellt. Man fragt sich, warum die Lerngeschichte von Objekt- und Selbstrotation so wenig in Betracht gezogen wird, obwohl die Beobachtung kleiner Kinder eine leicht zugängliche Erkenntnisquelle darstellt. Das theoretische Modell läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: Sprechen ist ein Verhalten, mit dem das System „Sprecher“ sich selbst reguliert, d.h. seinen Ist-Zustand in einen Soll-Zustand umzuwandeln versucht. Dies geschieht durch Regelkreise im Sinne des TOTE-Modells (Test-Operate-Test-Exit), das Miller, Galanter & Pribram in ihrem bekannten Werk vorgestellt haben, und zwar auf mehreren hierarchisch geordneten Ebenen, die dem Modell den Charakter einer großen Behörde mit zahlreichen Unterbehörden verleihen. An der Spitze steht die „Zentrale Kontrolle“, die einerseits alles über Ist und Soll weiß („Fokusinformation“), andererseits die Pläne zur Angleichung von Ist und Soll entwickelt („Zentrale Exekutive“). Sie delegiert die Ausführung jedoch normalerweise an nachgeordnete Instanzen und behält sich nur die Überwachung vor. – Ihr Output ist der Input („Protoinput“) für die nächste Ebene, die „Hilfssysteme“. Diese haben vielfältige Aufgaben: Wahl einzelsprachlicher Ausdrucksmittel für Textkohärenz (Thema-Rhema-Struktur, Anaphorik, Ellipsenbildung), Emphase, Satzbaupläne, Tempus, Modus, Aktiv/Passiv usw. Auch automatisierte Ketten unter Umgehung der zentralen Planung sind ihre Domäne. Sobald jedoch Aufmerksamkeit gefordert ist, die nur in begrenzter Menge zur Verfügung steht, kann die Zentrale Kontrolle die Planung bis ins Detail an sich ziehen, sie also gleichsam zur Chefsache machen. Die Hilfssysteme bearbeiten den Protoinput unter Mitwirkung des „Kommunikationsprotokolls“, das den bisherigen Kommunikationsverlauf aufzeichnet, sowie einer von der Zentralen Kontrolle festgelegten relativ dauerhaften „Einstellung“. – Der Output der Hilfssysteme ist Input für den „Enkodiermechanismus“. Auf dieser Ebene wird die eigentliche Ausführung programmiert: Wort-, Morphem- und Lautfolgen, Prosodisches. (Freilich bleibt etwas undeutlich, wieso erst hier von Sprachlichem „im engeren Sinne“ gesprochen werden kann; s.u.) – Nicht mehr behandelt ist die ebenfalls noch vorgesehene physische Ausführung dieser Vorgaben durch einen „Lautfolgengenerator“. Das Mannheimer Modell gehört also im wesentlichen zur Familie der „Drei-Ebenen-Modelle“ der Sprachproduktion, auf deren gegenwärtige Beliebtheit H&G mit Recht ausdrücklich hinweisen (S. 322, mit Anführung von Autoren wie Schlesinger, Levelt u.a.). Es unterscheidet sich jedoch von den meisten dadurch, daß es nicht erst dort einsetzt, wo „bereits festliegt, daß überhaupt und – meist – worüber gesprochen wird“ – zu spät also, wie die Autoren meinen. Dies dürfte vor allem auf Levelt gezielt sein, der ja ausdrücklich feststellt: »Each speech act begins with the conception of some intention. Where intentions come from is not a concern of this book.« (Levelt 1989, 59, Hervorhebung von mir) – Gerade zur Behebung dieses Mangels dient der kybernetische Ansatz, der es – wenigstens dem Anspruch nach – ermöglicht, das Entstehen der Redeplanung aus jener Ist-Soll-Differenz zu erklären. Das Mannheimer Modell stellt sich auch als „DMF-Theorie“ vor, da es eine in Wörter und Konzepte aufgeteilte, also „duale“ Wissensrepräsentation vorsieht, die zugleich „multimodal“ und „flexibel“ sein soll: Sowohl die Konzepte als auch die Wörter sind aus Komponenten (“Marken“) zusammengesetzt, die verschiedenen Dimensionen (Sinnesmodalitäten, abstraktes Wissen und Bewertungen) angehören und situationsabhängig in unterschiedlichem Maße aktiviert sein können. Damit wird z.B. der vielfach nachgewiesenen Benennungsflexibilität Rechnung getragen. Die Diskussion des theoretischen Teils beginnt zweckmäßigerweise mit dem Beitrag von H&G zur Klärung der Begriffe „Wissen“ und „Können“. Die Autoren begnügen sich nicht mit der bekannten Unterscheidung deklarativen und prozeduralen Wissens, sondern führen eine Dreiteilung ein: deklaratives Wissen, dekomponierbares Können, nicht-dekomponierbares Können – zweifellos ein gewisser Fortschritt, der allerdings das Grundproblem der personalistischen und intellektualistischen Redeweise vom „Wissen“ nicht völlig beseitigt. Erstens wird übersehen, daß auch das deklarative Wissen sich als Können verstehen läßt, nämlich als die Fertigkeit zu sagen, daß etwas so und so ist. Zweitens wird m. E. eine Fertigkeit niemals in der Weise erworben, daß man – wie die Autoren es wenigstens beim Fremdsprachenlernen für möglich halten – einer Regel folgt, zuerst langsam und bewußt, dann – durch „Übung“ – immer schneller und automatischer. Die „Regel“ gehört vielmehr in den Zusammenhang einer handlungsbegrifflichen Simulation. Dieser ganze Komplex ist aus behavioristischer Sicht unter dem Titel „rule-governed vs. contingency-shaped behavior“ realistischer dargestellt worden. Dort ist es denn auch gelungen, den Regelbegriff und das sogenannte „Wissen“ als Fertigkeit zu naturalisieren und so die Handlungsbegrifflichkeit vollständig zu eliminieren. Bei H&G dagegen führt der „Regel“-Begriff eher zu einer Verrätselung; denn was soll es z.B. heißen, daß „Wie-Schemata (...) Strukturen von Regeln für die Herstellung von Proto- beziehungsweise Enkodierinputs“ seien (S. 357)? Die Planeten „folgen“ den Keplerschen Gesetzen, aber nicht weil sie diese kennen und nicht im gleichen Sinne, wie man einem Gesetzbuch folgt. Nicht anders verhält es sich mit dem „regelgeleiteten“ Verhalten der Organismen. Wenn die Autoren meinen, aus dem Können lasse sich in bestimmten Fällen ein Wissen gewinnen (“deklarative Dekomposition“), also etwa aus dem Sprachkönnen eine deklarative Kenntnis der Regeln, welche dem Sprechen zugrunde liegen, so beruht dies auf der irrigen Ansicht, daß das Sprechen tatsächlich von Regeln gesteuert werde, während solche bewußtseinsfähigen Regeln in Wirklichkeit, wie gesagt, nur bei der handlungsbegrifflichen (daher an diskussionsfähige Personen gebundenen) Simulation des Sprechens eine Rolle spielen können. Nur auf dieser interpersonalen Ebene „weiß“ man, wie z.B. englische Negationssätze gebildet werden und kann dieses Wissen auch „vergessen“, ohne das tatsächliche Bilden korrekter Sätze verlernt zu haben. In einem anderen Sinne, dem eigentlich psychologischen, hat man es aber nie gewußt! Denn wie es kommt, daß eine gelesene oder gehörte Regel (die ja auch nur ein komplexer verbaler Reiz ist) uns dazu befähigt, eine sprachliche Reaktion von gewisser Form hervorzubringen, das ist uns introspektiv nicht zugänglich. Kurzum: Kein Können entsteht aus „vorgängigem Wissen“, weder das Fremdsprachenkönnen (von dem die Autoren es annehmen) noch das Werfen von Bällen oder das Radfahren (wovon sie es bestreiten), so daß diese Unterscheidung gegenstandslos ist. In Kapitel 11, das ausdrücklich dem Zweitspracherwerb gewidmet ist, bleibt der genaue Ort von „Regeln“ und „Fertigkeiten“ erwartungsgemäß recht unklar. Mit dem „Wissens“-Begriff ist aber ein weiteres Problem verbunden. Wer sich in irgendeiner Weise verhält, macht dem mentalistischen Modell zufolge von allerlei „Wissen“ Gebrauch, das im vorliegenden Werk in der „Fokusinformation“ enthalten ist. Aber wie umfangreich ist dieses Wissen, vor allem in seinem deklarativen Teil? An verschiedenen Beispielen (Kauf einer Strumpfhose S. 323 u.ö. oder einer Zeitung S. 59 ff.) wird gezeigt, welche Annahmen die Handlungsbeteiligten angeblich machen müssen, um so reagieren zu können, wie sie es tun. Solche Beschreibungen sind, wie aus der linguistischen Pragmatik mit ihren „Restaurant-Skripts“ usw. bekannt ist, ebenso einleuchtend wie banal. Aber darüber hinaus gibt es praktisch unendlich viele weitere Annahmen über das, was in dieser Welt möglich ist und ebenso viele Annahmen über das, was nicht möglich ist. Es wird ausdrücklich behauptet, der Sprecher „meine alles mit“, was zu den Voraussetzungen seines jeweiligen Sprechens gehört, also sämtliche Umstände, die z.B. erfüllt sein müssen, damit er am Kiosk die F.A.Z. verlangen kann. Der Sprecher „meine“ also stets mehr, als er sage („Pars-pro-toto-Prinzip“). Aber was ist dieses geheimnisvolle „Meinen“: ein inneres (verdecktes) Verhalten, sozusagen ein zweites, privates Sprechen neben dem öffentlichen? Wir werden über die „erstaunliche Sensibilität“ informiert, mit der der Sprecher eine „Auswahl“ aus dieser „Ausgangsinformation“ zwecks „Verbalisierung“ trifft; aber das wahre Ausmaß des aus der Philosophie bekannten Problems der unendlich vielen „beliefs“, die in jedem Augenblick vorauszusetzen sind und sich gar nicht mit Gründen beschränken lassen, wenn man sich einmal zu dem kognitivistischen Dogma bekehrt hat, daß Handeln auf Wissen beruhe, wird entweder nicht erkannt oder weit unterschätzt. Eine reine Verhaltensanalyse vermeidet dieses Dilemma, weil sie die Voraussetzungen des Verhaltens dort läßt, wo sie sind, also „außerhalb des Kopfes“, und sie nicht als „(Mit-)Gemeintes“, als „Wissen“ oder als „Repräsentation“ in das Niemandsland einer mentalen Innenwelt projiziert. Sie deutet, mit anderen Worten, die realen Voraussetzungen (= Bedingungen, Umstände), die eine Handlung hat, nicht als Voraussetzungen (= Annahmen, Hypothesen), die der Handelnde macht. Wenn ich auf einer Vorladung lese: Bringen Sie bitte einen gültigen Personalausweis mit. – dann verstehe ich selbstverständlich, daß es sich um meinen eigenen Ausweis handeln soll und nicht um den einer anderen Person, mag er auch noch so gültig sein. Hat nun irgendjemand in der Behörde dies „gemeint“, ohne es zu zu sagen? Müßige Frage! Es sind die Umstände, die weder dem Schreiber noch dem Leser „eine Wahl lassen“ – wie man bezeichnenderweise sagt –, den Text gerade so zu verstehen, wie er verstanden wird. (Ein Kognitivist könnte hier sagen: „Zugegeben! Aber auch die realen Außenbedingungen müssen mental repräsentiert sein, um handlungswirksam zu werden, und was hindert uns, diese Repräsentionen als ‚Voraussetzungen‘ zu bezeichnen?“ Darin hindert uns u.a. der unendliche Regreß, der sich unter einer solchen Annahme ergibt (denn das „Totum“ des „Pars-pro-toto-Prinzips“ ist in der Tat nicht weniger als „Alles“!), und es hindert uns insbesondere die schlagende Unplausibilität einer Theorie, die jedem realen Geschehen, und sei es der Lauf der Planeten, seine faktischen Voraussetzungen als implizites Wissen zuzuschreiben genötigt wäre.) Die Ansetzung von „Konzepten“ ist offenbar – wie die Rede von „Wissen“, „Repräsentation“ usw. überhaupt – ein alltagspsychologisches Erbstück, das auch in der klassischen aristotelischen Dreiteilung (Gegenstände <–> mentale Repräsentation <–> sprachliche Symbole) seine bekannte vermittelnde Rolle spielt. Die Autoren heben ihr DMF-Modell von einer „heute in der Kognitions- und Gedächtnispsychologie vorherrschenden Auffassung“ ab, wonach nicht Wörter und Konzepte, sondern semantische und graphemisch-phonetische Merkmale von Wörtern unterschieden würden. Das trifft m.E. nur mit Einschränkungen zu, da in vielen neueren Darstellungen durchaus – unter welchem Titel auch immer – von Konzepten die Rede ist, die in einem meist mehrstufigen Prozeß in Wörter umgesetzt werden. Andererseits erhebt sich gewiß die Frage, wie weit die „Konzepte“ ihrerseits insgeheim bereits sprachlicher Natur oder zumindest stark von irgendwie parallelen Sprachvorstellungen geprägt sind. Diese Frage stellt sich aber ungemildert auch angesichts der „Konzepte“ von H&G. Das Problem besteht, anders gesagt, darin, daß das Wissen und Denken (oder wie auch immer die „psychischen Prozesse“ benannt werden mögen) im mentalistischen Paradigma unvermeidlicherweise sprachähnlich konzipiert sind, die Modellierung des Kognitiven also gleichsam immer schon auf die Sprache „schielt“, in der das Kognitive sich angeblich manifestiert. Äußeres Indiz ist die allseits beliebte, auch von H&G praktizierte Kapitälchen- bzw. Versalienschreibweise für die „Konzepte“. Wir wollen ja gern glauben, daß diese Schreibweise nur ein Notbehelf ist. Aber die Ähnlichkeit mit ganz gewöhnlichen Wörtern der natürlichen Sprache ist so überwältigend, daß der Verdacht sich aufdrängt, die Konzepte seien deshalb so leicht durch mäßig verfremdete Sprachzeichen darstellbar, weil sie im Grunde nichts anderes sind als ins „Mentale“ projizierte Sprache. Warum sonst sollte davon die Rede sein, „daß es sich bei dieser konzeptuellen Struktur nicht um eine Struktur von einzelsprachlichen Wörtern handelt“, sondern um „Konzepte, die als solche keiner einzelnen Sprache angehören“? Wenn keiner einzelnen Sprache, dann doch vielleicht einer sozusagen „allgemeinen“ Sprache, nämlich einer orthosprachlich normierten Logiksprache oder Sprache des Geistes? Wie sonst wäre es auch nur denkbar, Einheiten und Prozesse, die aller Sprache vorausliegen, in einen Kapitälchen-Code zu übersetzen (denn darum oder um etwas einer Übersetzung zumindest sehr Ähnliches scheint es doch zu gehen)? Und wenn wir annehmen, daß das Sprechen eine feinmotorische Fertigkeit ist, vergleichbar dem Tischtennisspielen, Strümpfestopfen, Jonglieren („Sätze zu bilden, ist dem Klavierspielen ähnlich“, sagen H&G selbst sehr treffend, allerdings nur im Anhang über den Zweitspracherwerb, S. 448) – eine Art Geschicklichkeitsspiel also – was wird dann aus den konzeptuellen Strukturen und ihrer Wiedergabe in sprachlicher Form? So gesehen, verliert gerade die „Dualität“ von Wörtern und Konzepten viel von ihrer alltagspsychologischen Überzeugungskraft, da nicht länger einleuchtet, warum einzig und allein die Wörter vor allen anderen Erscheinungen bzw. Fertigkeiten ausgezeichnet und dem Kognitiven gegenübergestellt werden. (Der unerhörten Auszeichnung des Sprachlichen entspricht die völlige Ausblendung der Tiere als Gegenstand dieser Art von Psychologie. Wir lesen: „Der Mensch hat die fundamentale Eigenschaft, ‚für gleich halten‘ zu können.“ (S. 309) und erinnern uns, daß dies doch nicht nur für den Menschen gilt, Reiz- und Reaktionsgeneralisierung vielmehr im Tierreich ubiquitär sind. Bei dem zitierten Satz handelt es sich also nicht nur um eine unaufgebbare „Grundüberzeugung aller Humanwissenschaften“ (ebd.), sondern um ein viel allgemeineres verhaltensbiologisches Prinzip. Man sieht aber hier besonders deutlich, daß der Mentalismus im Grunde auf eine umfassende Versprachlichung des Psychischen, folglich eine durchgreifende Linguistisierung der Psychologie hinausläuft. Chomsky war es denn auch, der mit einem Federstrich alle – oder zumindest die generativistisch orientierten – Linguisten zu „kognitiven Psychologen“ ernannte.) Was die „Flexibilität“ der Konzepte angeht, so soll der Sprecher einmal dies, einmal jenes an der zu benennenden Sache hervorheben und dementsprechend zu verschiedenen Benennungen gelangen (Fernseher – Glotze, Fußball – Leder usw.). Nichts anderes besagt es, wenn die Autoren festhalten, wir könnten „solche Unterschiede bei der Verbalisierung derselben Sache auf nuancierte Differenzen zwischen Konzept-Markenkomplexen zurückführen.“ (S. 319) Wenn es ein Schritt in Richtung einer Erklärung sein sollte, Benennungsflexibilität auf eine Flexibilität eigens zu diesem Zweck erfundener „Konzepte“ zurückzuführen, dann ist es jedenfalls kein besonders großer. Man setzt sich damit immerhin von der allzu primitiven Vorstellung ab, daß Wörter und Begriffe nach Art eines zweisprachigen Lexikons, mit starren Einträgen auf beiden Seiten, einander zugeordnet sein könnten. Ein wenig tiefer würde die Aufdeckung der Lerngeschichte dringen, wie es für anderes Diskriminationslernen – denn darum geht es – selbstverständlich ist. Ohne diese genetische Analyse ist das unterschiedliche Benennungsverhalten nicht zu erklären, weil es dann völlig undurchschaubar bliebe, wie verschiedene situationelle Bedingungen zu verschiedenen Reaktionen führen: Ob Fernseher oder Glotze, beide Reaktionen sind schließlich gelernt worden, und wenn man zwischen die Situation und die wahrnehmbare Reaktion noch eine nichtwahrnehmbare Umstrukturierung der Konzeptmerkmalkomplexe einzuschalten für richtig hält, so muß man dieses verdeckte Verhalten („mentale Prozesse“ usw.) eben seinerseits als gelernte Reaktion erklären – oder als unergründliches Geheimnis stehen lassen. Nicht klar geworden ist mir folgendes: Wenn jemand einen Stuhl Schrottstuhl nennt, dann soll das darauf beruhen, daß eine negativ bewertende Marke TAUGT NICHTS aktiviert worden ist (S. 97). Aber woher kommt diese Marke? Ist sie im Zusammenhang mit Stühlen vorsorglich gelernt worden – für den Fall, daß einmal ein miserabler Stuhl auftauchen sollte? Eine weitere Verwendung erfährt das Flexibilitätskonzept, wo es um die Zurückweisung von Levelts bekanntem „Hyperonym-Problem“ geht (S. 391, vgl. Levelt 1989, Kap. 6 und Levelt 1993). Levelt argumentiert etwa so: Da spezifische Begriffe alle Merkmale der weniger spezifischen implizieren, müßte z.B. ein Dackel auch die Benennung Hund und Tier hervorlocken usw. Nach derselben Logik müßte ein Tier, das auf Dreiecke konditioniert ist, auch auf Vierecke reagieren, denn Vierecke haben auch drei Ecken (und bloß noch eine mehr), ein einfacher Schlüssel müßte auch komplizierte Schlösser öffnen usw. Es ist klar, daß eine verhaltensorientierte Lerntheorie ein solches Problem gar nicht aufkommen läßt (vgl. etwa Skinner 1957:107). H&G lösen es durch die recht problematische Annahme, daß allgemeinere Begriffe unter gewissen Umständen merkmalreicher sein können als speziellere. Sie kommen damit bei aller demonstrativen Distanzierung von Levelt dessen Logik weiter entgegen, als m. E. nötig wäre. Das Werk ist, wie bereits deutlich geworden sein dürfte, weitgehend in jener „nicht stilreinen“ Diktion abgefaßt, die Herrmann in einem bedeutenden Aufsatz (1982a) kritisiert hat, d.h. in einer systematischen Vermischung von akteurs- und systembezogener Redeweise (“Der Sprecher aktiviert ein Schema“, „Der Sprecher wählt Teile der Fokusinformation aus“ usw.). Die Autoren wissen das natürlich und erklären es als Zugeständnis an eine verbreitete und allgemeiner verständliche Konvention. Sie kündigen ferner an, den Wechsel zu einer laxeren Redeweise jeweils ausdrücklich kennzeichnen zu wollen, was jedoch kaum eingelöst wird. Sie behaupten außerdem, das Gebotene auch in stilreiner Begrifflichkeit darstellen zu können (S. 264), und das soll grundsätzlich nicht angezweifelt werden; aber es wäre doch einmal interessant gewesen, auch nur an einem einzigen Beispiel vorgeführt zu bekommen, wie so etwas funktioniert. Man kann sich nur schwer vorstellen, was aus „Propositionen“, „Auswahl“ usw. in einer akteursfreien Diktion werden müßte. So bezeichnen die Verfasser es als einen besonderen „theoretischen Pfiff“, „daß Teile der Fokusinformation einerseits Auslöser von Sprachproduktionsoperationen sind“, andererseits aber auch deren Objekt, oder, anders gesagt: „Der Sprecher spricht über das, was sein Sprechen auslöst.“ (S. 345) Darin kann ich jedoch nur einen exemplarischen Fall von Begriffskontamination erkennen, denn gerade als auslösbare natürliche Prozesse können jene Operationen schlechterdings kein „Objekt“ und keine „Aboutness“ (oder, wenn wir uns eine gewisse Vereinfachung erlauben, “Intentionalität“ im Sinne der Phänomenologie) haben, sondern nur Ursachen und Wirkungen. In welche begrifflichen Sackgassen man hier gerät, zeigt ein Beispiel von H&G aus dem nichtsprachlichen Bereich: Wenn ich eine Fliege abwehre, so soll dies eine rückbezügliche Handlung sein, weil die Fliege sie auslöst und zugleich Gegenstand der ausgelösten Handlung ist. Öffne ich dagegen auf ein Klingeln hin die Tür, so ist das nicht rückbezüglich, weil die Tür und nicht die Klingel Gegenstand der Handlung ist. Man muß wohl annehmen, daß ein Abstellen der Klingel wiederum rückbezüglich wäre. Aber das zeigt nur, daß es sich hier weitgehend um Wortklauberei handelt, da zwischen den Handlungstypen objektiv überhaupt kein Unterschied besteht. (Das Telefon klingelt, ich nehme den Hörer ab – „rückbezüglich“ oder nicht? Genau genommen hat ja nicht der Hörer geklingelt...) Der grundsätzlich personalistische Handlungscharakter wird durch das Behördenmodell zwar etwas verfremdet, aber keineswegs aufgehoben. Auch einige logische Kalamitäten entstehen auf diese Weise, z.B. wenn es wiederholt heißt, das Sprechersystem repräsentiere die Umwelt und sich selbst in einem internen Modell, das Sprechersystem stelle seinen eigenen Ist-Zustand fest usw. Dies ließe sich vielleicht bereinigen, aber wie steht es um die Gleichsetzung des kybernetischen Begriffs „Soll-Wert“ (einer handlungsbegrifflichen Metapher) mit dem, was der Sprecher als Person „soll“? Es handelt sich hier m. E. um eine bloße Äquivokation, leider im Zentrum der Theorie. Das homöostatische Modell läßt sich zwar empirisch nur schwer plausibel machen, denn wir sind weit davon entfernt, bei jedem Verhalten nachweisen zu können, aus welcher Diskrepanz zwischen Ist- und Soll-Zustand es sich ergibt, aber schon die bloße Darstellung des Modells würde es zwingend erfordern, den Sprecher als Person völlig zu eliminieren. Denn es trifft ja gar nicht zu, daß die Person dem homöostatischen Prinzip folgt. Mit dem Begriff der Person sind Begriffe wie Wille, Handlung, Ziel usw. verbunden, und in dieser Begrifflichkeit ist es analytisch wahr, daß Personen auch in einem Zustand des Ungleichgewichts verharren können, so wie umgekehrt eine kybernetische Maschine gar nicht anders „kann“ als den Sollwert zu realisieren und es eben deshalb in bezug auf Maschinen auch keinen Sinn hat, überhaupt von können und sollen zu sprechen. Das TOTE-Modell ist eben ein Maschinen- oder Automatenmodell, das sich nur metaphorisch und daher ohne sachlichen Gewinn in Handlungsbegriffen beschreiben läßt. Die Einwände, die seinerzeit gegen das mentalistisch kontaminierte Modell von Miller et al. (mit seinen „Plänen“, „Bildern“ usw. ) vorzubringen waren, bestehen unvermindert fort. Man kann das an einem Beispiel der beiden Autoren verdeutlichen: Wenn der Sprecher gegrüßt worden ist, erzeugt eine gesellschaftliche Norm bzw. Konvention den Soll-Wert des „Wiedergegrüßthabens“. Der Sprecher operiert also in einer Weise, die zur Verwirklichung dieses Soll-Wertes führt. Daß er wiedergrüßen „soll“, wird also – mit einer wohl undurchschaut bleibenden Metapher zweiten Grades, einer Rückübertragung aus der metaphorischen Beschreibung der Automaten (vgl. Keil 1993) – als „Soll-Wert“ im Sinne der Kybernetik aufgefaßt. Aber der Sprecher kann es natürlich auch bleiben lassen; und ebenso mag er oft dem Prinzip der „Anstrengungsminimierung“ (S. 62) folgen, andererseits aber sucht er geradezu die Anstrengung (z.B. im Sport) usw. – Wie wäre diese „Freiheit“ in einem kybernetischen Systemmodell unterzubringen? Die Autoren sagen vorsorglich: „Menschen sprechen nur, wenn sie dies wollen oder sollen.“ (S. 272) und nehmen für den Fall, daß der Sprecher nicht wiedergrüßt, ausdrücklich an, daß dann ein konkurrierender Sollwert wirksam werde: die Absicht (!), nicht zu grüßen. – Damit verliert das Modell aber jeden empirischen Gehalt, denn wenn sich kein „Sollen“ (im kybernetischen Sinne des Soll-Wertes) feststellen läßt, bleibt immer noch ein „Wollen“, für das aber das kybernetische Modell keinen Platz hat, denn ein „Woll-Wert“ ist selbstverständlich nicht in Erwägung gezogen. Man wird an das „Lustprinzip“ erinnert, das ebenso leer ist wie das Homöostaseprinzip, weil es lediglich in den unendlichen Strudel einer Entlarvungspsychologie führt, die hinter jedem Verhalten, und sei es das selbstloseste, immer noch das Streben nach Lustgewinn aufdecken zu müssen glaubt und völlig folgenlos bei Schopenhauers „grenzenlosem Egoismus“ endet. In welche begrifflichen Abgründe der mentalistische Ansatz führt, läßt sich an vielen Beispielen verdeutlichen: »Die soeben betrachtete Auslösung eines Sprachproduktionsvorgangs war in bestimmter Weise durch eine im Sprechersystem repräsentierte Konvention geleitet; sie folgte dem allgemeinen Schema: Gesollt ist ein bestimmtes eigenes Verhalten, wenn ein bestimmtes partnerseitiges Verhalten vorliegt, und dieses partnerseitige Verhalten liegt vor.« (S. 274) Ich sehe in solchen Formulierungen nur eine stark verfremdete Darstellung konditionierten Verhaltens: Gegrüßtwerden erhöht aufgrund von Lernen die Wahrscheinlichkeit eines Verhaltens, das als „Wiedergrüßen“ gilt. „Konvention“, „Gesolltes“ usw. haben in einer Verhaltensanalyse eigentlich nichts zu suchen und in einer Analyse, die dem das Verhalten erzeugenden Apparat (System, Organismus) gilt, natürlich noch viel weniger. Die kybernetische Redeweise suggeriert durch einen sprachlichen Vorgriff, „Konventionen“ und „Normen“ seien bereits so weit durchschaut, daß sich ihre Wirksamkeit in einem Regelkreis-Modell darstellen ließe. Das wäre aber erst möglich, wenn es gelänge, derartige Handlungsbegriffe von Grund auf zu naturalisieren. Bisher ist es nicht gelungen, beispielsweise die „Absicht“ als Sollwert zu etablieren oder gar anspruchsvolle mentalistische Konstrukte wie „Selbstkonzept“ und dgl. in das Modell zu integrieren, und es ist auch schwer abzusehen, wie das möglich sein sollte. An einer anderen Stelle ist wiederum ganz beiläufig davon die Rede, daß eine bestimmte Formulierung einfach auf eine „Gewohnheit“ des Sprechers zurückgehen könnte (S. 363, vgl. auch S. 389). Aber „Gewohnheit“ ist, wenn ich recht sehe, kein Bestandteil des Modells und dürfte auch nur schwer zu integrieren sein, zumal sich alsbald die Frage erhebt, ob „Gewohnheitsbildung“ nicht in weit größerem Umfang herangezogen werden müßte, wenn man sie erst einmal in Erwägung gezogen hat: Sprechen überhaupt als Gewohnheit (oder als Menge von Gewohnheiten) – das ist ja geradezu ein Gegenmodell, und zwar ein durchaus respektables. (Ein anderer sporadisch auftauchender und m. E. nicht integrierter Begriff ist „Analogie“.) Wenn Herrman in einem früheren Werk (Herrmann 1985/1994, 274) beiläufig darauf hinwies, daß der psychologische Begriff der „Information“, der auch im vorliegenden Werk ausgiebig benutzt wird, keineswegs mit dem der Informationstheorie übereinstimmt, ja, in gewisserweise geradezu das Gegenteil bedeutet (da die psychologische Informationsgewinnung einen Zuwachs an Ordnung, die informationstheoretische jedoch eine Vernichtung von Ordnung (Redundanz) bedeutet), so kann man auch hier sagen: Das kybernetische Outfit paßt eigentlich schlecht zu einem von Grund auf mentalistisch-handlungsbegrifflichen Inhalt, es ist bloßer „Kybernetismus“. Die Psychologie erwirbt, wie es zunächst scheint, einen Bonus durch begrifflichen Anschluß an wohletablierte Wissenschaften, hier die Informationstheorie; aber wenn sich erweist, daß der so gewonnene Kredit nur auf einer Äquivokation beruht, schmilzt der Gewinn alsbald dahin. Ein besonderes Problem ist die Sprachlichkeit, Vorsprachlichkeit, Voreinzelsprachlichkeit und Nichtsprachlichkeit der Repräsentation innerhalb der verschiedenen Instanzen. Die Zentrale Kontrolle programmiert „Gedanken“, die aber bereits „linearisiert“ sein sollen, eine Linearisierung, die allerdings nicht mit der einzelsprachlichen Linearisierung verwechselt werden dürfe (S. 355), sondern, wie es scheint, eher die Abfolge von Erzählschritten und dgl. betrifft. Die genaue Abgrenzung bleibt jedoch etwas undeutlich. Der Enkodiermechanismus erst habe es mit Sprachlichem im engeren Sinne zu tun, doch bereits die Hilfssysteme machen in größtem Umfang von den Vorgaben der Einzelsprache Gebrauch. Diese Unklarheit, auf die man an vielen Stellen stößt, dürfte einfach darauf zurückzuführen sein, daß die (kognitive, mentalistische) Psychologie ganz im Bann der Sprache steht. Auch wo sie „Vorsprachliches“ zu besprechen meint, setzt sie die Sprachlichkeit ihres Gegenstandes stillschweigend voraus, so in jeder Rede von „Planung“; denn Planen im eigentlichen (nicht-metaphorischen) Sinn gibt es nur unter sprachbegabten Partnern, die mit einander verhandeln können und ebendeshalb einen Begriff von Zukunft haben. Die Verkennung oder Verschleierung dieses Zusammenhangs verschafft der mentalistischen Psychologie einen wiederum andersartigen, aber ebenfalls brüchigen Vertrauensvorschuß, denn sie ermöglicht es, ein von der Kultur- und Sprachgemeinschaft vorwissenschaftlich geschaffenes Plausibilitätsreservoir anzuzapfen: Wir wissen ja immer schon, was Sprechen ist und wie man über Handlungsentwürfe verhandelt. Modelliert nun der Psychologe die unbekannten inneren Prozesse nach dem – sei es auch uneingestandenen – Vorbild solchen Verhandelns, so bewegt er sich auf höchst vertrautem Gelände. Dies wird als hohe Plausibilität erlebt und zugunsten der jeweiligen Theorie verbucht (vgl. Ickler 1994). Diese Anleihe bei alltagspsychologischen Konzepten schlägt als Denkfigur immer wieder durch. Neigt man zunächst dazu, etwa die „Zentrale Kontrolle“ für ein theoretisches Konstrukt von hoher Abstraktheit zu halten (wie es zweifellos auch gemeint ist), so stößt man später auf die geradezu schockierende Mitteilung, die Fokusinformation sei weitgehend der „Introspektion zugänglich“ (S. 293). An solchen Stellen meldet sich der Verdacht, daß ein großer Teil des Modells auf der schlichten alltagspsychologischen Erfahrung beruht, daß man meistens „weiß, was man sagen will“. Ein anderer Teil des Modells leitet sich wahrscheinlich von der entsprechenden Erfahrung her, daß man zwar weiß, was man tut, aber nicht weiß, wie es vor sich geht. Was soll man mit Aussagen von folgender Art anfangen: "Eine Person spricht, um ihrem Gesprächspartner Vorgaben beziehungsweise Anregungen zu geben, wie er den Inhalt seines Bewußtseins zu modifizieren hat." (S. 12, vgl. auch SS. 57, 107 u.ö.)? Wer eine Zeitung verlangt, will doch in einem ganz schlichten Sinn die Zeitung haben und nicht das Bewußtsein des Zeitungsverkäufers verändern. Die meisten Menschen, die auf dieser Erde leben und gelebt haben, verfügen oder verfügten gar nicht über einen Begriff von „Bewußtsein“ und konnten folglich eine Absicht der angeführten Art überhaupt nicht haben. An mehreren Stellen, besonders eindrucksvoll dort, wo es um die eigentliche Erzeugung von Konzepten geht und später noch einmal bei der Wortfolgengenerierung durch den Enkodiermechanismus, machen die Autoren ausdrückliche Anleihen bei konnektionistischen Modellen, wie denn auch im Mannheimer Institut seit einigen Jahren intensiver in diesem theoretischen Rahmen gearbeitet wird. Sie bemühen sich nicht ohne Erfolg, die Vereinbarkeit solcher „subsymbolischer“ Informationsverarbeitung mit der eher symbolisch-sprachhaften nachzuweisen (vgl. etwa S. 341f.), und insgesamt gelangen sie dadurch zweifellos ein Stück über jenen „zu späten“ Beginn der Analyse hinaus, folglich auch über Levelt, der bekanntlich in dieser Zeitschrift eine scharfe (m. E. wenig überzeugende) Attacke gegen die „konnektionistische Mode“ geritten hat. Dennoch fragt man sich, ob es tunlich ist, dem Teufel den kleinen Finger zu reichen, wenn man nicht will, daß er die ganze Hand nimmt. Soll heißen: Warum wird der Konnektionismus nur so selektiv und als Nothelfer bemüht, warum nicht durchgehend als einheitliches Modell? Die Antwort, das sei umständlicher und weniger anschaulich (S. 342), kann in einer so wichtigen Frage nicht recht befriedigen. Auf den begrifflichen Rahmen scheint es denn doch viel mehr anzukommen als auf die wenig aufregenden neuen Verhaltensbefunde. Und so befremdet gerade die Ansetzung einer sehr personalistisch und akteurhaft beschriebenen „Zentralen Kontrolle“ wohl am meisten. Die Neurologie (auf die man vielleicht am ehesten „schielen“ darf, wenn denn schon geschielt werden soll!) hat sich gerade auf breiter Front von jeder Homunkulus-Vorstellung befreit, und wenn es früher schwer war, sich die Ordnung des Tuns ohne zentrale Steuerung vorzustellen, so ist es heute schwerer, sie sich mit einer solchen vorzustellen. Das Ausgehen von Begriffen (bzw. “Konzepten“, die etwas weiter gefaßt sind) und Aussagen (“Propositionen“) gibt dem Ansatz und besonders dem Wirken der Zentralen Kontrolle einen logizistischen Grundzug. Auf der ersten Ebene werden vollständige Sätze erzeugt (gleichsam wie in der Grundschule, wo man „in ganzen Sätzen“ sprechen lernt). Ellipsen werden erst später erzeugt, und auch „Emphase“ wird später generiert und hinzugefügt. Wie aber, wenn es gerade umgekehrt wäre? Man kann sich vorstellen, daß auf der ersten Stufe ein primitives Schreien, Zuschlagen und Davonlaufen in Gang gesetzt, durch zunehmende Bearbeitung jedoch gleichsam zivilisiert wird, wie es dem Individuum in seiner Sozialisations- und Lerngeschichte beigebracht worden ist. Der „Prozeß der Zivilisation“ wiederholt sich vielleicht in jedem einzelnen, biographisch und aktualgenetisch. A. Pick, S. Langer und andere Autoren haben eine Konzeption vertreten, die das „Orektische“ für primär hält. „Propositionen“ wären demnach nichts Ursprüngliches, sondern die letzte Blüte fortschreitender Disziplinierung. Ist das nicht viel wahrscheinlicher als der logizistische, allerdings in Wort und Schrift bequemer darstellbare Ansatz? Die Hauptbestandstücke der Theorie sind, wie man, auch ohne ein „Begriffspurist“ (S. 12) zu sein, ohne weiteres sieht, nicht hinreichend gegen begriffskritische Demontage gesichert. Am wenigsten Angriffsfläche bietet der konnektionistisch konzipierte Teil, aber gerade dieser ist bisher nur halbherzig und skizzenhaft ausgeführt. Es dürfte nicht allzu gewagt sein, für die nächste Version des Mannheimer Modells eine weitere Verschiebung in dieser Richtung vorauszusagen. Literatur Herrmann, Th. (1982): Sprechen und Situation. Eine psychologische Konzeption zur situationsspezifischen Sprachproduktion. Berlin: Springer. Herrmann, Th. (1982a): Über begriffliche Schwächen kognitivistischer Kognitionstheorien: Begriffsinflation und Akteur-System-Kontamination. Sprache und Kognition 1, 3-14. Herrmann, Th. (1985): Allgemeine Sprachpsychologie. München: Urban & Schwarzenberg. (2. Aufl. Weinheim: Beltz 1994) Ickler, Th. (1994): Geborgter Reichtum - ehrliche Armut: Psychologische Sprache als semiotisches Problem zwischen Mentalismus und Behaviorismus. Sprache und Kognition 13, 103-112. Keil, Geert (1993): Kritik des Naturalismus. Berlin, New York: de Gruyter. Klix, F. (1992): Die Natur des Verstandes. Göttingen: Hogrefe. Levelt, W. J. M. (1989): Speaking: From intention to articulation. Cambridge/London: A Bradford Book/MIT Press. Levelt, W. J. M. (1993): Lexical access in speech production. In Reuland, E. & Abraham, W. (Hg.): Knowledge and language. Bd. 1: From Orwell’s problem to Plato’s problem (pp. 241-251), Dordrecht u.a. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.11.2012 um 17.34 Uhr |
|
Steven Pinker hat mal geschrieben: „There's speech perception, in which the ear can decode speech at the rate of between 15 and 45 sound units per second, faster than it can decode any other kind of signal. This is almost a miracle, because at a frequency of about 20 units per second sound merges into a low pitched buzz, so the mouth and the ear are doing a kind of multiplexing, or information compressing and unpacking.” Und der deutsche Psychologe Hans Hörmann: "Pro Sekunde werden etwa 10 Phoneme gesprochen (...), d. h. pro Sekunde müssen allein auf der Phonem-Ebene 10 Entscheidungen gefällt werden." Es gibt noch viele Versionen dieser Ansicht. Man kann daran sehen, wie ein theoretisches Modell mit der Wirklichkeit verwechselt wird, anders gesagt: Weil man mit einer bestimmten Methode Wörter in Phoneme zerlegen kann, glaubt man, die Wörter bestünden aus Phonemen. Phoneme sind aber nur Hilfsbegriffe, Konstrukte, die mit einer bestimmten Analysemethode verbunden sind. "almost a miracle" ... Das sollte dem überzeugtesten Strukturalisten zu denken geben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.11.2012 um 11.14 Uhr |
|
Traditionell sagt man: Das Tier verhält sich in dieser Weise, weil es etwas fressen will/weil es Hunger hat. Der Behaviorismus sagt: Weil es 24 Stunden nichts gefressen hat. Letzteres ist operationalisierbar, der Hunger und das Wollen nicht. Folglich kann man und sollte man es Occams Rasiermesser opfern. „Jede Sprache besteht in Lautäußerungen oder in andern sinnlich wahrnehmbaren Zeichen, die, durch Muskelwirkungen hervorgebracht, innere Zustände, Vorstellungen, Gefühle, Affekte, nach außen kundgeben.“ (Wilhelm Wundt: Völkerpsychologie I: Die Sprache, 3., neu bearb. Aufl., Erster Teil. Leipzig 1911:43) Wenn man das Sprachverhalten erklären kann, ohne auf unbeobachtbare folkpsychologische Konstrukte (Fiktionen) wie "Vorstellungen" usw. zurückzugreifen, sollte man es tun. Grundsätzlich ist das in Skinners "Verbal Behavior" geleistet, wenn das Muster natürlich auch noch durch viel Forschungsarbeit ausgefüllt werden muß. |
Kommentar von Klaus Achenbach, verfaßt am 15.11.2012 um 00.10 Uhr |
|
Würde der Behaviourismus auch sagen, daß der Hirsch in Brunft kommt, weil er sich ein Jahr nicht gepaart hat? Woher weiß der Hirsch das überhaupt?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.11.2012 um 06.42 Uhr |
|
Das ist sicher nur eine Scherzfrage, aber der ernste Kern ist, daß "Wissen" natürlich kein Begriff ist, mit dem ein Behaviorist etwas anfangen kann – außer untersuchen, wie er verwendet wird. Außerdem spielen Sie anscheinend mit der durch Steven Pinker (The Blank Slate) wiederbelebten Fehldeutung, daß der Behaviorismus kein angeborenes Verhalten ansetze. Skinner versucht allerdings durchgehend, nicht das Verhalten selbst, sondern die veränderlichen Umstände seiner "Verstärkbarkeit" herauszuarbeiten. Das ist der Unterschied zu Reflexen. Entzieht man Hühnern kalkreiche Nahrung, picken sie um so eifriger nach Kalkhaltigem, als ob es ihnen gewissermaßen "gut schmeckte" (oder röche?). Sie "wissen" nicht, daß sie Kalk brauchen, und man muß überhaupt nicht von vermuteten subjektiven Empfindungen der Hühner reden. Wir haben die Tatsachen der Deprivierung und der Verstärkung usw., das genügt vollkommen. Man kann sogar exakte Lernkurven für die jeweiligen Umstände und Verstärkungspläne zeichnen. Die angeblich fehlende Erlebnisseite ("Qualia") ist nur konventionelles Gerede. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.12.2012 um 09.36 Uhr |
|
Bei Spracherwerb meiner Töchter fiel mir auf, daß zur Kennzeichnung der Aufforderung zunächst ein Element angefügt wurde, dessen Herkunft ich mir nicht erklären kann. Die erste Tochter, damals in Neu-Delhi, setzte ein me- davor: mejuli 'auf die Schaukel' (hindi: jhula), mebet, mebetti 'ins Bett', megodi 'auf den Schoß' (hindi: goda – Schoß). Die zweite fügte ein -n an: do:chn (will Tuch haben), ausn 'ausmachen', abn 'Füße vom Stuhl nehmen', aufn 'aufmachen' (Schnürsenkel), depn 'Stift' (den sie sucht) usw. Die dritte setzte ein a- davor: a-baj/a-bal 'Ball spielen', a-'bate 'Butterbrot'. Das scheint sonst nirgendwo erwähnt zu werden, aber Zufall wird es auch nicht sein. |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 23.12.2012 um 04.14 Uhr |
|
Sehr interessant. Das hat ja schon fast was von angeborener Universalgrammatik. ;) Gibt es noch mehr solcher Beispiele? Zu der Scherzfrage. Ich vermute mal, Herr Achenbach störte sich an dieser Aussage: "Letzteres ist operationalisierbar, der Hunger und das Wollen nicht." Das Hungergefühl ist vielleicht nicht auf der mentalen Ebene operationalisierbar, aber auf der neurologischen wohl schon eher und insofern mit der Brunft vergleichbar. |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 23.12.2012 um 04.31 Uhr |
|
Hier eine Kritik an Pinker aus evolutionspychologischer Sicht: https://www.dropbox.com/s/z8igbxjjpl9sotq/2002%20how%20language%20evolved.docx (Diese Datei ist bereits nicht mehr vorhanden. –Red.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.12.2012 um 06.16 Uhr |
|
Hier noch eine kleine Auswahl von Beiträgen über Pinker: http://language.home.sprynet.com (emperor.htm) http://www.city-journal.org http://www.calstatela.edu (TheAlmostBlankSlate.pdf) http://andreadallover.com http://www.tnr.com (“Meet the Flintstones”) http://www.newyorker.com http://www.calstatela.edu (NotSoFastMrPinker.pdf) http://www.tnr.com (“Frame Game”) http://language.home.sprynet.com (pwood2.htm) |
Kommentar von Klaus Achenbach, verfaßt am 23.12.2012 um 22.07 Uhr |
|
Lieber Herr Steinhauer, natürlich war meine Frage lakonisch-scherzhaft ausgedrückt. Sie haben aber den ernsteren Hintergrund richtig erkannt. Die Suche nach Nahrung oder Paarungspartnern wird sicherlich durch neurologisch-hormonelle Vorgänge im Körper ausgelöst. Ich sehe keinen Schaden darin, diese körperlichen Vorgänge im übertragenen Sinne als „Hunger“ und „Sexualverlangen“ zu bezeichnen. Natürlich wissen wir nicht, was dabei im Kopf oder im „Geist“ der Tiere vor sich geht, aber das wissen wir von unseren Artgenossen genausowenig. Aber das ist ja etwas Selbstverständliches. Insofern ist das Beispiel von dem Tier, das Nahrung sucht, weil es Hunger hat, nahezu tautologisch. Für den Laien (ich habe übrigens dazu nie etwas von Pinker gelesen) erscheint es wie ein bloßer Streit um Worte. Um einen Vorteil des Behaviorismus darzulegen, bräuchte es Beispiele dafür, daß mentale, kognitivistsche oder andere Ansätze zu Fehlern führen, die der Behaviorismus vermeidet. Übrigens fällt mir jetzt auf, daß der von Ihnen zitierte Satz "Letzteres ist operationalisierbar, der Hunger und das Wollen nicht" nicht recht zusammenpaßt. Derartige Sätze findet man sehr oft. Richtiger müßte es heißen: "Letzteres ist operationalisierbar, der Hunger und das Wollen sind es nicht." |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.12.2012 um 06.07 Uhr |
|
First, let’s do away with the folklore that parents teach their children language. (Steven Pinker) Sprache soll nach dieser Chomskyschen Lehre so angeboren sein wie die Fähigkeit der Spinne, ein Netz zu weben. Die Unterschiede zwischen den Sprachen seien unwesentliche Oberflächenerscheinungen usw. Nach empiristischer Auffassung (Skinner, Ickler) ist es anders: Eltern (und andere Personen) lehren ihre Kinder sprechen, und zwar auf drei Wegen: 1. Shaping: Annäherungen des spontanen Sprachverhaltens werden sukzessive bekräftigt, vulgo belohnt. Der Lohn besteht meisten nicht in Geld und guten Worten, sondern im Erfolg, wenn das Gesagte aufgegriffen, weitergeführt, befolgt wird usw. 2. Vormachen: Nachahmung von Vorgesprochenem (von Generativisten geleugnet, von Eltern millionenfach beobachtet) führt Neues ins Repertoire kindlichen Verhaltens ein. Es wird durch Bekräftigung – s. oben - verankert. 3. Belehrung: tatsächlich ist jedes Kind auch ausdrücklicher Unterweisung ausgesetzt: "Das sagt man, das sagt man nicht." Wir alle wissen, daß Sprache (und anderes Verhalten) auf diese Weise erworben wird. Die Frage ist nur, wie konnten erwachsene Menschen je auf den Gedanken kommen, es zu bestreiten? Bei Chomsky selbst ist klar, daß er sich für die Wirklichkeit nicht interessiert. Er hat sein ganzens Leben damit verbracht, drei oder vier selbstgemachte englischen Sätzchen zu analysieren und sich zu fragen, was diese Analysen über den "Geist" aussagen. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 25.12.2012 um 00.29 Uhr |
|
Aus dem bei Pinker Folgenden wird deutlich, daß er eigentlich hätte schreiben sollen "the folklore that parents must seek to actively teach their children language": http://courses.education.illinois.edu/edpsy313/notes/pinker_motherese.html.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.12.2012 um 06.57 Uhr |
|
Es geht eigentlich um zwei Thesen: Erstens wird behauptet, daß Kinder "von Natur" sprechen lernen; die ärgerliche Tatsache, daß sie in den USA Englisch und in China Chinesisch lernen, wird für eine "uninteressante" Oberflächenerscheinung gehalten (womit sich wirkliche Sprachwissenschaftler eigentlich zufrieden geben könnten, denn diese Oberfläche ist gerade das, was sie interessiert, im Unterschied zu einer "Philosophie des Geistes"). Zweitens geht es um die Notwendigkeit von Babytalk (motherese) als "Input". Aus meiner Zusammenfassung der Lerntheorie geht nicht hervor, daß Babytalk notwendig ist. Es gibt viele Wege der Konditionierung. Aber die These, daß in manchen Kulturen die Erwachsenen weder in Babytalk noch sonstwie mit ihren Kindern sprechen, bevor diese sprechen können, steht auf ganz schwachen Füßen. (Geoffrey Sampson und viele andere haben darauf hingewiesen.) Bei einigen dieser Forschungen (Harkness in Guatemala, wenn ich mich recht erinnere) waren die Kinder schon zwei Jahre alt. Crystal erinnert daran, daß Erwachsene mit Kindern anders sprechen, wenn fremde Beobachter dabei sind. Weder hat man die gesamte Interaktion untersucht noch den Einfluß der Geschwister usw. Durch bloßes Mithören von Gesprächen ohne eigene Teilnahme lernt kein Kind sprechen. Man denke auch daran, wie oft Roger Browns chomskyfreundliche Befunde wiedergekäut wurden und immer noch werden (keine Korrektur durch Erwachsene, keine negative Evidenz usw., übrigens alles unwesentlich für die behavioristische Theorie), obwohl sie durch Moerk, Pullum, Sampson und andere widerlegt sind. Weder Brown noch die deutschen Spracherwerbsforscher Chomskyscher Obervanz deuten ihre eigenen Befunde korrekt. Dafür möchte ich ein Beispiel von Harald Clahsen anführen (aus der Schule Henning Wodes, woher auch der verstorbene Sascha Felix seie verstiegenen Thesen hatte). Ich greife aus Clahsens Dissertation die Negation heraus, immer ein Kernstück dieser Theorien. Clahsen postuliert folgende Erwerbsstadien: 1. Stadium: Negationsträger in variabler Stellung, prä- oder postverbal, nie durch andere Konstituenten vom finiten Verb getrennt. 2. Stadium: Bei Mathias und Daniel ab 34.2, bei Julia ab 28.3 wird präverbale Stellung der Negation ausgeschlossen; auch jetzt treten keine anderen Konstituenten zwischen Verb und Negationsträger. 3. Stadium: Andere Elemente treten zwischen Negation und Verb, bei den beiden Knaben ab 41 Monaten. Der Befund des Corpusbandes sieht anders aus. Mathias zeigt bis zum Alter von 40.3 folgende Konstruktionen: dieser darf er nich wegtun (34.2.) kann er nich (34.2, zweimal) geht er nich bald putt (34.2) das kann da nich drauf (36.3) hoffentlich eß der piepmatz das nich auf (40.3) Das sind 6 Fälle von Konstruktionen, die nach Clahsen erst einem späteren Stadium angehören. Von den übrigen Fällen sind nicht weniger als 11 solche Wendungen wie kann nicht, will nicht, darf nicht, war nicht, also verneinte Hilfs- und Modalverben, die wahrscheinlich en bloc gelernt werden und wo daher auch die Stellung immer die zielsprachlich korrekte ist. Eine scheinbare Ausnahme ist Julia schere nich darf (S. 59), was sowohl von der Mutter wie vom Beobachter und Protokollanten falsch gedeutet wird (1982:77). Der Kontext deutet darauf hin, daß Mathias sagen wollte: Julias Schere ist nicht scharf. Er schneidet nämlich gerade mit seiner eigenen Schere und äußert im folgenden, ohne sich um die irrige Deutung der Mutter zu kümmern: diese scharfe scher (= Diese Schere ist scharf). Mutter: die is besser. Mathias: scharf. nur pier. Julia nein. Mutter: Julia schneidet sich sonst in den finger. Mathias: Julia kann nich pap neiden. Mutter: nein. Mathias: kann nich. Das Ganze bedeutet: Mathias vergleicht seine Schere mit Julias Schere, mit der die Mutter gerade schneidet, und er findet sie schärfer. Die Mutter bestätigt das. Offenbar hat Julia eine Spielzeugschere, mit der man nur Papier, nicht Pappe schneiden kann. Daher meine Deutung der ersten Äußerung als 'Julias Schere ist nicht scharf.' Auch Daniel äußert – bei insgesamt sehr wenigen negierten Äußerungen – mit 39.2 Monaten: kann das nicht. Und Julia sagt schon mit 27.3: ich schaff das nicht (zweimal). Zusammenfassend: Bei Mathias treten im fraglichen Zeitraum bis zum 41. Monat 25 verneinte Verbalsätze auf, durchweg natürlich von sehr geringem Umfang, so daß ein Dazwischentreten weiterer Konstituenten schon aus diesem Grund nicht oft zu erwarten ist. Dennoch kommen 6 solche Fälle vor, und 11 weitere sind wenig signifikant, weil es sich um feste Verbindungen handeln dürfte. Es bleiben ganze 8 Fälle, in denen keine Konstituente zwischen Verb und Negation steht – aber warum auch sollte dort überhaupt eine stehen? So ging es jahrzehntelang in der Spracherwerbsforschung zu. Pinker ist kein bißchen besser. Die Theorie verstellt den Blick auf die Tatsachen, beseitigt sogar das Interesse daran. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.01.2013 um 07.31 Uhr |
|
Der Philosoph Peter Bieri meint: „Wir müssen uns in einer materialistischen Theorie des Geistes intuitiv wiedererkennen können.“ Ähnlich Thomas Metzinger: „Wir müssen diese Theorie (sc. des Bewußtseins) letztlich auch als eine Theorie über unser eigenes inneres Erleben akzeptieren können. Sie muß der Subtilität und dem phänomenologischen Reichtum dieses Erlebens Rechnung tragen und die Innenperspektive des erlebenden Subjekts wirklich ernst nehmen.“ Auch Jay Garfield meint, die Psychologie sei insofern einzigartig, als sie sich vor dem common sense rechtfertigen müsse. Diese Forderung ist befremdlich, da von Wissenschaften sonst nur verlangt wird, daß ihre Erkenntnisse wahr sind, nicht aber, daß sie mit den vorwissenschaftlichen Meinungen der Leute übereinstimmen oder verträglich sind. Die Besonderheit der Psychologie bzw. Theorie des Geistes scheint darauf zu beruhen, daß die vorwissenschaftlichen Meinungen eine unüberbietbare Evidenz und irrtumsfreie Richtigkeit für sich beanspruchen können. Darum ist der Behaviorismus notwendig, der diese naive Ansicht nicht teilt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.01.2013 um 17.26 Uhr |
|
Zum kindlichen Denken noch dies: Eine unserer Töchter war ein Jahr und 8 Monate alt, als sie statt "Spinne" noch Benna sagte. Sie fand es selbstverständllich, daß eine in unserem Haus lebende Spinne auch unseren Familiennamen trug: Benna Ickler. (Das fiel mir eben ein, weil ich gerade ein Buch über das "wilde Denken" lese.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 08.01.2013 um 18.13 Uhr |
|
zum kindlichen Denken: Als unser zweiter Sohn geboren wurde, war der erste knapp zwei, kannte bei Tisch schon Salz- und Pfefferstreuer und konnte diese auch benennen. Wie nun das gerade angekommene Baby gewickelt wurde, schaute er interessiert zu. Der Nabel näßte noch ein wenig und wurde gepudert. Nun, damit kannte er sich aus und rief freudig: "Saß". Meine Frau und ich konnten das Lachen nicht unterdrücken, unser Sohn bemerkte also, daß er etwas falsch gemacht hatte und korrigierte sich sofort: "Föffa". |
Kommentar von R. M., verfaßt am 08.01.2013 um 19.15 Uhr |
|
Sehr hübsch. Aber das Töchterchen sagte doch wohl nicht Benna statt Spinne, sondern sprach Spinne [bena] aus? (Vgl. Pups und Furz.)
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.01.2013 um 09.36 Uhr |
|
Natürlich! Oder sprechen wir Benna "Spinne" aus?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.01.2013 um 09.41 Uhr |
|
Hier der neueste Wochenbericht von den menschlichen Seiten der Affen: »Sinn für Gerechtigkeit ist nicht rein menschlich Schimpansen haben einen Sinn für Fairness. Sie teilen Futter gerecht mit Artgenossen – zumindest, wenn sie sonst Einbußen fürchten müssen, berichten Forscher um Darby Proctor von der Georgia State Universität im Fachjournal „PNAS“. „Verhaltensökonomen gingen bisher davon aus, dass Tiere stets egoistisch handeln würden. Wir haben gezeigt, dass Schimpansen ähnliche Prioritäten setzen wie unsere eigene Spezies“, sagt Frans de Waal von der Emory Universität in Atlanta. Die Forscher ließen sechs Schimpansen in Zweier-Teams das „Ultimatum-Spiel“ spielen. Ein Schimpanse durfte zwischen zwei Spielsteinen wählen, den der zweite Affe beim Betreuer gegen Futter tauschen konnte. Ein Spielstein stand für eine gerechte Verteilung, der andere war eine egoistische Option, die dem Wählenden den Großteil des Futters sicherte. Allerdings durfte der zweite Schimpanse den Spielstein ablehnen. Dann gingen beide leer aus. Im dem Spiel verhielten sich die Schimpansen ziemlich fair, sie entschieden sich häufiger für die gerechte Verteilung. Hatte der zweite Affe keine Möglichkeit der Zurückweisung, waren die Tiere in der Regel deutlich gieriger.« dpa (15.1.13) Klar, daß Frans de Waal dieser wertlosen Experimentiererei die entsprechende Zustimmung widmet. Man kann Tieren alles mögliche beibringen, die Deutung ist dann Sache freundlicher Interpreten. Es hat doch keinen Sinn, moralische Begriffe auf Verhalten anzuwenden, das, wie gerade im Experiment gezeigt, weder Spielräume noch Rechtfertigungsdialoge kennt, also auch weder Schuld noch Verdienst. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.01.2013 um 04.23 Uhr |
|
„Am Ende der Periode des Spracherwerbs verfügt das Kind über ein umfassendes System von syntaktischen und anderen Regeln, mit denen es Sprache verstehen und produzieren kann.“ (Ton Dijkstra/Gerard Kempen: Einführung in die Psycholinguistik. Bern u.a. 1993:96) (= Nachdem das Kind sprechen gelernt hat, kann es sprechen.) Die Sprachregeln werden nicht vom Kind befolgt, sondern vom Linguisten, der sie erfunden hat. Nicht die Sterne richten sich nach den Keplerschen Gesetzen, sondern Kepler. Das zitierte Buch ist eines der vollkommen wertlosen Erzeugnisse einer spekulativen Psychologie, wie sie im Gefolge Chomskys wiederauferstanden sind. |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 20.02.2013 um 20.29 Uhr |
|
(Diese Datei ist bereits nicht mehr vorhanden. – Red.) Ich kann sie problemlos aufrufen: www.dropbox.com/s/z8igbxjjpl9sotq/2002%20how%20language%20evolved.docx Der Link kommt von hier: psych.unm.edu/people/directory-profiles/miller-papers/index.html Titel: "Miller, G. F. (2002). How did language evolve?" Vielleicht klappt es von dort aus besser. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.04.2013 um 06.08 Uhr |
|
Einem Artikel der ZEIT zufolge lernen Kinder die Sprache nicht durch "Nachplappern" – entgegen der "gängigen Meinung". Das soll eine amerikanische Untersuchung herausgefunden haben. (www.zeit.de/wissen/2013-04/linguist-kinder-sprache?google_editors_picks=true) Nun, der Behaviorismus lehrte, daß Sprache nicht durch Nachahmung erworben wird, sondern durch Konditionieren. Der Nativismus lehrte, daß Sprache nicht durch Nachahmung erworben wird, sondern durch Anwendung angeborener Grammatik. Erfahrene Beobachter hatten Mühe, gegen beide Richtungen auch die beschränkte Rolle der Nachahmung zur Geltung zu bringen. Die ZEIT hatte das alles, dank Dieter E. Zimmer, noch nie verstanden. |
Kommentar von Andreas Blombach, verfaßt am 03.04.2013 um 10.57 Uhr |
|
Über diesen Artikel habe ich mich auch ein bisschen geärgert. Allerdings ist das eben die Zeit, wo man auch schon solches lesen durfte: »Behavioristen wie der Harvard-Psychologe Burrhus Frederic Skinner glauben sogar, dass sie die menschliche Psyche programmieren können wie einen Computer. "Gib mir ein Kind, und ich verwandle es in alles Mögliche", lautet einer von Skinners Grundsätzen. Die Macht über das Mentale erscheint unermesslich.« (www.zeit.de/wissen/2012-02/gehirnwaesche-psychologie-gedanken) Da wird Skinner also der häufig zitierte Satz Watsons (in verkürzter Form) untergeschoben, und selbst dieser ist ja bereits aus dem Kontext gerissen. "Macht über das Mentale" ist dann die Krönung des ganzen. Schon früher wurden Skinner und Pawlow mit Descartes in einen Topf geworfen (www.zeit.de/zeit-wissen/2006/06/Titel-Tiere.xml), obwohl ja gerade Chomsky in kartesischer Tradition steht. Immerhin gibt es aber ab und an kleinere Lichtblicke wie diesen (natürlich mit Einschränkungen): www.zeit.de/2010/24/Prinz-Interview/komplettansicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.04.2013 um 05.16 Uhr |
|
In der Beilage „Beruf und Chance“ breitet die FAZ (Ursula Kals) volkstümliche Theorien über den Wert „introvertierter“ Mitarbeiter aus. Angeführt wird auch Sylvia Löhken, eine promovierte Sprachwissenschaftlerin (Deutsche Wortprosodie – Abschwächungs- und Tilgungsvorgänge, 1997) die als Unternehmensberaterin Vorträge über Introvertierte zu ihrem Beruf gemacht hat und als Rednerin gebucht werden kann. Der Glaube an die Realität hinter den Begriffen Introversion und Extraversion (hier wie auch sonst meistens Extro-) ist unerschütterlich. Die Beschreibung der korrelierten Verhaltenstypen ist ganz umgangssprachlich-allzumenschlich, ohne Bezug zu den Testkriterien bei Eysenck usw. Bezeichnenderweise muß man nicht Psychologie studiert haben, um diese Thesen vertreten zu können. In den klischeehaften Verhaltensbeschreibungen glaubt jeder wiederzuerkennen, was er schon weiß, und findet das Ganze sehr gut. Man muß sich richtig anstrengen, um das Ganze als Unsinn zu durchschauen. Der Orientierungsgewinn von Typenlehren ist allzu groß, nur mit dem von Religionen vergleichbar.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.05.2013 um 07.32 Uhr |
|
Nach einem sehr bekannten Zitat aus William James ist die Welt für das kleine Kind "a blooming, buzzing confusion". Das ist vielleicht im Zusammenhang anders zu verstehen, als es meistens verstanden wird, aber das tut hier nichts zur Sache (vgl. http://johnhawks.net/weblog/.../james-blooming-buzzing-baby-2010.html) Allerdings kann sich wohl keiner von uns erinnern, daß er die Welt früher als chaotisch wahrgenommen hat und nun klarer sieht. Das kleine Kind lernt, daß es die heiße Herdplatte besser nicht anrührt usw., aber zu keinem Zeitpunkt erscheint ihm die Welt unbegreiflich, im Gegenteil. Je mehr ich dazulerne, desto unbegreiflicher wird mir die Welt: die Einheitswährung, die Ölkännchenverordnung usw. Aber Spaß beiseite: Ist es nicht viel wahrscheinlicher, daß wir ebenso wie der Frosch, die Zecke, die Fledermaus in jedem Zeitpunkt eine uns angemessene Weltsicht haben, mit der wir auch vollkommen zufrieden sein können, weil sie mit unserem Wohlergehen bestens abgestimmt ist. Und nun zur Menschheitsgeschichte: „What reason is there to assume that all hunting and gathering peoples would stand in awe and terror at the world they have grown up in?“ (Noel W. Smith: Greek and interbehavioral psychology. Lanham, New York, London 1990:34) Gut gesagt! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.06.2013 um 06.25 Uhr |
|
In einem Aufsatz über Rechtschreibfehler schreibt der Deutschdidaktiker Hajo Diekmannshenke: "Als Noam Chomsky (1959) Ende der 50er Jahre das Erklärungsparadigma des Behaviorismus zum Spracherwerb so nachhaltig erschütterte, daß dieser sich davon bis heute kaum erholen konnte, spielten auch Fehler, die Kinder quasi systematisch im Verlauf des Spracherwerbs begehen, eine wichtige Rolle. So verwenden Kinder in einer bestimmten Phase z.B. die Flexionsmorpheme des Präteritums der schwachen Konjugation zeitweise auch für die Flexion der starken Verben. Daß solche Fehler nicht auf Nachahmung oder einem simplen Reiz-Reaktions-Schema als Grundlage des Lernprozesses beruhen können, ist offensichtlich." Also wieder das genaue Gegenteil dessen, was Skinner tatsächlich geschrieben hat (der Verweis betrifft Chomskys berüchtigte Rezension von "Verbal Behavior"). Selbst wenn man, wie Diekmannshenke und so viele andere, Skinners Werk nie in der Hand gehabt hat, kann man sich doch wohl denken, daß Skinner keineswegs ratlos vor Übergeneralisierungen aus Kindermund gestanden hat. Wie aus längst vergangenen Zeiten mutet es auch an, wenn D. den Fehler feiert: "Noch immer herrscht weitgehend die Meinung, daß Fehler etwas Negatives seien. (...) Zeichentheoretisch gesprochen enthält das Lexem ‚Fehler‘ eine negative Bewertungskomponente sowie die deontische Komponente, daß ‚Fehler‘ unbedingt vermieden werden müssen." Usw. Fehler deuteten auf Regelbildung hin, und das sei positiv zu werten. Besonders die Fehler von Ausländerkindern wurden bejubelt. Je konsequenter sie falsch sprechen, desto mehr Regeln haben sie selbst gebildet. |
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 02.06.2013 um 07.45 Uhr |
|
Zeichentheoretisch gesprochen enthält das Lexem ‚Fehler‘ eine negative Bewertungskomponente sowie die deontische Komponente, daß ‚Fehler‘ unbedingt vermieden werden müssen. Täusche ich mich, oder sind diese Formulierungen nichts weiter als Wichtigtuerei? Wozu muß man hier die Semiotik bemühen? Und das Fremdwort "deontisch" erscheint auch übertrieben, jedenfalls für meinen Geschmack, denn es geht schließlich um die ganz pragmatische Entscheidung, seinen Mitmenschen, vor allem den jungen, beizubringen, wie man sich sinnvollerweise verhält. Aus denselben Gründen gibt es gewisse Benimm-"Regeln" (etwa die, "danke" oder "bitte" zu sagen, oder einander die Hand zur Begrüßung zu geben). Die Einübung gewisser allgemeiner Verhaltensweisen ist Aufgabe der Eltern, der Gesellschaft und der Schule, und alles, was darüber hinausgeht (z.B. Fachjargon, diplomatisches Protokollverhalten, Empathie), ist eine Kombination aus spezialisierter Ausbildung und Lebenserfahrung. Daß "‚Fehler‘ unbedingt vermieden werden müssen" ist natürlich nicht richtig, denn wer begeht in seinem Leben keine Fehler? Sie sollten natürlich vermieden werden, aber während im richtigen Leben Fehler mit einer Entschuldigung, einem Corrigendum oder einem Blumenstrauß o. ä. aus der Welt geschafft werden können, ist ein Fehler in der Schule für manche Didaktiker ein rotes Tuch. Deshalb sollte man die Fehler wohl am besten ganz abschaffen oder wenigstens positiv bewerten dürfen. Letzteres ist ja nicht ganz unvernünftig, denn es gibt ja auch Fehler, die nur intelligente Schüler machen; es ist sogar möglich, daß ein Schüler mehr weiß als sein Lehrer und die angeblich "falsche" Antwort richtig ist. Die Mehrheit unserer Deutschdidaktiker sitzt meines Erachtens in einem falschen (d.h. vollkommen wirklichkeitsfremden) Zug. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.06.2013 um 08.08 Uhr |
|
Ja, natürlich, das ist alles nur heiße Luft. Aber das Aufbauschen ist so üblich, daß auch unverdächtige Autoren es kaum noch bemerken. Ein germanistisches Lehrbuch beginnt so: Alle Sprachen befinden sich in ständigem Wandel. Diese Tatsache gehört zu den Universalien der Sprache. Der zweite Satz bedeutet dasselbe wie der erste, ist aber mit dem schwierigen Begriff der „Universalien“ belastet. Dem Leser hilft es nicht gerade. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 02.06.2013 um 14.13 Uhr |
|
Wenn ein Kind in der bayerischen Grundschule beim Subtrahieren nicht das Borgen-Verfahren verwendet, wird auch ein richtiges Ergebnis als Fehler gewertet, obwohl es in den weiterführenden Schule sofort durch das Ergänzungs-Verfahren ersetzt wird. Ebenso würde es als Fehler gewertet, wenn Grundschüler bei Textaufgaben einfach Gleichungen aufstellen würden. Carl Friedrich Gauß hätte in bayerischen Grundschulen eine Fünf in Mathe bekommen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.06.2013 um 14.54 Uhr |
|
Das muß nicht absurd sein. Wer beim Gehen über 10 km die Füße gleichzeitig vom Boden nimmt, weil er dann schneller vorankommt (sieht auch besser aus!), wird disqualifiziert.
|
Kommentar von Horst Ludwig, verfaßt am 02.06.2013 um 18.14 Uhr |
|
Das hier angesprochene Gehen muß nicht unbedingt schlechter aussehen. Wenn da Sportgeher in die Hüfte einknicken, naja, sie haben's halt nicht besser gelernt oder können nicht mehr. In Wirklichkeit ist dieses Gehen gut fürs Marschieren mit einem vielleicht sogar schweren Tornister, wo man sich also freut, wenn ein Fuß immer am Boden ist und man nicht kraftverschwendend herumhüpft, sondern alle Kraft darauf verwendet, daß man vorwärts kommt. Und als ich in den 50er Jahren die schwedischen Weltklassegeher (Ljunggren) kennenlernte, fiel mir auf, wie normal die eigentlich gingen — und natürlich auch, wie schnell die dabei an einem vorbei waren. Aber dabei konnte ich immer gut, wenn auch nur kurz, von hinten sehen, wie normal die gingen. Gemeinsam hatten wir übrigens, daß weder sie noch ich je verwarnt wurden... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.07.2013 um 09.16 Uhr |
|
„Chomsky hält es für unmöglich, daß Kinder die Fähigkeit zur Bildung grammatisch korrekter Sätze ausschließlich durch Imitation von im Alltag aufgenommenen Beispielen und durch induktive Erschließung der Regeln aus diesen Beispielen erwerben können.“ (Andreas Gardt: Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland. Berlin 1999:333) Das wird als Kritik an Skinners „Verbal Behavior“ wiedergegeben. Aber wo ist bei Skinner von Imitation und Erschließung von Regeln die Rede? Chomsky spricht übrigens auf 13 Seiten seiner Skinner-Rezension von Ratten, die Hebel drücken, obwohl Ratten im rezensierten Werk gar nicht vorkommen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.07.2013 um 11.48 Uhr |
|
Bei SPIEGEL online kann man ein Psychologie-Quiz mitmachen, das das ganze Elend der heutigen Psychologie zeigt. Mit folk-psychologischen Begriffen wie "Willensschwäche" werden die geläufigen Weisheiten weiterverbreitet, daß also zum Beispiel Alkoholiker nicht willensschwach (sondern krank) sind, daß Schizophrene keine gespaltene Persönlichkeit haben usw. – Kann wegfallen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.07.2013 um 09.12 Uhr |
|
Wortbildungen entspringen der kreativen Kraft der Sprache und der Sprecher. (Hans Jürgen Heringer: Grammatik und Stil. Frankfurt 1989:193) Ich übersetze: Wortbildung kommt vor. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.08.2013 um 15.08 Uhr |
|
„Die Sendung litt darunter, dass niemand am Tisch saß, der den Freigelassenen nach wie vor im Verdacht hat, ein extrem gescheiter Psychopath mit viel verstautem Aggressionspotenzial zu sein.“ (http://nachrichten.rp-online.de) Das schreibt die Rheinische Post in einem durchaus Mollath-freundlichen Artikel. Da ist dann doch wieder das verkorkste Vokabular der populären Psychologie, die heute über das Schicksal von Menschen entscheidet. Allerweltsweisheiten werden in pseudogelehrte Begriffe gekleidet, z. B. das Aggressionspotential (mit hydraulischer Metaphorik nach Freud); dazu gehört der Narzißmus ebenso wie die bipolare Persönlichkeitsstörung, das Borderline-Syndrom und der ganze weitere hilflose Unsinn. Irgendwann wird sich die Menschheit von der sogenannten Psychologie befreien, aber wir werden es nicht mehr erleben. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 17.08.2013 um 22.27 Uhr |
|
Nach den Enthüllungen von Gert Postel ("Doktorspiele", www.gert-postel.de) und nach dem Fall Mollath kann man die aktuelle Psychologie getrost der mittelalterlichen Inquisition gleichsetzen. Jegliche psychologischen Gutachten gehören m. E. verboten. Es ist eine gruselige Vorstellung, wie viele völlig gesunde Menschen aufgrund solcher Gutachten vielleicht in geschlossenen psychiatrischen Anstalten eingesperrt sind.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.09.2013 um 07.27 Uhr |
|
Skinner hat eher beiläufig den unvergleichlichen Nutzen der Sprache etwa so dargestellt: Das Verhalten, das im Aussprechen von Wörtern wie rot besteht, ist die einzige Reaktion, die – unter passenden Umständen, die ebenfalls gelernt werden – auf alles Rote erfolgt. Das ist natürlich nur ein Beispiel, man muß die endlose Reihe von "Abstraktionen" ergänzen, die in unseren Sprachen entweder schon auf diese Weise bedacht sind oder jederzeit neu gebildet werden können, angefangen mit dreieckig, Kugel usw. Kein Tier reagiert einheitlich auf alles Rote, alles Dreieckige usw. Bemerkenswerterweise erklärt Skinner also die Abstraktion ohne Rückgriff auf das "Denken" und andere vorwissenschaftliche Begriffe. Zu den passenden Umständen: Chomsky hat gegen Skinner einwenden zu müssen geglaubt, daß wir nicht jedesmal, wenn wir Mozart hören, Mozart sagen. Wer Skinner gelesen hat, wird sich mit solchen Einwänden nicht weiter beschäftigen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.10.2013 um 09.21 Uhr |
|
„Während der Behaviorismus den Wissenserwerb vollständig durch Reiz-Reaktions-Mechanismen zu erklären versuchte[93], begann man in den 1960er Jahren, interne psychische Zustände zu postulieren, die als Wissensrepräsentationen den Lernerfolg erklären sollten.“ (Wikipedia s. v. Wissen) Der Verweis [93] geht auf John B. Watson: „Psychology as the Behaviorist Views It“, in: Psychological Review 20, 1913, S. 158–177, als sei das „der“ Behaviorismus. Man könnte den Unsinn korrigieren, aber es würde nichts nützen, er ist zu tief verwurzelt. |
Kommentar von Andreas Blombach, verfaßt am 10.10.2013 um 16.02 Uhr |
|
Das ist natürlich ein ganz allgemeines Problem – Felder werden besonders von Außenstehenden oft als wesentlich einheitlicher gesehen und dargestellt, als sie eigentlich sind. Das fällt einem aber blöder- und üblicherweise erst dann auf, wenn es sich um ein Feld handelt, mit dem man selbst vertraut ist. [Jede Abstraktion ist gewissermaßen eine Lüge, aber ganz ohne geht es leider auch nicht. Viele sind allerdings allzu bequem.] Da ich mich gerade ein wenig mit Semiotik beschäftige, ist mir aufgefallen, wie oft Morris' Zeichenbegriff als behavioristisch charakterisiert wird – wobei er als Mead-Schüler schon einen deutlich anderen Behaviorismus vertreten hat als viele Behavioristen seiner Zeit. Skinner verzichtet z.B. gleich ganz auf Begriffe wie Zeichen oder Symbol (auch wenn er sie natürlich in seinem Sinne hätte umdefinieren können), was ich recht sympathisch finde. ("'Sign,' 'symbol,' and more technical terms from logic and semantics commit us to special schemes of reference and stress the verbal response itself rather than the controlling relationship." (VB: 81)) Ich glaube übrigens nicht, dass es nichts nützen würde, Behauptungen wie die von Ihnen angeführte in der Wikipedia zu korrigieren – gerade Wikipedia hat ja eine große Flächenwirkung. Das Frustrationspotential scheint aber relativ hoch zu sein, weil jede Änderung natürlich leicht von anderen revidiert werden kann, was leider häufig in sog. "edit wars" ausartet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.10.2013 um 16.57 Uhr |
|
Morris hält sich viel zu sehr an Peirce, als daß Skinner in ihm einen Behavioristen hätte sehen können. Ich erinnere nicht, daß Skinner ihn erwähnt, obwohl Skinner sonst keine Gelegegenheit ausläßt, Vorgänger und Gleichgesinnte anzugeben. Morris äußert sich gelegentlich über Skinner, aber ich habe nicht den Eindruck, daß er ihn verstanden hat. Jedenfalls sind Morris' Begriffe und Thesen doch ziemlich weit von Skinner entfernt.
|
Kommentar von Andreas Blombach, verfaßt am 10.10.2013 um 19.04 Uhr |
|
In "Verbal Behavior" zitiert Skinner ja generell sehr wenig, ich kann mich aber auch sonst an keine Erwähnung von Morris erinnern. Morris dagegen hat sogar eine Buchbesprechung von "Verbal Behavior" geschrieben, die 1958 in "Contemporary Psychology" erschien. Gelesen habe ich sie nicht, Terry J. Knapp attestiert ihm aber immerhin eine klare und prägnante Zusammenfassung des Werks, auch wenn Morris natürlich eine Zeichentheorie in seinem Sinne darin vermisst (siehe hier). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.10.2013 um 04.32 Uhr |
|
Es ist schon lange her, daß ich Morris gelesen und exzerpiert habe, aber wenn ich ihn recht verstehe, beharrt er auf einem Zeichenmodell, aus dem die mystische "Beziehung" auf etwas (Referenz, Denotation, Signifikation, kurz: Aboutness) nicht verschwunden ist. Das macht ihn für Behavioristen uninteressant. Gut ist seine Warnung davor, jeden Reiz zum Zeichen zu erklären, also einem semiotischen Imperialismus zu verfallen, wie ich es auch an Rudi Keller kritisiert habe (in meinem Aufsatz "Wirkliche Zeichen"); s. a. hier.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.10.2013 um 13.53 Uhr |
|
Wie ich jetzt erst sehe, ist der Psychologe Theo Herrmann im Juli verstorben. Er hat zahlreiche, teils lesenswerte Bücher hinterlassen. Mich hat er einmal brieflich ermuntert, auf meinem behavioristischen Weg weiterzumachen; ich als Nichtpsychologe könne mir das erlauben, er leider nicht. Um das zu verstehen, muß man seinen meiner Ansicht nach bedeutendsten Text heranziehen: "Über begriffliche Schwächen kognitivistischer Kognitionstheorien: Begriffsinflation und Akteur-System-Kontamination". Sprache und Kognition 1 (1982):3-34. Damit hat er innerhalb der Zeitschrift eine kurze Diskussion ausgelöst, die aber nicht weitergeführt worden ist. Oder vielmehr: Die eigentliche Würdigung stammt von mir, dem Laien, und zwar in den hier bereits wiedergegebenen Texten aus derselben Zeitschrift. Herrmann selbst hat mehrmals versucht, trotz aller Vorsicht ein stilreines nichtmentalistisches Modell vorzuführen, z. B. in Allgemeine Sprachpsychologie. Grundlagen und Probleme. 2. Aufl. Weinheim 1995 (=1985), es ist ihm aber nicht gelungen. In meiner Rezension zu Herrmann/Grabowski (siehe hier) habe ich das ausführlich gezeigt. So zeigen seine Bücher zur Sprachpsychologie über die Jahre hin eine gewisse Eintönigkeit. Zum Beispiel wird fast jedesmal das Schema "Auffordern" (AUFF) behandelt, immer gleich und all den Einwänden ausgesetzt, die Versalien anstelle von wissenschaftlichen Theorien eben auslösen. Wir haben es bei Peter von Polenz schon gesehen. Das ist ein bißchen tragisch. Herrmanns Schüler haben seine Arbeit fortgesetzt. Werner Deutsch hat noch in Marburg, wo ich viel mit ihm diskutieren konnte, eine Dissertation über die Psychologie der Objektbenennung verfaßt. Wie gezeigt, ist die Herrmann-Schule doch sehr ähnlich und oft identisch mit dem, was vor allem Willem Levelt ("Speaking") und andere am MPI in Nijmegen getrieben haben: sehr traditionelle mentalistische Psychologie in etwas modernisierter Ausdrucksweise. Große Betriebsamkeit auf jeden Fall, aber magere Ergebnisse. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.10.2013 um 15.00 Uhr |
|
Jemand hat ein Buch darüber geschrieben, wie sich beim Kind die Ansicht von der Rolle des Gehirns entwickelt. Das ist natürlich Unsinn. Solche Ansichten entwickeln sich nicht, sondern werden in das Kind hineingeredet. Aristoteles war einer der klügsten Menschen und konnte auch gut beobachten, aber vom Gehirn hatte er ganz falsche Ansichten. Immerhin wußte er, daß es Gehirne gibt, Kinder wissen das meist nicht aus erster Hand. Hunderttausende von Jahren war das Hirn für die Menschen nur ein Leckerbissen. Auch religiöse Vorstellungen "entwickeln" sich nicht beim Kinde. Man kann höchstens untersuchen, wie die Übernahme der Erwachsenenansichten funktioniert. Im Religionsunterricht soll ja dann erklärtermaßen das Kind "seine" Religion kennenlernen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.11.2013 um 05.00 Uhr |
|
„Unlike human beings, animals cannot speak about their thoughts.“ (Herbert Terrace: „Thought without words“. In: Blakemore, Colin/Greenfield, Susan (Hg.): Mindwaves. Thoughts on Intelligence, Identity and Consciousness. Oxford 1987:123-137) Man setzt also voraus, daß Menschen über ihre Gedanken sprechen können. Das ist analytisch wahr, in jenem Sinne, in dem Sätze wahr sind, die einfach die Geschäftsordnung der Sprache exemplifizieren. Zur deutschen Sprache gehört es, daß wir denken und daß wir sprechen, daher auch, daß wir über das Sprechen und Denken sprechen und denken (und auch wiederum darüber!). Die naturalistische Psychologie vermeidet diese alltagssprachlichen Ausdrucksweisen. Sprechen ist eine beobachtbare Verhaltensweise, Denken nicht. „Denken“ ist ein folkpsychologisches Konstrukt, eine vielleicht nützliche Fiktion. Das Sprechen über das Denken ist eine transgressive Metaphorik, die sich im Laufe der Jahrhunderte herausgebildet hat. In der Alltagssprache ist es nicht möglich zu fragen, ob Menschen denken können. Die Antwort Menschen können nicht denken wäre ein pragmatischer Widerspruch (wie Ich kann nicht sprechen). Wer so redet, beherrscht offenbar die deutsche Sprache nicht, und mehr ist dazu nicht zu sagen. Die Frage, ob Tiere denken können, ist aus demselben Grund nicht wissenschaftlich entscheidbar. Man kann den Sprachgebrauch so ausweiten, daß Tieren das Denken zugesprochen wird, man kann es aber auch anders machen. Mit Definitionen ist hier nichts zu erreichen, die Sprachgemeinschaft muß einen neuen Gebrauch übernehmen oder eben nicht. Dabei dürfte eine Rolle spielen, ob man zum Beispiel Affen „anspricht“, d. h. sie praktisch als Personen behandelt. Im Umgang mit Hunden und anderen Tieren kommen bereits jetzt auch bei uns viele personalisierende Kommunikationsformen vor, so daß es eine Ermessensfrage ist, den Hunden Sprechen und Denken zuzuschreiben; sie kommunizieren freilich auf eine andere Art, aber das ist kein grundsätzlciher Einwand, denn es trifft auch auf Kinder und Fremde zu. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.11.2013 um 07.45 Uhr |
|
Alle Menschen haben Sprache, das legt den Gedanken nahe, es könne sich um eine angeborene Fähigkeit handeln (deren konkrete Ausgestaltung dann historisch-zufällig wäre). Sehen wir, wie Tauben in zwanzig Minuten dazu gebracht werden, Pingpong zu spielen, dann kommt einem die Ahnung, daß die Sprache für den Menschen ebenso wenig natürlich, ja geradezu abwegig sein könnte wie das Pingpongspielen für die Tauben. Die Lernfähigkeit (Konditionierbarkeit) ist da, aber der Rest ist kulturelle Akkumulation (s. Nachahmen und Vormachen). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.11.2013 um 16.23 Uhr |
|
Über das Sprechen und Verstehen haben die Kognitivisten auch ganz naive Vorstellungen: „Gesprochene Sprache wird mit einer Rate von zwei bis drei Wörtern pro Sekunde produziert. Jedes Wort wird aus mehreren 10000 Wörtern des mentalen Lexikons mit dieser Geschwindigkeit ausgewählt. Artikulation findet mit einer Geschwindigkeit von ca. fünfzehn Phonemen pro Sekunde statt. Wenn wir davon ausgehen, daß alle Schritte sequentiell durchgeführt werden, bedeutet dies, daß die langsamste Komponente die Geschwindigkeit der Verarbeitung bestimmt, in unserem Fall der Konzeptualisierer.“ (Günther Görz, Hg.: Einführung in die künstliche Intelligenz. Bonn u.a. 1993:505) Demnach müßte man um so länger nach einem Wort suchen, je mehr Wörter man schon kennt. Eher ist das Gegenteil der Fall. „Diese Wörter müssen in dieser Zeit aus einem Lexikon mit mehreren Tausend Einträgen selegiert, syntaktisch spezifiziert, Phonem für Phonem enkodiert und motorisch programmiert werden.“ (Thomas Pechmann: Sprachproduktion. Zur Generierung komplexer Nominalphrasen. Opladen 1994:12) „Speech is normally produced at a rate of about two to three words per second. These words are selected at that rate from the many ten thousands of words in the mental lexicon.“ (Willem J. M. Levelt: Speaking - From intention to articulation. Cambridge (Mass.)/London 1989:22) „Pro Sekunde werden etwa 10 Phoneme gesprochen (...), d. h. pro Sekunde müssen allein auf der Phonem-Ebene 10 Entscheidungen gefällt werden.“ (Hans Hörmann: Psychologie der Sprache. Berlin 1977:45) „There's speech perception, in which the ear can decode speech at the rate of between 15 and 45 sound units per second, faster than it can decode any other kind of signal. This is almost a miracle, because at a frequency of about 20 units per second sound merges into a low pitched buzz, so the mouth and the ear are doing a kind of multiplexing, or information compressing and unpacking.” (Steven Pinker) Einen Kommentar, den ich schon einmal zitiert habe, gibt David Palmer: „The model has slipped out of the linguist’s notebook into the speaker’s head.” |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.11.2013 um 05.37 Uhr |
|
Die Sinnlosigkeit des Standardwerks "Speaking" von Willem Levelt wird jetzt auch knapp und schonungslos nachgewiesen bei M. R. Bennett/P. M. S. Hacker: History of cognitive neuroscience, Chichester 2013 (S. 141ff).
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.11.2013 um 14.28 Uhr |
|
Derselbe Trugschluß, den ich schon unter dem Stichwort "Planimeter" erwähnt habe, findet sich fast flächendeckend in der mentalistischen Linguistik. Hugo Steger liefert schon in Didaktik Deutsch 3/1971 ein Beispiel: Chomsky war der letzte Schrei. „Hierfür bietet sich als Grundlage die mathematische Automatentheorie an.“ S. 3. Dann dilettiert der Altgermanist Steger in Automatentheorie. (Frohgemut wird der Nachholbedarf gegenüber den USA zelebriert. Damals lasen wir als vermeintliche Standardwerke amerikanische Bücher, die drüben überhaupt keine Rolle spielten und längst vergessen sind.) „In irgendeiner Form müssen ja die von uns hier vorgenommenen Regelanwendungsabläufe [sc. der generativen Simulation] auch vom sprechenden und hörenden Menschen und dazu noch mit außerordentlicher Schnelligkeit, Ökonomie und Sicherheit vorgenommen werden.“ (Steger) D. h. die Simulation muß auch im Original eine Entsprechung haben – das ist eben der Fehlschluß. Er durchzieht die gesamte kognitive Linguistik. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.11.2013 um 08.19 Uhr |
|
Nach einer bestimmten Theorie der Zivilisation ist es barbarisch, mit den Fingern zu essen. Man legt durch Gerätschaften wie Gabeln oder Stäbchen eine Distanz zwischen die Speise und den Mund. Die Theorie stützt sich auf wenige Gesellschaften und scheitert an den Indern, die auch schon lange nicht mehr auf Bäumen leben und es trotzdem unangenehm finden, mit metallenen Gabeln im Mund herumzustochern. Man soll ja auch mit der Gabel nicht die Zähne berühren. Das Geräusch, sei es noch so leise, verursacht vielen Menschen eine Gänsehaut, ebenso wie beim Berühren des Porzellantellers mit Gabel, Löffel oder Messer. In China muß man sich daran gewöhnen, daß der Gastgeber Leckerbissen von seinem eigenen Teller herüberreicht, natürlich mit den Stäbchen, deren Spitzen er selbst vorher im Mund gehabt hat. Es kommt niemandem in den Sinn, daß es damit ein Problem geben könnte. Setzt man sich darüber hinweg, kann man in China die herrlichsten Freßorgien erleben, meistens ist es auch sehr lustig. Mit der Behauptung von Universalien muß man eben vorsichtig sein. |
Kommentar von Argonaftis, verfaßt am 28.11.2013 um 09.32 Uhr |
|
Es ist heutzutage in Griechenland noch eine weitverbreitete Sitte, salata choriatiki (Bauernsalat) aus dem in der Mitte des Tischs stehenden Teller aufzuspießen. Ebenso bricht jeder eine Scheibe des nur angeschnittenen Brots aus dem gemeinsamen Körbchen für sich ab. Im Restaurant eines fernsehbekannten Kochs in Deutschland hat dieser meinen Freunden beim Abschied gesagt, sie brauchten nicht mehr wiederzukommen; einer der Gäste hatte es sich erlaubt, seinem Tischnachbarn eine Kostprobe von seinem Teller auf der Gabel zu reichen. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 28.11.2013 um 09.58 Uhr |
|
"Hepatitis among top 10 causes of death in India" lautete eine Schlagzeile vom 26. 7. 2013.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.11.2013 um 10.24 Uhr |
|
Ja, über die verschiedenen Arten, die Welt wahrzunehmen, habe ich auch schon mehrmals berichtet, obwohl ich so furchtbar weit nicht in der Welt herumgekommen bin. Das betrifft insbesondere die Einschätzung fremder Völker als "schmutzig". Wir haben uns in Indien strikt daran gehalten, kein nichtabgekochtes Wasser zu trinken (manchmal schwierig, wenn man bei Freunden ein Glas aromatisiertes Wasser gereicht bekommt), kein ungeschältes Obst und vor allem keine Salate zu essen (Kopfdüngung im ausgetrockneten Bett der Yamuna). Unsere kleine Tochter hatte in den ersten Wochen Fieber, aber danach waren wir alle gesund und munter, bis auf eine Blutvergiftung aus unscheinbarem Anlaß, die ich mir in Benares zugezogen hatte. In den Augen konservativer Inder gelten eher wir als die Schmutzigen, aus verschiedenen Gründen, die ich nicht zu wiederholen brauche. Ich habe mit Mißfallen Deutsche über die unglaubliche Schmutzigkeit der Chinesen schwadronieren hören. Sie hatten Restaurantküchen betreten, wovon man aber auch hierzulande besser Abstand nehmen sollte, es ist durchaus nicht immer so wie im Fernsehen. Verblüffend ist (oder war damals) das Nebeneinander medizinischer Höchstleistungen in den Spitzenkliniken und dienenden Frauen, die mit ihren allgegenwärtigen Reisigbesen in denselben Kliniken den Staub aufwirbelten. Tatsächlich wird das Dienstpersonal von den Höhergestellten überhaupt nicht wahrgenommen – das ist überhaupt das Gewöhnungsbedürftigste in Indien und einigen anderen Ländern. Aber ich urteile nicht, ich bin ein Beobachter. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 28.11.2013 um 20.56 Uhr |
|
Die zitierte Schlagzeile entstammt einer indischen Quelle, also ist es Selbstwahrnehmung. Andererseits gehört natürlich Hepatitis zu den Konzepten der »westlichen« Medizin.
|
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 29.11.2013 um 20.35 Uhr |
|
Die durchs Essen übertragene Hepatitis A gehört schwerlich zu den zehn häufigsten Todesursachen in Indien.
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 29.11.2013 um 22.46 Uhr |
|
Nein, Hepatitis E ist wesentlich gefährlicher, wird aber ebenfalls durch verunreinigtes Wasser übertragen.
|
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 30.11.2013 um 14.12 Uhr |
|
Besonders in Überschwemmungsgebieten.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.12.2013 um 05.14 Uhr |
|
Da Chomsky gerade 85 geworden ist, möchte ich zitieren, was Wikipedia (unter "Habitus", nach Bourdieu) schreibt: Noam Chomsky untersuchte das Sprechverhalten der Menschen und ist zu mehreren Ansichten gekommen. Chomsky hält es für lächerlich, das Sprechverhalten zu untersuchen, und hat es auch tatsächlich nie untersucht. (Ich komme auch jeden Tag zu mehreren Ansichten.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.12.2013 um 06.30 Uhr |
|
But Chomsky's early view on language has been heavily criticized during recent years. First, he only focuses on grammatical rules and cares little about the meaning of language (semantics) and even less about how it is used in communication (pragmatics). A great deal of children's language learning can be explained with the aid of these factors. Secondly, Chomsky supposes that grammar is stored in the brain as a kit of rules that function in way similar to programming instructions in a computer. But it is far from certain that there is such a system of rules. Just because we can explain many aspects of human linguistic competences by using certain rules, it does not follow that these rules actually exist in the heads of the language users. Here is an analogy: a swinging pendulum moves according to Galileo's law, but this does not mean that the law in any sense is stored in the pendulum. To understand why it is not necessary to store a number of rules in the brain in order to know a language I want to go back to how termites build their hills as was described earlier. The termites only follow the principle of placing their clay balls where the smell is strongest. The physical laws of the environment then lead to the development of the complex hill. Human language may have developed in an analogous way. (Peter Gärdenfors: How homo became sapiens. Oxford 2010:185) (Vgl. hier: how_homo_became_sapiens.pdf) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.02.2014 um 12.24 Uhr |
|
Nach Dennett (The intentional stance) hat auch ein Thermostat beliefs. Er entschärft aber das zugegeben „Provokative“ dieser Ansicht gleich dadurch, daß er den „intentionalen Standpunkt“ und seine Zweckmäßigkeit definiert. Man „kann“ diesen Standpunkt einnehmen, und damit erklärt man am besten, wie ein Thermostat funktioniert. Skinner würde die Geschichte heranziehen, beides ist äquivalent. Aber Skinner ist wissenschaftlicher, seine Theorie ist anschlußfähige – nicht an Folk psychology und "Phänomenologie", sondern an Biologie usw. „Of course you don't have to describe a thermostat in these terms. You can describe it in mechanical terms, or even molecular terms. But what is theoretically interesting is that if you want to describe the set of all thermostats (cf. the set of all purchasers) you have to rise to this intentional level. Any particular purchaser can also be described at the molecular level, but what purchasers–or thermostats–all have in common is a systemic property that is captured only at a level that invokes belief-talk and desire-talk (or their less colorful but equally intentional alternatives: semantic-information-talk and goal-registration-talk, for instance).“ Mit dem „only“ hat Dennett unrecht, weil er die behavioristische Erklärung nicht erwägt. Dennett löst im Gegensatz zu Fodor und auch Davidson die beliefs von der sprachlichen Formulierung. Es bleibt nur eine Art der Angepaßtheit unter den Kontingenzen des Überlebens übrig. Dennett klammert die Geschichte aus. Durch Untersuchung des Thermostaten kann man die Zweckmäßigkeit nicht herausbekommen, ebenso bei Hirnen usw., wohl aber durch Betrachtung der Konditionierungs- oder Entstehungsgeschichte, der bei Artefakten die Planung durch einen seinerseits erklärbaren Organismus entspricht. Dennett hat soviel Gescheites geschrieben, auch über "Darwin's dangerous idea", ich verstehe nicht, warum er auf der Unentbehrlichkeit des intentionalen Standpunktes besteht. ("Skinner skinned" gehört nicht zu seinen Glanznummern.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.03.2014 um 08.48 Uhr |
|
Wolfgang Krischke bespricht recht wohlwollend in der FAZ die Übersetzung von Pinkers "Stuff of thought". Das Original ist schon sieben Jahre alt, und die dort besprochenen Beispiele („Hal loaded the wagon with hay“ und „Hal loaded hay on the wagon“), die Pinker schon hundertmal erzählt hatte, waren auch damals schon Jahrzehnte diskutiert worden. Die unterschiedlichen Konstruktionsmöglichkeiten von pour, fill usw. werden als seltsam dargestellt, weil Pinker schon falsch umschreibt: „For example, pour, fill, and load are all ways of moving something somewhere.“ Aber das stimmt gar nicht. Auch sind "devour" (mit Objekt) und "dine" (ohne Objekt) keineswegs Ausdrücke des Konzepts „essen“. (Sonst wäre "übernachten" ein Synonym von "schlafen.") Die Sache mit der Gedankensprache ist hauptsächlich von Fodor vertreten und von Leuten wie Peter Hacker in Grund und Boden kritisiert worden. Pinker verwurstet immer wieder dieselben Sachen, die er anderswo gefunden hat, und bringt sie wie große Neuigkeiten unter die Käufer und Fernsehgucker. „When I cut an apple, I first decide to do it, then send neural impulses to my arm and hand, which in turn causes the muscles to contract (usw.)“ Das ist offensichtlich nicht richtig. „Ich“ sende keine Nervenimpulse. Aber Pinker schreibt auch: „The mind has the power to frame a single situation in very different ways.“ Das ist so das Niveau. Wenn wir mit Kräften des Geistes rechnen, ist alles möglich. Aber folk psychology geht immer, das ist die Geschäftsidee dahinter. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.03.2014 um 04.30 Uhr |
|
In einer sensationell aufgemachten Meldung wird behauptet, daß Krähen Intelligenzleistungen wie fünf- bis siebenjährige Kinder vollbringen. Es geht um den "antiken" Test, Steinchen in einen mit Wasser gefüllten Glaszylinder zu werfen und dadurch ein Futterstückchen in Reichweite zu bringen. Die Krähen hätten damit "ein gewisses Verständnis für Kausalität" gezeigt. Das ist natürlich alles Unsinn, vom "Intelligenz"-Begriff bis zur Kausalität. Es heißt, die Tiere seien vorher trainiert worden, mit kleinen Gegenständen zu "hantieren". Was haben sie dabei gelernt? Das erfährt man leider nicht, wie üblich. Jeder Zirkus kann Vergleichbares vorführen. Kausalitätsverständnis zeigt ein Vogel mit jedem Schnabelhieb. Der Vergleich mit Schulkindern ist lächerlich, aber die mentalistische Einkleidung sorgt dafür, daß man in der ganzen Welt mit solchem Quark Aufsehen erregen kann. Vor einiger Zeit waren es Raben, die an einem Faden ein aufgehängtes Fleischstückchen hochziehen konnten. Für behavioristisch aufgeklärte Verhaltensforscher nichts Besonderes, aber in der richtigen Aufmachung eine Sensation. Übrigens: Den Tieren wurde nach dem Training in verschiedenen Experimenten Futter präsentiert, dass sich auf einem Korkstück gerade nicht erreichbar in einem Plexiglas-Zylinder befand, dazu eine Auswahl von Steinen und anderen Gegenständen. (Focus 26.3.14) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.04.2014 um 04.15 Uhr |
|
Ich möchte noch vor einem neuen Buch warnen, das auch von Mensch und Tier und allem möglichen handelt: Mark Galliker: Sprachpsychologie. Tübingen, Basel 2013 Das ist bloß eine unkritische Sammlung von Lesefrüchten, völlig unbrauchbar. Der Verfasser ist ein Schweizer Psychotherapeut. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.04.2014 um 04.07 Uhr |
|
Das naive Modell der "Wahl" (s. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#24443) ist heute allgemein verbreitet; ich kenne keinen Linguisten außerhalb des behavioristischen Lagers, der daran zweifelt. Aber schon Walter Porzig hat eingewandt: „Von all dem (sc. wie es beim Sprechen in uns zugeht) hat der unbefangen sprechende Mensch selbstverständlich keine Ahnung. Er braucht Wörter, die zu Sätzen gefügt sind. Beide braucht er nicht zu suchen: sie bieten sich ihm 'von selbst' dar. Und das ist gut, denn wie sollte er sie suchen? Er kennt sie ja gar nicht abgelöst von der Situation, in der er sie gebraucht. Wir sagen zwar, daß der Sprecher 'seine Worte wählt'. Aber das stimmt gar nicht. Niemand kann den Wortschatz angeben, über den er im Bedarfsfalle verfügt, und nur mit Mühe und unvollständig bringt er wenigstens die Wörter für ein bestimmtes begrenztes Sachgebiet zusammen.“ (Walter Porzig: Das Wunder der Sprache. Stuttgart 1993:166 [=1950]) Wichtig ist der Hinweis auf die Situation, den Bedarfsfall – das entspricht Skinners „Kontingenzen“. Der Organismus verhält sich unter bestimmten Bedingungen so und unter anderen Bedingungen anders. Die Wahl zwischen mehreren Wörtern kommt vor, aber das ist ein ganz spezieller Fall, und die Wörter müssen bereits gegeben sein, bevor man zwischen ihnen wählen kann. Aber wo kommen sie her? Das kann nicht seinerseits wieder durch eine Wahl erklärt werden. Wenn man neuerdings sagt, das Verhalten "emergiere", kommt man der Sache zwar näher, erklärt aber immer noch nichts. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.04.2014 um 14.28 Uhr |
|
Elke Hentschel schrieb einmal: „Ein aus zwei Nebensätzen bestehendes Subjekt scheint auf den ersten Blick eine Besonderheit des Deutschen zu sein. Nachbarsprachen wie das Englische lassen solche Konstruktionen nicht zu, sondern verlangen die formale Realisierung eines Subjekts in Form eines kataphorischen oder anaphorischen Pronomens. Cf.: Englisch: It's annoying that he didn't come and that he didn't even call, either!“ Dem stehen jedoch Beispiele wie die folgenden gegenüber: But what it is and what it does are still far from clear. (Skinner, Recent Issues 1989:22) How the ‘‘dynamics of living forms’’ differs from behavior and what distinguishes the ‘‘external realm’’ were never clarified. (Journal of Applied Behavior Analysis 2000: 267) Die Beispiele zeigen außerdem den Plural des Verbs, womit auch die weitergehende Behauptung über indogermanische Sprachen widerlegt ist, daß Nebensätze keinen Plural bilden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.07.2014 um 11.18 Uhr |
|
»Die Verteidigung beantragt, die Bestellung von Professor Norbert Nedopil als Gutachter zurückzunehmen«, sagt Mollaths Anwalt Gerhard Strate. Es stelle sich die Frage nach der Tauglichkeit von Gutachten generell. Solange Professor Nedopil als psychiatrischer Gutachter im Gerichtssaal sitze, werde Mollath nicht aussagen. Das sei nicht möglich, wenn jedes Zucken der Augenbrauen, jede Regung im Gesicht registriert werde. (SZ online 7.7.14) Zum Fall selbst kann und will ich nichts sagen, aber die Kommunikationssituation verdient wohl einen Kommentar. Bekanntlich lehnt Mollath es ab, sich dem bekannten Gutachter Nedopil »auszuliefern« (wie er schon voriges Jahr erklärt hat) und verweigert demnach das Gespräch mit ihm. Nedopil setzt sich also in den Gerichtssaal, um dort das Verhalten des Angeklagten im Wiederaufnahmeverfahren psychiatrisch zu begutachten. Ich finde, Mollath und sein Anwalt haben recht. Die rechtliche Beurteilung ist mir unbekannt, aber meiner Meinung nach ist der Auftritt vor Gericht nicht die richtige Gelegenheit für ein solches »Zwangsgutachten«. Mit welcher Begründung wird überhaupt gleich zu Beginn eines quasi neuen Verfahrens über den Angeklagten so etwas verhängt? Ich würde mich weigern, eine Vorlesung zu halten, wenn ein Psychiater im Saal säße, der mich – statt dem Inhalt zu folgen – zu begutachten versuchte. Welcher Pfarrer würde Gottesdienst samt Predigt unter solchen Bedingungen halten wollen (und was würde dabei herauskommen, falls der Psychiater ein ungläubiger Forscher ist?). Kurzum: die Doppelverwertung von Mollaths Aussagen als Prozeßbestandteil und als Testfall für die Psychiatrie ist unzumutbar. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.07.2014 um 16.23 Uhr |
|
Wie wir schon gesehen haben, ist Sprache ein mentales Phänomen und daher nicht wahrnehmbar. Wenn jemand also glaubt, einen Text zu hören oder zu lesen, irrt er sich. Auch Spracherwerb ist "nicht beobachtbar", da mental. Soweit die Kognitionswissenschaft. Was ist nun Musik? „Musik ist einer der ältesten und grundlegendsten sozialkognitiven Bereiche des Menschen.“ (Stefan Koelsch/Tom Fritz: Musik verstehen – eine neurowissenschaftliche Perspektive. In: Helmut Fink/Rainer Rosenzweig (hg.): Neuronen im Gespräch. Paderborn 2008:69-97, S. 69) Also auch mit dem Musikhören ist es nichts. So leben wir dahin, stumm und taub und vollständig gelähmt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.08.2014 um 07.27 Uhr |
|
Ein altes begriffliches Problem ist mit Self-reinforcement, "Selbstverstärkung", vulgo Selbstbelohnung verbunden. Pädagogen und Therapeuten verwenden solche Begriffe oft ohne Bedenken. Nehmen wir an, ich lerne Vokabeln in einer neuen Sprache. Immer wenn ich zehn Wörter erfolgreich gelernt habe, belohne ich mich mit einem Stückchen Schokolade. Lerne ich dann schneller als ohne Belohnung? Schließen wir zwei Schüler in ihre Zimmer ein, den einen mit Schokoldae, den anderen ohne. Welcher lernt schneller? (Warum schließen wir nicht beide ohne Schokolade ein und geben dem besseren, wenn sie beide wieder herauskommen, ein Stück Schokolade?) Damit mir die Selbstbelohnung nicht zur Gewohnheit wird und damit ich ein "autonomer" Lerner werde, mit "intrinsischer Motivation", bestrafe ich mein selbstbelohnendes und gesundheitsschädliches Verhalten, indem ich nach je zehn Schokoladenstückchen in einen Busch Brennnesseln (mit drei n) fasse; das ist schmerzhaft, aber harmlos, soll sogar gesund sein. Welche Folgen hat das für mein Vokabelpensum? Um mir das Gelingen meiner Selbsterziehung zu bestätigen, gönne ich mir nach je zehn Urtikationen ein gutes Glas Wein. Usw. Scherz beiseite: es ist ein Problem! Scharfsinnige Analyse von A. George Catania: http://www.jstor.org/stable/27758845 Das Primärverhalten und die vermeintliche Selbstverstärkung müssen gemeinsam konditioniert sein. Die ganze Aufspaltung ist aus objektiver Sicht haltlos. Beobachten wir doch ein Tier. Es gibt gar keinen Anhaltspunkt, sein Verhalten aufzuspalten in ein primäres und ein darauf gerichtetes sekundäres usw. Die Haltlosigkeit ist eine Folge der mentalistischen Redeweise. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.08.2014 um 07.25 Uhr |
|
Fortsetzung des vorigen Eine Frau will mit dem Rauchen aufhören. Sie tut jeden Abend das Geld, das sie nicht für Zigaretten ausgegeben hat, in ein Glas. So sieht sie, was sich ansammelt, und wird dadurch gestärkt, wenn sie einen schwachen Augenblick hat. Dieser wird kommen, das weiß sie, folglich verändert sie ihre Umgebung, fügt einen zusätzlichen Reiz hinzu, unter dessen Steuerung sie dann handelt. Sie meint aber, erste wenn sie diese Vorrichtung wegelassen kann, ist sie wirklich entwöhnt, weil sie dann nicht einmal den Verzicht erlebt. Die Krebsforscher wollen den Leuten helfen: "Bei einem Preis von 5,00 Euro pro Zigarettenschachtel mit 20 Zigaretten gibt ein Raucher, der ein Päckchen Zigaretten am Tag raucht, in einem Jahr mehr als 1800 Euro für das Rauchen aus. Für die gleiche Summe kann man sich beispielsweise einen zweiwöchigen all-inclusive-Urlaub in einem 4-Sterne-Hotel auf den Kanarischen Inseln leisten!" (Deutsches Krebsforschungs-Zentrum) (Das ist der letzte von 10 angegebenen Gründen, mit dem Rauchen aufzuhören. Nicht einmal erwähnt ist, daß Nichtraucher im Durchschnitt zehn Jahre länger leben. Man lebt nur einmal, warum sollte man von diesem interessanten Leben zehn Jahre wegwerfen? Jeder Raucher hofft natürlich, die große Ausnahme zu sein wie Helmut Schmidt.) Es muß schwer sein, von einer Sucht loszukommen, ich sehe überall die Menschen in meist aussichtslosen Kämpfen. Aus irgendwelchen Gründen, natürlich nicht aus Verdienst, scheine ich nicht zur Sucht zu neigen. Zwar trinke ich ganz gern ein halbes Glas Wein zum Essen, aber wie ich gerade bemerke, habe ich in den bisherigen zwei Urlaubswochen hier auf der Insel noch gar keinen Alkohol zu mir genommen, nicht einmal daran gedacht. Geraucht habe ich in meinem Leben keine ganze Zigarette, nur als Student mal probiert und es ziemlich unangenehm gefunden. Ich kann mir nicht vorstellen, daraus eine Gewohnheit zu machen, die ich nicht wieder loswerde. Es scheint eine Veranlagung zu sein. Schon Paulus und Augustinus, aber natürlich auch Platon haben darüber nachgedacht, warum man tut, was man nicht will, und nicht tut, was man will. Das unterscheidet uns von den Tieren... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.08.2014 um 08.43 Uhr |
|
Wenn jemand ankündigt, mit dem Rauchen aufhören zu wollen, schafft er schon dadurch einen zusätzlichen Anreiz, weil er der Umgebung teilweise die Steuerung überträgt. Die Adressaten überwachen ihn nun. Das Ankündigen ist der Ursprung des Wollens (s. Goethe-Zitat). Andererseits ist die Abfolge von Wollen und Tun, also Absicht und Ausführung, das Normalformat rationalen Verhaltens oder eben des Handelns, wir wir dann sagen. Die Sprachlichkeit macht das Ganze zu einer gesellschaftlichen Angelegenheit. Dieses Format projizieren wir in unser allgemeines Handlungsmodell, auch wenn wir alles nur "mit uns selbst" ausmachen. Noch zum Schokoladenmodell: Ich könnte mir ja, wenn ich eine Vokabel weiß, etwas Schönes vorstellen, wenn nicht, etwas Unangenehmes. Aber diese Selbstkonditionierung dürfte als Lernmethode nicht funktionieren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.08.2014 um 05.38 Uhr |
|
Wenn manche Psychologen sagen, das Unbewußte sei sprachlich, dann geben sie nur zu erkennen, daß sie das folkpsychologische Konstrukt des Unbewußten nach dem Muster der Sprache modelliert haben. Das muß niemanden interessieren. Das Denken als Dialog der Seele mit sich selbst (Platon usw,). Das wird durch die schon erwähnte, viel zu wenig bestaunte Tatsache gestützt, daß wir mit wörtlicher Rede (Doppelpunkt und Anführungszeichen) auch "Gedanken" wiedergeben. Natürlich kann das kein wirklicher Dialog sein, weil man ja derselbe ist und dieselben Informationen hat. Insofern ist auch ein Selbstgespräch im eigentlichen Sinn nicht möglich. Der Begriff des Selbstgesprächs sollte deshalb noch einmal ganz neu durchdacht werden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.08.2014 um 09.02 Uhr |
|
Aus meiner Kindheit ist mir eine dieser "Familienlegenden" in Erinnerung. Mein Großvater soll als junger Mann bei einer Veranstaltung Emile Coués gewesen sein. Von dort brachte er mit, daß man sich immer wieder vorsagen müsse: "Es geht mir von Tag zu Tag besser und besser." Das war bei uns dann sprichwörtlich, obwohl es niemand wirklich praktizierte. Soweit diese Autosuggestion wirksam ist, stellt sie ein ziemlich großes psychologisches und begriffliches Problem dar. Wieviel Wirkung haben wohl überhaupt unsere ständigen Selbstgespräche? Die kommerzielle psychologische Beratung vermarktet so etwas natürlich, ohne sich um die Probleme zu kümmern, neuerdings auch mit dem neurologischen Schnörkel, der das "Gehirn" beimischt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.09.2014 um 06.47 Uhr |
|
Es gibt viele Dinge, vor denen die Wortsprache nahezu versagt und eine gestische oder vormachende Kommunikation sich fast zwangsläufig einstellt. Wie bindet man Schuhe zu? Wie geht Origami? Beschreiben Sie eine Wendeltreppe, ohne die Hände zu Hilfe zu nehmen!
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.09.2014 um 06.34 Uhr |
|
Schwedische Forscher haben festgestellt, daß Hütehunde einen Algorithmus benutzen. Immer derselbe Unsinn (Planimeter-Trugschluß). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.09.2014 um 07.28 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#22359: Fast dasselbe aus dem Hause de Waal ein Jahr später: http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/fairness-warum-der-mensch-gerechtigkeit-will-a-992162.html Auch gleich mit Folgerungen über Schwarzfahrer usw. – Hauptsache, man redet drüber. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.10.2014 um 17.24 Uhr |
|
Man kann einen Hund so erziehen, daß er weniger oder gar nicht oder eben nur bei bestimmten Gelegenheiten bellt. Wir können einer Katze das Miauen abgewöhnen. Aber wir können das Bellen und Miauen an sich nicht verändern. Dessen "Topographie", wie Skinner sagt, dem ich die Beobachtung über die Katzen verdanke, ist vollkommen starr. Darum läßt sich daraus auch keine Sprache entwickeln.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.10.2014 um 12.43 Uhr |
|
Ich hatte hier die Frage aufgeworfen: "Kann" ein Mensch, der eine Aphasie erleidet, sein Sprachvermögen jedoch ohne Neulernen wiedererlangt, seine Sprache auch während des aphatischen Zustandes? Als man noch Chomskys an sich banale Unterscheidung von Kompetenz und Performanz nachsprechen mußte (immer mit diesen Fremdwörtern), gab es Leute, die die Frage bejahten. Die Kompetenz sei vorhanden, nur die Performanz gestört. Es ist zum Teil ein begriffliches, also philosophisches Problem und kein empirisches. Sprache kann bekanntlich auf verschiedene Weise gestört sein, peripher oder zentral. Auch innerhalb dieser Großbereiche gibt es noch viele Unterschiede. Wenn jemand einen Schlaganfall hat und sich die Sprachfähigkeit nach einer gewissen Zeit wiederherstellt, dann ist zwischendurch etwas vorhanden gewesen oder erhalten geblieben, woraus die Neuorganisation der Gehirnfunktionen das Sprachvermögen wiederhergestellt hat. Meine Tochter ist zur Zeit mit solchen Patienten beschäftigt. Sie bringt ihnen die Sprache nicht neu bei, sondern übt die vorhandenen Restbestände; manche wenden auch sog. Deblockierungsverfahren an usw. Aber warum sollte man jene Reste "Kompetenz" nennen? Ich weiß genau, wie Beethovens Violinkonzert gespielt werden muß, habe aber noch nie eine Violine in der Hand gehabt und warne jeden davor, mir eine zu geben. Ich selbst habe auch einmal kurze Zeit an einer Aphasie gelitten. Aus meinem Mund kamen Wörter und Pseudowörter, die ich nicht sagen wollte und auch als falsch erkannte. Es fing damit an, daß ich einen Text vorlesen wollte, aber nur die einzelnen Wörter erkannte und nicht zusammenbringen konnte. Wie ihr alle wißt, bin ich vollständig wiederhergestellt und vielleicht plaudersüchtiger als je. Habe ich zwischendurch die "Kompetenz" gehabt? Es klingt irgendwie schief. Angenommen, ich wäre nicht wiederhergestellt worden und hätte zeitlebens nie wieder sprechen können? Man hat ja schon gesagt, ein Pianist, der sich fortwährend verspielt, könnte nach Chomsky trotzdem sehr kompetent sein, nur in der Performanz bringt er es eben nicht. Das ist wohl nicht sinnvoll. Außerdem ist die Beurteilungskompetenz etwas anderes als die Ausführungskompetenz. Ein anderes Argument geht so: Wer mit der rechten Hand schreiben kann, kann es zur Not auch mit der linken und sogar mit dem Fuß. Also muß es eine übergeordnete zentrale Kompetenz geben, der verschiedene Performanzen, sogar mit völlig verschiedenen Körperteilen, gegenübersteht. Auch das ist nicht zwingend. Skinner hat das Problem behandelt, es würde hier zu weit führen. (Besagte Tochter übt gerade, "auf dem Kopf" zu schreiben, so daß die Patienten, die ihr gegenübersitzen, es als normal wahrnehmen; auch muß sie deren Hand führen können. Diese "übertragene" Fertigkeit muß geübt werden, erst dann wird sie annähernd dasselbe wie das gewohnte Schreiben.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.10.2014 um 16.16 Uhr |
|
Ein Aphatiker brachte nur einen einzigen Satz heraus, immer wieder in verschiedener Intonation: Ich geh mir dir in zwanzig Jahren. Er glaubte damit offensichtlich jeweils das Passende gesagt zu haben, ohne Bewußtsein von seinem Defizit. Ein anderer gebrauchte die Wendung Alles Gute in derselben Weise. Ein Mann, dessen Schlaganfall erst wenige Tage zurücklag, wurde (wie die meisten) im Rollstuhl hereingefahren und konnte auf Fragen mit Kopfnicken usw. antworten. Er weinte manchmal; das Personal meinte, das sei rein organisch und habe nichts zu bedeuten. Mir kam es nicht so vor. Er war mitten aus dem Leben in dieses Gefängnis geraten und wußte es. Zum Glück werden sehr viele Patienten doch nach einiger Zeit wiederhergestellt, wenigstens bis zu einem gewissen Grade. Aber viele alte Menschen oder Tumorpatienten bleiben schwere Pflegefälle. Die Arbeit in solchen Kliniken kann einen sehr mitnehmen. Querschnittslähmungen sind auch schlimm, aber der Verlust der Sprache ist schlimmer. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 05.10.2014 um 20.15 Uhr |
|
Das Beispiel mit dem Violinkonzert hinkt natürlich, weil die Kenntnisse des Zuhörers ganz andere sind als die des Musikers. Man weiß nach mehrmaligem Hören eines Musikstücks genau, welche Note als nächste kommt, aber das heißt noch lange nicht, daß man das gesamte Stück korrekt nachsummen könnte (wobei es da offensichtlich unterschiedliche Begabungen gibt), vom Spielen auf einem Instrument ganz zu schweigen. Hier ließen sich Vergleiche zum passiven Sprachvermögen anstellen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.10.2014 um 20.42 Uhr |
|
Das Beispiel könnte ich ein wenig bereinigen, denn ich hatte nicht an das Ganze gedacht; man kann ja nicht ein Orchester spielen. Also kehren wir zur Klaviersonate zurück. Ich könnte die Noten nach gründlichem Studium alle im Kopf haben, ohne sie spielen zu können. Die "Kompetenz" wäre ein Wissen ohne das Können, letzteres ist ja "Performanz". Aber das ist Unsinn, denn die Kompetenz, also Fähigkeit, ist gerade die Fähigkeit des Performierens, das Ergebnis von Übung und manchmal auch Belehrung. Bei Chomsky sind bekanntlich die Sprachregeln (nämlich die der Transformationsgrammatik oder ihrer späteren Varianten) in den Kopf des Kindes geschlüpft und werden dort angestaunt, weil ein dreijähriges Kind entwicklungspsychologisch noch gar nicht imstande sein kann, grammatische Regeln durchzuarbeiten. Daraus soll ja die Angeborenheit folgen. Daß ein Kind auch radfahren kann, ohne in diesem Alter schon Differentialrechnungen ausführen zu können (noch dazu so geschwind), wird weginterpretiert als bloße Geschicklichkeit. Nach meiner Auffassung ist Sprechen auch eine Geschicklichkeitsübung. Im Grunde ist es ein Kategorienfehler, die Kompetenz so von der Performanz zu trennen. Entweder man kann etwas, oder man kann es aus verschiedenen Gründen nicht, und diese Gründe sind zu untersuchen. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 05.10.2014 um 22.13 Uhr |
|
Das »gründliche Studium« gehört nicht hierher. Durch das bloße wiederholte Zuhören erwirbt man sich unwillkürlich Kenntnisse von einem Musikstück, selbst wenn man gar nicht die Absicht hat, sie irgendwie »performativ« zu nutzen. Insofern es aber eine Kenntnis ist, die nichts mit Nachdenken zu tun hat, ähnelt sie der Fähigkeit des Musikers zu spielen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.10.2014 um 16.43 Uhr |
|
„Typische Beispiele für die Evolution von Lebewesen beziehen sich auf körperliche Merkmale. Ein Gen, das eine Gazelle schneller laufen lässt, wird die Überlebenschancen des Tiers steigen lassen, da die Gazelle Verfolgern besser entkommen kann. Folglich ist es wahrscheinlich, dass sich das entsprechende Gen innerhalb der Gazellenpopulation allmählich durchsetzt und zu einem allgemeinen Merkmal von Gazellen wird. Nicht anders sieht es nach Ansicht von Evolutionspsychologen in Bezug auf geistige Merkmale aus: Es ist unmittelbar einsichtig, dass etwa Gedächtnis-, Wahrnehmungs-, Problemlöse- oder Lernleistungen die Überlebenschancen von Individuen beeinflussen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich auch vorteilhafte geistige Merkmale innerhalb einer Population durchsetzen und somit die Struktur des Geistes ein Produkt der evolutionären Anpassung ist." „Es ist innerhalb der Wissenschaften unumstritten, dass auch die Psyche des Menschen eine Folge von Evolutionsprozessen ist.“ (Wikipedia Evolutionäre Psychologie) Wie kann das sein? Die Psyche oder Geist müßte ja Umgebungsbedingungen ausgesetzt sein, damit er unter Selektionsdruck gelangt und eine Evolution durchmacht. Das kann aber nur das Verhalten, nicht irgend ein "Geist". Wir bilden uns ein Konstrukt Geist/Seele, um komplexes Verhalten zu erklären und vorhersehbar zu machen, aber dieses Konstrukt kann, da es kein reales Objekt ist, keine Evolution durchmachen. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 06.10.2014 um 19.27 Uhr |
|
Eine kontinuierlche Weiterentwicklung des menschlichen Geistes gab es nicht, weil sie von der Gewährung von Gedankenfreiheit abhängig ist. Die Gedankenfreiheit wurde aber im Lauf der Geschichte immer wieder verboten und ist es in Diktaturen auch heute. Dann erfolgt vielmehr eine geistige Rückentwicklung, weil sie erfolgreicher ist.
|
Kommentar von Pt, verfaßt am 06.10.2014 um 20.48 Uhr |
|
@ Germanist: 1. Die Gedanken sind frei wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei: Die Gedanken sind frei! 2. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Still’ und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei! . . . Ich würde eher denken, daß sich der menschliche Geist gerade in Zeiten von Unfreiheit weiterentwickelt und die Unfreiheit abzustreifen versucht. Die geistige Rückentwicklung findet eher in Zeiten wie der unseren statt, in denen es den Menschen zu gut geht, zumindest den meisten. Zeiten, in denen uns alles ''vereinfacht'' wird, und wir (noch) nicht merken, daß es wieder Richtung Unfreiheit geht. Wenn es dann die meisten merken, ist es zu spät. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.10.2014 um 11.31 Uhr |
|
„Die Deutung eines Zeichens geschieht in seiner Übersetzung in andere Zeichen. Seine Bedeutung ergibt sich aus seinen Übersetzungen.“ (Elmar Holenstein in ders., Hg.: Roman Jakobson: Semiotik. Frankfurt 1992:11) Wieso sollte die Übersetzung eine Deutung sein? Wie Skinner sagt, bedeuten Original und Übersetzung bestenfalls dasselbe oder haben dieselbe Bedeutung, aber das eine ist nicht die Bedeutung des anderen. Allenfalls erkennt man an der Übersetzung, ob jemand die Bedeutung verstanden hat. Die mentalistische Auffassung läuft darauf hinaus, eine „Sprache des Geistes“ anzunehmen, und wenn etwas in dieser Sprache formuliert ist, dann ist es per definitionem „verstanden“. Naturalistisch gesehen, ist die Aussage „Fliegenpilze sind giftig“ dann verstanden, wenn der Hörer z. B. keine Fliegenpilze ißt (und manches andere). „(Die behavioristische Bewegung) hatte außer acht gelassen, daß es keine Handlung ohne Zielvorstellung gibt, keine komplexe Handlung ohne Plan und so auch keine Pragmatik ohne kognitive Wissenschaft.“ (Ebd. 14) Der Behaviorismus läßt das nicht außer acht, sondern lehnt diese Begrifflichkeit ab. Er untersucht nicht Handlungen, sondern Verhalten, und zwar als natürliches Geschehen ohne Ziel und Plan. Holenstein gerät in den unendlichen Regreß, denn wer macht den Plan, die Zielvorstellung usw. - das sind ja auch wieder erklärungsbedürftige Verhaltensweisen. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 07.10.2014 um 12.39 Uhr |
|
Das Fließend-Lesen-Können anderer Alphabetschriften beruht doch gerade darauf, diese Zeichen direkt in Lautwerte umsetzen zu können ohne den Umweg über das Latein-Alphabet.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.10.2014 um 15.31 Uhr |
|
"... when a child learns the properties of an object in its environment (e.g., a chair), it may also learn that a word (i.e., “chair”) can come to represent that object. When this happens, typically, the word becomes symbolically substitutable for that object. For example, one can now tell the child, “Put the ball on the chair,” and the command will be understood. (...) The conceptual interchangeability of objects and the symbols or words that represent them suggest that the two have become commonly represented or that they are functionally equivalent. Animals may be capable of a similar form of symbolic representation even though they do not have natural language." Ich verstehe das nicht. Ein Ball und das Wort "Ball" sind in keiner Hinsicht durch einander ersetzbar und füreinander substituierbar. Was man mit einem Ball machen kann, ist nicht im entferntesten das, was man mit dem Wort "Ball" machen kann. Also was soll das Ganze heißen? Aber so reden die Leute im allgemeinen daher, immer noch die von Swift karikierte Zeichenvorstellung. Hierzu auch die "Repräsentationen". Selbst wenn es im Kopf solche Repräsentationen gäbe - was würden sie denn nutzen? Eine Einverleibung der Welt, in welcher symbolischen Brechung auch immer, würde doch gar nichts erklären. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.10.2014 um 03.46 Uhr |
|
"Jemand kann eine Überzeugung oder einen Wunsch haben, auch wenn er nicht daran denkt, und man kann ihm solche Zustände auch dann zu Recht zuschreiben, wenn er schläft." (John Searle: Intentionalität. Frankfurt 1983:68) Glaubt jemand auch im Schlaf an Gott? Die Allgemeinsprache, in der man solche mentalistischen Prädikate gebraucht, hat für diese und ähnliche Fragen einfach nichts vorgesehen, und eine empirische Frage ist es auch nicht. Ein ähnlicher Fall: "Platon war der Lehrer Alexanders des Großen." Hat jemand, der so etwas sagt und Falsches "über" Platon sagt, eigentlich Wahres "über" Aristoteles gesagt? Unsere Sprache hat den Gebrauch von "über" nicht so weitgehend geregelt, daß dies sich entscheiden ließe. Man darf sie nicht überstrapazieren, wie es die Philosophen fortwährend tun. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.11.2014 um 14.05 Uhr |
|
Der Skinner-Schüler und -Vertraute Robert Epstein erzählt eine hübsche Anekdote, die ich nicht für mich behalten kann: Skinner, who apparently did not have the good sense to look away at the right moment, fainted at my younger son’s circumcision ceremony. After the procedure was complete, the rabbi who had done the cutting surprised the assembled group with a lengthy sermon about how my wife and I were supposed to raise our new son ‘‘in programmed steps using positive reinforcement.’’ Skinner, seated on a nearby sofa and conscious but still weak at this point, nodded repeatedly in agreement, undoubtedly thinking he had died and gone to Heaven. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.12.2014 um 06.18 Uhr |
|
Von den Krähen wird schon wieder Fabelhaftes berichtet, abstrakte Denkleistungen, die sogar Menschen Schwierigkeiten machen würden usw. Vorzügliche Pressearbeit. Es sind immer dieselben Forscher, die seit Jahrzehnten ihre Versuche mit Krähen machen (Sortieraufgaben mit sehr wenigen Tieren) und die Ergebnisse dann in Begriffen wie "Abstraktion", "Intelligenz" usw. darbieten. Skinners Tauben haben das auch schon gemacht, die kognitivistische Ausdrucksweise verdunkelt eher.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.01.2015 um 04.56 Uhr |
|
Ich hatte zitiert: "Musik ist einer der ältesten und grundlegendsten sozialkognitiven Bereiche des Menschen." Das muß ich aber noch übersetzen, also: "Musik ist ein sehr altes menschliches Verhalten." Stanislas Dehaene spricht in seinem lesenswerten Buch "Der Zahlensinn" oft vom Gehirn, wo er vom Menschen sprechen sollte. Gehirn ist nie ganz falsch, weil das Gehirn sicherlich das Verhalten steuert, aber wenn man nicht weiß, wie es geschieht, dann ist die Redeweise irreführend und eine ungewollte Hochstapelei. Ebenso die Rede von „mentalen Repräsentationen“: „In diesem Kapitel untersuchen wir einige Rechenalgorithmen des menschlichen Gehirns.“ (139) – Das stimmt dann aber gar nicht. Das Mentale kann nicht unter Selektionsdruck kommen und sich daher nicht „entwickeln“ im Sinne der Evolutionstheorie, da es ja nicht den seligierenden Umweltbedingungen ausgesetzt ist. Christoph Bördlein hat einmal treffend gesagt: „Man fragt sich, welchen adaptiven Wert die zahlreichen ‚kognitiven Prozesse‘ haben sollen, die von den Kognitivisten angenommen werden. Das operante Konditionieren passt sehr gut zur biologischen Evolution (und ist gewissermaßen eine Fortsetzung der Evolution auf der Ebene des Individuums).“ |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.04.2015 um 06.23 Uhr |
|
John Searle: So I wrote a couple of books about that, and in the course of that work I discovered that there was this new science that I would become a part of, "cognitive science." That was great, because cognitive science was overcoming "behaviorism," which had been the orthodoxy in psychology. Reason: What do you mean by behaviorism? Searle: Behaviorism was the idea that when you do a scientific study of the mind, you don't actually try to get inside the brain and figure out what's going on, you just study overt behavior. Reason: Inputs and outputs? Searle: Inputs and outputs. And the science of psychology on the behaviorist model was you were going to correlate these stimulus inputs with the behavioral outputs. It's a ridiculous conception of the mind – the idea is that there's nothing going on in there, except you have the stimulus input and the behavioral output. Mit dieser Karikatur von Behaviorismus kommt ein Philosoph durchs ganze Leben. Der allgemeine Beifall enthebt der Mühe, sich besser zu informieren. Solche Fälle gibt es oft. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.08.2015 um 06.26 Uhr |
|
Zu #22424: In demselben Buch heißt es zum Spracherwerb nach Chomskyscher Art: Woher kommen diese universellen Sprachmerkmale ('linguistische Universalien')? Es weist immer mehr darauf hin, daß sie auf einer spezifischen Sprachveranlagung beruhen. Sie steuert das Kind von Anfang an in eine bestimmte Richtung beim Formulieren von Hypothesen über Regeln der Grammatik. (Ton Dijkstra/Gerard Kempen: Einführung in die Psycholinguistik. Bern u. a.1993:99) Die Verfasser scheinen nicht zu bemerken, daß das Formulieren von Hypothesen bereits eine Sprache voraussetzt. Aber so ähnlich steht es in ungezählten Büchern, und unsere Studenten sprechen es nach. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.08.2015 um 06.27 Uhr |
|
"Pro Sekunde werden etwa 10 Phoneme gesprochen (...), d. h. pro Sekunde müssen allein auf der Phonem-Ebene 10 Entscheidungen gefällt werden." (Hans Hörmann) Die Phoneme kann man noch in unterscheidende Merkmale zerlegen, dann sind es noch viel mehr Entscheidungen. Die Wörter müssen auch gewählt werden usw. Typischer "Planimeter-Trugschluß". Ebenso: Bienen sind verdammt gescheit. Sie lernen ungeheuer schnell. Und sie sind zuverlässig. Sie sind eigentlich die idealen Versuchstiere für eine Dressur. Einmal habe ich drei Wochen lang mit einer einzigen Biene gearbeitet. In der Zeit hat sie etwa 25.000 Entscheidungen getroffen. (Randolf Menzel, www.zeit.de) Der mentalistische Begriff "Entscheidung" hat in einer naturalistischen Wissenschaft nichts zu suchen. Das Wasser, das den Berg herunterplätschert, entscheidet sich millionenmal, doch lieber der Schwerkraft zu folgen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.09.2015 um 18.33 Uhr |
|
Wenn die Bienen eine vernünftige Sprache hätten, würden nicht Tausende von ihnen dieselbe Blüte anfliegen (wie ich es bei unserem Indischen Springkraut beobachte), sondern sich das Revier aufteilen wie die Bezirksschornsteinfeger und dann ordentlich abkassieren.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.09.2015 um 17.57 Uhr |
|
Die Fehlerkunde, insbesondere die Versprecherforschung, liefert eine Menge Material, aber das nützt alles nichts, wenn man nicht das richtige Modell hat. Herkömmlicherweise wird angenommen, daß am Anfang der "Sprachproduktion" der Inhalt der Äußerung steht, auch Intention genannt (ich habe eine Menge Beispiele dieser Auffassung angeführt). Wenn dies nun aber falsch ist, sogar sinnlos, dann lassen sich die Versprecherarten usw. auch nicht sinnvoll in den Entstehungsprozeß einordnen, im Gegenteil, die Daten führen immer weiter von der Wahrheit weg.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.10.2015 um 17.44 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#20118 Es ist kein Ruhmesblatt, daß sich Dieter E. Zimmer stets in genau derselben irrigen Weise über Skinner geäußert hat: „Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts regierte die Psychologie zumnidest in Amerika noch der Behaviorismus, für den das Gehirn eine Art leerer Allzweckapparat war, ein amorpher Brägenklops, bei Geburt eine Tabula rasa (ein Begriff aus der Philosophie von John Locke), eine leere Tafel, die erst von der Erfahrung beschrieben wird.“ (Dieter E. Zimmer: Sprache in Zeiten ihrer Unverbesserlichkeit. Hamburg 2005:300) „Der Behaviorismus wollte alles Verhalten aus dem Lernen erklären und alles Lernen, auch das sprachliche, aus dem Mechanismus von stimulus und response, Reiz und Reaktion.“ (ebd. 302) Irgend jemand hat ihm doch einmal sagen müssen, daß er falsch liegt, und dann hätte er doch mal in die Originaltexte gucken müssen, sollte man meinen. Aber diese Art von Apperzeptionsverweigerung ist gar nicht selten. Ich kann mich übrigens auf Anhieb an keine Stelle erinnern, an der Skinner sich mehr als beiläufig über das Gehirn äußert. Am einschlägigsten ist noch dies: "Cognitive psychologists have therefore turned to brain science and computer science to confirm their theories. Brain science, they say, will eventually tell us what cognitive processes really are. They will answer, once and for all, the old questions about monism, dualism, and interactionism. By building machines that do what people do, computer science will demonstrate how the mind works. What is wrong with all this is not what philosophers, psychologists, brain scientists, and computer scientists have found or will find; the error is the direction in which they are looking. No account of what is happening inside the human body, no matter how complete, will explain the origins of human behaviour. What happens inside the body is not a beginning. By looking at how a clock is built, we can explain why it keeps good time, but not why keeping time is important, or how the clock came to be built that way. We must ask the same questions about a person. Why do people do what they do, and why do the bodies that do it have the structures they have? We can trace a small part of human behaviour, and a much larger part of the behaviour of other species, to natural selection and the evolution of the species, but the greater part of human behaviour must be traced to contingencies of reinforcement, especially to the very complex social contingencies we call cultures. Only when we take those histories into account can we explain why people behave as they do. That position is sometimes characterised as treating a person as a black box and ignoring its contents. Behaviour analysts would study the invention and uses of clocks without asking how clocks are built. But nothing is being ignored. Behaviour analysts leave what is inside the black box to those who have the instruments and methods needed to study it properly. There are two unavoidable gaps in any behavioural account: one between the stimulating action of the environment and the response of the organism, and one between consequences and the resulting change in behaviour. Only brain science can fill those gaps. In doing so it completes the account; it does not give a different account of the same thing. Human behaviour will eventually be explained, because it can only be explained by the cooperative action of ethology, brain science, and behaviour analysis." (Recent Issues in the Analysis of Behavior. 1989) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.10.2015 um 02.30 Uhr |
|
Noch ein Beispiel für Zimmers Naivität, aus demselben Buch: „Die geringste Introspektion hätte Watson und auch den späteren Behavioristen klar gemacht, dass sie mit ihrer Sprachpsychologie völlig danebenlagen.“ (223) Aber die Behavioristen haben gerade die Brauchbarkeit der sogenannten Introspektion als Quelle psychologischer Erkenntnis angezweifelt, das war sozusagen ihr Lebensthema. Zimmer arbeitet hier mit einer Petitio principii. Man könnte ebensogut sagen: Die Atheisten brauchten bloß in der Bibel zu lesen, dann wüßten sie, daß Gott existiert. Zimmer spricht auch gern davon, daß das Gehirn die Wörter und das „Begriffsrepertoire“ speichere. „Wer seinen anfänglichen introspektiven Schwindel überwindet und genauer in sich hineinhört, kommt mühelos darauf, dass die behavioristische Gleichung 'Sprechen gleich Denken gleich Sprechen' gar nicht richtig sein kann, dass die Identitätshypothese falsch sein muss. Jemand geht auf eine niedrige Tür zu. Was tut er, um sich nicht den Kopf zu stoßen? Er vergleicht den Ablick vor seinen Augen mit etwas Abstrakterem, der Vorstellung seiner eigenen Körpergröße (die er in diesem Moment nicht vor den Augen hat), zieht einen Schluss daraus und erteilt seinen Muskeln einen Befehl: Er bückt sich.“ (224f.) Man beachte zunächst wieder die Rhetorik: „mühelos“ erkennt man, daß der Behaviorismus falsch sein muß. Zimmer glaubt in sich hineinhören und -sehen zu können. Daß es dafür keine Sinnesorgane gibt, stört ihn nicht. Der Mensch soll seinen Muskeln einen Befehl erteilen - ist das mehr als eine nutzlose Metapher? Wer ist denn der Befehlende hier, und welchen Teilen seines Körpers steht er gegenüber? Dieses „Befehlen“ ist so metaphorisch wie das Hineinhören usw. - Wie verhalten sich Tiere, wenn sie Hindernissen ausweichen? Können diese Anpassungen und Regelungen nicht auch ohne „Schlüsse“ erklärt werden? Welche Schlüsse liegen anderem geschickten Verhalten zugrunde, z. B. dem Fangen eines Balls? (Der Planimeter-Trugschluß, wie anderswo dargelegt.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.11.2015 um 06.38 Uhr |
|
Was jeder Hund kann, ist dem kleinen Kind, das gerade seine ersten beiden Zähnchen bekommen hat, noch nicht gegeben: im Spiel mit halber Kraft zubeißen. Aber das lernt sich bald. Dadurch wird aus dem Beißen eine Verstellungsspiel. Man könnte das in die Diktion der „Theory of Mind“ kleiden, aber das wäre überflüssig und damit hinderlich für eine wissenschaftliche Entwicklungspsychologie. Die Beobachtungen zum frühen Verstellungsspiel machen auch die Arbeiten über „false belief“ hinfällig. Zur Kritik s. auch Bloom/German: „Two reasons to abandon the false belief task as a test of theory of mind“. Cognition, 77, B25–B32. (www.yale.edu/minddevlab/papers/false.belief.pdf ) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.11.2015 um 11.29 Uhr |
|
Wenn jemand stolpert, dreht er sich manchmal im Weitergehen noch einmal um und wirft dem Stein, über den er gestolpert ist, einen wütenden Blick zu. Manche Leute versetzen auch dem Stuhlbein noch einen Tritt. – Das ist natürlich alles sehr unvernünftig. In unserem Kulturkreis schreiben wir aber Ungeschicklichkeiten normalerweise uns selbst zu. Anderswo haben Ethnopsychologen gefunden, daß sofort ein Fall von Hexerei vermutet wird. Jemand muß den Stein verhext haben, so daß er mich zu Fall gebracht hat. Es gibt auch keinen Zufall. Der Gedanke einer "inneren" Motivation des Handelns ist dann gar nicht faßbar, weil das gesellschaftlich anerkannte und in die Kinder hineingeredete Modell völlig anders ist, vor allem also die Redeweise. Dazu fällt einem wieder Homer ein, bei dem die Helden nach Bruno Snell keine innere Motivation haben, was allerdings von anderen bestritten wird. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.11.2015 um 12.56 Uhr |
|
„Von einem bewegten Lüftchen hangt alles ab, was Menschen je auf der Erde Menschliches dachten, wollten, taten und tun werden.“ (Johann Gottfried Herder: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, IX, 2) Untersucht man das bewegte Lüftchen (den flatus vocis), so erkennt man die Struktur oder "Topographie" (Skinner) des Sprachverhaltens. Die Wirkung bleibt unerklärlich. Erst wenn man die Konditionierungsgeschichte kennt, verliert sich der Schein des Übernatürlichen. Die geheimnisvolle "Rückseite" des sprachlichen Zeichens, das "Signifié", verschwindet. Sieht man, wie zwei Tauben Pingpong spielen (https://www.youtube.com/watch?v=vGazyH6fQQ4), könnte man auf allerlei Gedanken kommen: was "kognitiv" in den Tauben abläuft, welche "Bedeutung" das Spiel für sie hat usw. Das löst sich alles auf, sobald man die Konditionierungsgeschichte heranzieht, das "Shaping" also, zu dessen Illustration die Versuche vorgeführt werden. Wer einen Hund oder ein Pferd hat, weiß ohnehin, wie es gemacht wird. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 26.12.2015 um 23.34 Uhr |
|
Nochmal zum kindlichen Denken. Unser ältester Sohn (#22293) hat uns ja nun seinerseits mit einer Enkelin beglückt, und wir erleben gerade wieder die Freuden des Sprechenlernens. Sie ist 2 1/4 und geht jetzt in den Kindergarten. (Das schöne Wort, um das uns andere Völker beneiden, ist leider heutzutage bei uns schon fast der Kita zum Opfer gefallen.) Na jedenfalls muß dort kürzlich der Sankt Martinstag ein unvergeßliches Erlebnis für sie gewesen sein. Seitdem nennt sie nämlich ihren Onkel (unseren zweiten Sohn Martin) immer wieder Sang Martin.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.01.2016 um 06.41 Uhr |
|
Zu den Rennern des Nativismus nach Chomsky gehörte einige Zeit (für manche noch heute) die vermeintliche Tatsache, daß man mice-eater, aber nur rat-eater bilde, d. h. daß der Plural als Erstglied nur möglich ist, wenn er unregelmäßig ist. Das könne eine Kind nur wissen, wenn es angeboren sei. So stellt es noch George A. Miller in "Wörter" dar, ebenso natürlich Pinker. Die Ausgangslage ist empirisch unzutreffend, aber darauf will ich nicht eingehen, es gibt genug Literatur dazu. Ich möchte nur auf die extreme Unwahrscheinlichkeit der Angeborenheitsthese hinweisen. Kann eine Einzelheit der englischen Wortbildung ins Erbgut der Menschheit Eingang gefunden haben? Aber wir haben hier wieder den grundlegenden Unterschied: Die Generativisten sagen: Das ist so kompliziert, das kann nicht gelernt werden, muß also angeboren sein. Die Empiristen sagen: Das ist so kompliziert, das kann nicht angeboren sein, sondern muß gelernt werden. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 16.01.2016 um 10.16 Uhr |
|
»Die Generativisten sagen: Das ist so kompliziert, das kann nicht gelernt werden, muß also angeboren sein.« Die Kreationisten sagen: Das ist so kompliziert, das kann nicht entstanden sein, muß also geschaffen sein. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.01.2016 um 13.24 Uhr |
|
Genau! Und das Paradebeispiel ist das Auge, das doch wohl nicht durch Zufall entstanden sein kann. Ein unglückliches Beispiel, weil gerade die Evolution des Auges (das rund 40mal im Tierreich entstanden sein soll) ziemlich lückenlos aufgeklärt ist, Dawkins hat es schön dargestellt. Rhetorisch wirksam ist auch die Frage, ob eine Taschenuhr durch Zufall entstanden sein könnte. Neuerdings ist sie durch eine Boeing 747 abgelöst worden. Dazu die schon erwähnte Scherzmeldung: Eine Fabrik in Texas war so heruntergekommen, daß ein Hurrikan Verbesserungen im Wert von 10 Mill. Dollar anrichtete. Wobei die Kollokation von Verb und Objekt auch das Linguistenzwerchfell erfreut.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.01.2016 um 05.46 Uhr |
|
„Indem wir nichts weiter tun, als mit dem Mund Geräusche zu erzeugen, können wir im Gehirn anderer Personen neue und präzise Gedankenkombinationen erzeugen.“ (Steven Pinker: Der Sprachinstinkt. München 1996:17) Eine Kategorienverwechslung. Im Gehirn gibt es keine "Gedanken". Ist das wirklich so schwer zu begreifen? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.02.2016 um 10.20 Uhr |
|
Lytton Strachey erzählt folgende Anekdote über Queen Victoria: When, in wrath, the Prince one day had locked himself into his room, Victoria, no less furious, knocked on the door to be admitted. “Who is there?” he asked. “The Queen of England” was the answer. He did not move, and again there was a hail of knocks. The question and the answer were repeated many times; but at last there was a pause, and then a gentler knocking. “Who is there?” came once more the relentless question. But this time the reply was different. “Your wife, Albert.” And the door was immediately opened. Der Behaviorist Henry Schlinger gibt noch etwas ausgeschmücktere Varianten und analysiert die Szene in Verhaltensbegriffen: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885405/ |
Kommentar von R. M., verfaßt am 09.02.2016 um 11.33 Uhr |
|
'Your wife, Albert.' = Mrs Albert of Saxe-Coburg and Gotha.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.02.2016 um 08.51 Uhr |
|
Was ist einfach? Säuglinge schwenken einen Gegenstand unermüdlich hin und her, lallen gogogogo, ebenso perseverieren Aphatiker. Wir kommen zu dem Schluß, daß Wiederholung einfacher ist als einmaliges Verhalten. Die generative Simulation würde das Verhalten erzeugen und dazu einen Befehl REPEAT, aber das wäre unangemessen. Es kommt auf STOP an. Die Psychologie weiß das übrigens seit 100 Jahren. Kleinkinder patschen die Hände in der Mitte (sagittal) zusammen, müssen erst lernen, sie zu entkoppeln und mit einer einzigen Hand zu greifen usw. (Aufs "Denken" übertragen!) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.02.2016 um 05.33 Uhr |
|
Zu den klassischen Tests für die Schulreife gehörte das Zubinden eines Schnürschuhs. Das sollten Sechsjährige können. Ich weiß nicht, ob das noch gemacht wird, könnte mir aber denken, daß das Aufkommen des Klettverschlusses diese Fertigkeit in Vergessenheit gebracht hat. Das Schnüren eines Schuhs ist gar nicht so einfach, aber interessant als Muster eines komplexen Verhaltens: Erworbene Routine wirkt zusammen mit akuten Anpassungen unter taktilen Wahrnehmungen und Rückkoppelungen. Man kann das dann ohne Hinsehen, wie man ja auch den Schlips am besten nicht vor dem Spiegel bindet, sondern blind. Das Sprechen funktioniert ähnlich. Die vollendete Anpassung an die Situation nennen wir dann die "Bedeutung" der Rede, die also nicht am Anfang steht, sondern am Ende. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.03.2016 um 19.02 Uhr |
|
Unter einem Erziehungsziel wird eine Norm verstanden, die eine für Educanden als Ideal gesetzte psychische Disposition (oder ein Dispositionsgefüge) beschreibt und vom Erzieher fordert, er solle so handeln, daß der Educand befähigt wird, dieses Ideal so weit wie möglich zu verwirklichen. (Wolfgang Brezinka: „Was sind Erziehungsziele?“ In: Zeitschrift für Pädagogik 1972:497‒550, S. 550 ) Warum nicht ein Verhalten? Was sind psychische Dispositionen? Wie mißt man sie? Der mentalistische Schnörkel verdirbt alles. (Der Text gilt fast als Klassiker der Pädagogik, der Verfasser ist keineswegs als Schwätzer bekannt. Vielleicht mußten ja Erziehungsziele wirklich mal definiert werden...) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.03.2016 um 09.37 Uhr |
|
Heute wollte ich nach Schriften von Geoffrey Sampson fahnden und schrieb ins Suchfeld: "Deutscher". Nein, ich bin noch nicht dement, sondern die Sache erklärt sich so: Mir war kurz zuvor durch den Kopf gegangen, daß Sampson einen Aufsatz über Gladstone verfaßt und sich darin kritisch zu Guy Deutscher geäußert hat (über die vermeintliche Farbenblindheit der Griechen). Also eine "semantische Paragraphie". Vielleicht kennen Sie ähnliche Erlebnisse, wir schreiben sie nur meistens nicht auf. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.03.2016 um 05.59 Uhr |
|
„Die Anerkennung auch der Symptome als semiotischer Vorgänge bedeutet keineswegs eine Entkonventionalisierung der Semiotik, so dass man sie als Sprache Gottes oder des Seins betrachten könnte. Sie bedeutet nur eine Feststellung von Interpretationskonventionen auch in der Art und Weise, wie wir versuchen, Naturphänomene zu entziffern, als ob diese Zeichen wären, die etwas mitteilen. Die Kultur hat nämlich einige Phänomene selektioniert und als Zeichen aufgestellt, weil diese in der Tat unter geeigneten Umständen etwas mitteilen.“ (Umberto Eco: Einführung in die Semiotik. München 1972:30) (Übers. Jürgen Trabant) Symptome sind zwar das Urbild aller Zeichen (im Sinne von Anzeichen in der antiken Medizin), aber in einer wissenschaftlich ernstzunehmenden Semiotik sind sie keine Zeichen. Zur Erläuterung setze ich einen überarbeiteten Teil meines Aufsatzes "Wirkliche Zeichen" hierher: 1. Der Begriff des Zeichens Rudi Keller (Zeichentheorie. Tübingen, Basel 1995) weist mit Recht die metaphorische Redeweise von der Kommunikation als Transport und vom Zeichen als Behälter zurück. Seine eigene Auffassung schöpft aus mehreren Theorien. Durchgehend findet sich der Gedanke, Kommunizieren sei auf der Seite des Rezipienten ein Vollziehen von logischen Schlüssen und auf der Sprecherseite ein Versuch, „den Adressaten zu bestimmten Schlüssen zu bewegen.“ Zeichen dienen dabei als „Prämissen für interpretierendes Schließen“. Es ist also zu fragen, was unter solchem Schließen zu verstehen ist und ob die Rede vom „Schließen“, ebenso wie der Begriff „Prämisse“, mehr als eine Metapher ist. Denn die Richtigkeit der inferentiellen Auffassung von Zeichen und Kommunikation liegt gewiß nicht auf der Hand. Erstens bin ich mir beim Sprechen nur selten oder gar nicht einer Absicht bewußt, meinen Partner zu irgendwelchen Schlüssen zu bewegen, ganz abgesehen davon, daß die Menschen den weitaus größten Teil ihrer Geschichte hindurch miteinander gesprochen haben, ohne eine Ahnung von Schlüssen oder anderen „mentalen Phänomenen“ zu haben. Und Entsprechendes gilt für mich als Zuhörer: Mir ist normalerweise nicht bewußt, daß ich beim Zeichenverstehen Schlüsse ziehe. Das ist vielleicht kein Beweis, aber wenn man mit „unbewußten“ Schlüssen rechnet, muß man sich über die bekannten überaus problematischen Konsequenzen einer solchen Annahme im klaren sein. Zweitens ist es eine ungewohnte Vorstellung, daß Zeichen, also „Dinge (im weitesten Sinne)“ (ebd.), als „Prämissen“ fungieren sollen. Das kann nicht wörtlich gemeint sein. Prämissen im wörtlichen Sinne sind immer Sätze. Beide Vorstellungen hängen wahrscheinlich mit einer dritten zusammen, einer allgemeinen Sicht der Kommunikation, die zwischen die Reaktionen der einen und die der anderen Seite eine „mentale“ Ebene einschaltet, auf der sich ein mehr oder weniger logisches Räsonnieren, teilweise auch nur ein „Ratespiel“ (12;145) vollzieht. Der Sprecher beabsichtige, dem Hörer durch Zeichen zu ermöglichen, die Absichten und Gedanken des Sprechers zu erraten, und ihn dadurch zu gewissen Handlungen zu veranlassen. Diese Denkfigur könnte man den „Grice-Komplex“ nennen. Keller ist offensichtlich stark von Grice beeinflußt und erwähnt ihn oft. Dieser Hintergrund wirft die Frage nach der Rolle der „Intentionalität“ für die Zeichentheorie auf. Bekanntlich scheiden sich hier die Geister am deutlichsten, da die naturalistischen Zeichentheorien, vor allem die radikal-behavioristische, gerade ohne Intentionalität auszukommen versuchen, während dieser Begriff für mentalistische Theorien zentral ist. Das Eigenartige an Kellers Theorie ist, daß sie auf einer Gebrauchstheorie des Zeichens bzw. der Bedeutung beruht („Die Bedeutung eines sprachlichen Zeichens ist sein Gebrauch.“ 1995:152) und dennoch intentionalistisch-mentalistisch argumentiert. Hierzu paßt auch, daß Keller die Bedeutung ausdrücklich auf einer linguistischen und nicht auf einer epistemologischen oder ontologischen Ebene ansiedeln möchte und dennoch fortwährend über mentale Prozesse wie eben das Schließen spricht. Problematisch ist auch die Rolle, die in einem solchen Modell den Tieren zuzuweisen wäre. Zwar zieht Keller sie häufig zu Illustrationszwecken heran, aber es bleibt unklar, ob Tiere ebenfalls „Schlüsse“ vollziehen, ob also, anders gesagt, Tierkommunikation überhaupt unter die Definition von Kommunikation fällt. Immerhin scheint es nach Kellers Ansicht Tierkommunikation zu geben, denn er erwähnt sie (170), ohne sich von dem Begriff erkennbar zu distanzieren. Die Möglichkeit eines Flüchtigkeitsfehlers ist aber nicht ganz auszuschließen, weil jede weitere Erörterung tierischen Schlußverhaltens fehlt. Das Problem wird im Zusammenhang mit der Frage nach der Sprachlichkeit des Schließens virulent. Keller kritisiert mit Recht die Saussuresche Darstellung des Verhältnisses von Ausdruck und Bedeutung, die den relationalen Charakter beider Begriffe verkennt (108). Seine eigene Auffassung drückt er mit Hilfe des Begriffs „Aspekt“ aus, der allerdings mit dem Begriff der „Eigenschaft“ in verwirrender Weise abwechselt. Zeichen sind „sinnlich wahrnehmbare Dinge, Sachverhalte, Handlungen oder Ereignisse, die für interpretierbar gehalten werden.“ (108f.) Wie wir später sehen werden, ist diese etwas umständliche Redeweise („für interpretierbar gehalten werden“ statt „interpretierbar sein“) berechtigt, obwohl Keller weiter keinen Gebrauch davon macht. Wenn wir sie ernst nehmen, gewinnen wir die Möglichkeit, ein Phänomen unseren Interpretationsbemühungen zu unterwerfen, bevor wir sicher wissen, daß es überhaupt ein Zeichen ist. Wir entgehen damit zugleich einer sophistischen Falle, denn von manchen Zeichen wird gesagt werden, sie würden erst durch ihre Interpretation zu Zeichen: Wie kann man aber etwas interpretieren, was noch kein Zeichen ist? Ein solches Phänomen nenne ich „Zeichenkandidaten“. Ein Zeichenkandidat erweckt den Eindruck, ein Zeichen und damit interpretierbar zu sein, sei es durch eine gewisse Ähnlichkeit mit schon bekannten Zeichen, sei es durch hohe Unwahrscheinlichkeit in seiner jeweiligen Umgebung. Keller erwähnt mit Recht strittige Fälle wie Zeichen der Götter oder den Lauf der Gestirne. Weite Bereiche des Okkultismus wären hier zu nennen. Manche Schwierigkeiten ergeben sich für Kellers Theorie (wie auch für manche andere semiotische Theorie) daraus, daß er keinen Begriff hat, der dem des „Zeichenkandidaten“ entspricht (s. aber unten zu „Indizien“). An manchen Stellen nennt Keller die Wahrnehmbarkeit den Ausdruck und die Interpretierbarkeit die Bedeutung eines Zeichens, an einer anderen erklärt er jedoch: „Die Eigenschaft, vermöge derer ein Zeichen wahrnehmbar ist, soll ‚Ausdruck des Zeichens‘ heißen; die Eigenschaft, vermöge derer ein Zeichen interpretierbar ist, sei ‚Bedeutung des Zeichens‘ genannt.“ (109) Diese Eigenschaften werden auch „Aspekte“ des Zeichens genannt (ebd.). Später sagt Keller noch einmal ausdrücklich, daß wir nicht den Ausdruck wahrnehmen, sondern „das, was das Zeichen wahrnehmbar macht“. (111) Der Grund scheint zu sein, daß ein und dasselbe Zeichen in unterschiedlichen Realisationen auftreten kann, z. B. in graphischer Realisation als NEIN oder Nein. Keller verdeutlicht das gern (vgl. Keller 1992) an einem Kunstwort wie NOBENISCH bzw. nobenisch. Ein solches, meint er, sei nur als dasselbe identifizierbar, wenn man weiß, was es bedeutet. Demnach wäre die Bedeutung das, was das Zeichen wahrnehmbar macht? Aber Keller will gewiß nicht sagen, der Ausdruck sei die Bedeutung. Hier bleibt eine Unklarheit, die vielleicht darauf beruht, daß die Wahrnehmbarkeit unterderhand mit der Identifizierbarkeit verwechselt wird. Die angeführte Stelle lautet im Zusammenhang: „Der Ausdruck ist nicht das, was man wahrnimmt, sondern das, was das Zeichen wahrnehmbar macht. Die Bedeutung ist nicht das, was man interpretiert, sondern das, was das Zeichen interpretierbar macht. Wenn ich NEIN sehe, nehme ich etwas anderes wahr, als wenn ich Nein oder Nein sehe. Aber ich nehme dreimal dasselbe Zeichen wahr, und zwar in drei verschiedenen Realisationen. Was das Zeichen wahrnehmbar macht, ist die Tatsache, daß es Regeln seiner Realisation gibt. (...) Den Ausdruck eines Zeichens kennen heißt, die Regeln seiner Realisation kennen.“ (111) Wie man sieht, geht es gar nicht um die Wahrnehmbarkeit des Zeichens, sondern um seine Identifizierbarkeit als ein bestimmtes Zeichen. Bühler sprach bereits in ähnlichem Sinne von der abstraktiven Relevanz. Meiner Ansicht nach kann übrigens die Typidentität auch von NOBENISCH und nobenisch ohne Rückgriff auf die Bedeutung gelernt werden, wie denn überhaupt der Vorgang der Typidentifizierung auch bei nichtzeichenhaften Objekten immer derselbe ist. (Für die Umsetzung von kleinen in große Buchstaben, von lateinischen Buchstaben in Morsezeichen usw. gibt es Transkriptionsvorschriften, die nicht auf eine „Bedeutung“ Bezug nehmen. Vgl. Roy Harris: „The Grammar in Your Head“. In: Blakemore, Colin/Greenfield, Susan (Hg.) (1987): Mindwaves. Thoughts on Intelligence, Identity and Consciousness. Oxford:507-516, S. 511. Auf die Bedeutung wird beim Übersetzen Bezug genommen, nicht beim Transliterieren oder Transkribieren.) Außerdem beschränkt Keller seine Bestimmung der Wahrnehmbarkeit auf Zeichen, die nach irgendwelchen Regeln realisiert werden, womit er in Widerspruch zu seiner Einbeziehung von Symptomen in die Menge der Zeichen gerät, denn Symptome werden typischerweise nicht nach Regeln realisiert. Es ist auch merkwürdig, daß Keller ständig von der Bedeutung als einer „Eigenschaft“ der Zeichen spricht, denn das, was ein Zeichen interpretierbar macht, ist gerade auch nach seiner eigenen Theorie keine Eigenschaft, sondern eher eine Beziehung, z. B. die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, die Ähnlichkeitsbeziehung oder ein regelhafter Zusammenhang. Bezeichnenderweise wird auch nirgends gesagt, welche geheimnisvolle „Eigenschaft“ es ist, die ein Zeichen wahrnehmbar und interpretierbar macht. – Kellers Darstellung erinnert an Karl Valentin, der sich bekanntlich für ein übersandtes Buch mit den Worten bedankte, da er leider keine Zeit zum Lesen habe, bitte er um Zusendung eines schon gelesenen. Gelesen zu sein ist eben keine Eigenschaft des Buches, sondern sozusagen eine etwas sonderbar ausgedrückte Eigenschaft des Lesers; denn nicht das Buch, sondern der Leser verändert sich durch das Lesen und erwirbt dadurch, wie man sagen könnte, neue Eigenschaften. Die Interpretierbarkeit des Zeichens kann dementsprechend darin bestehen, daß der Interpret es bereits kennt, mitsamt gewissen funktionalen Zusammenhängen, in denen es relevant ist. Wir haben es hier mit einer eigentümlichen Denkfigur oder Redeweise zu tun, die mehrfach bei Keller auftritt und recht verwirrend ist. So sagt er etwa: „Wenn wir mit Hilfe einer Sprache kommunizieren, vollziehen wir Äußerungen in der Absicht, den Adressaten zu einer bestimmten Interpretation zu bewegen.“ (61) Die Interpretation, zu der die Äußerung den Adressaten bewegen soll, ist aber die Interpretation eben dieser Äußerung selbst, so daß die Äußerung gewissermaßen ein Hilfsmittel bei der Interpretation ihrer selbst wäre – eine doppelte Inanspruchnahme, die logisch zweifellos nicht korrrekt ist. Ähnlich S. 106, wo es heißt: „Kommunizieren ist also eine Handlung, die darin besteht, dem anderen Hinweise zu geben, um bei ihm einen Prozeß in Gang zu setzen (den des Interpretierens), der zum Ziel hat, das gewünschte Beeinflussungsziel herauszufinden, das heißt die Handlung zu verstehen.“ Das Kommunizieren wäre demnach eine Handlung mit dem Ziel, zu ihrer eigenen Interpretation anzuleiten. Auch hier wieder müßte man die Äußerung bereits verstehen, um sie als Hilfe bei ihrer Interpretation ausnutzen zu können – derselbe logische Zirkel wie oben. Vgl. noch: „Zeichen sind (...), unter ihrem kommunikativen Aspekt betrachtet, Hilfsmittel, um von unmittelbar Wahrnehmbarem auf nicht unmittelbar Wahrnehmbares zu schließen.“ (113) Hiernach könnte es scheinen, als seien die Zeichen etwas anderes („Hilfsmittel“) als das, um dessen Interpretation es doch einzig und allein geht, nämlich das Wahrnehmbare selbst, von dem aus – jedenfalls nach Kellers Auffassung – auf das Nichtwahrnehmbare geschlossen werden soll. An einer noch späteren Stelle bezeichnet Keller Zeichen wieder als „Mittel, dem anderen zu erkennen zu geben, zu welchen Schlüssen man ihn bewegen möchte.“ (170) Da es sich nur um Schlüsse aus den Zeichen selbst handeln kann, steckt auch hierin die logisch unmögliche Doppelnutzung der Zeichen als Gegenstand und als Hilfsmittel der Interpretation. Wie man sieht, wirft der Kellersche Zeichenbegriff eine Reihe von grundlegenden semiotischen Fragen auf, die im folgenden genauer erörtert werden sollen. 2. Zeichentypen Keller unterscheidet in traditioneller Weise drei Typen von Zeichen, die er in Anlehnung an die seit Peirce üblichen Begriffe als Symptome, Ikone und Symbole bezeichnet. In diesem Zusammenhang kritisiert er die bereits genannten „repräsentationistischen Zeichentheorien“ oder kurz „Repräsentationstheorien“, die im „Stehen für etwas“ eine treffende Charakterisierung der Zeichen sehen. Er schreibt ihnen folgende Auffassungen zu: „- Die Relation eines Symptoms zu dem von ihm Bezeichneten ist die der Natürlichkeit. - Die Relation eines Ikons zu dem von ihm Bezeichneten ist die der Ähnlichkeit. - Die Relation eines Symbols zu dem von ihm Bezeichneten ist die der Arbitrarität.“ (117) Aber wer behauptet dergleichen? Als „Relation“ kann allenfalls die Ähnlichkeit gelten. Die Beziehung eines Symptoms zu dem, was es anzeigt (oder wie immer man es ausdrücken mag, s. u. zur Sache selbst), mag eine natürliche sein (z. B. zwischen Ursache und Wirkung, zwischen Teil und Ganzem), aber die Natürlichkeit selbst ist keine Beziehung. Auch die Arbitrarität wird nie als Beziehung, sondern stets als nähere Charakterisierung einer Beziehung angesehen. Daß es genau drei Typen sind, schärft er dem Leser auch auf lateinisch ein – „Quartum non datur.“ (114) – , so daß man dies für ein wesentliches Stück der Theorie halten muß. Die Typologie der Zeichen macht Keller abhängig von drei Typen von Schlüssen, die der Empfänger eines Zeichens bei dessen Interpretation ziehe. Genauer gesagt: Drei Typen von „systematischen Zusammenhängen“ gibt es, die es dem Interpreten ermöglichen, seine Schlüsse zu ziehen. „Die Zusammenhänge, die wir zum Interpretieren nutzen, können kausale Zusammenhänge, Ähnlichkeiten oder regelbasierte Zusammenhänge sein.“ (113f.) Die drei Zeichentypen werden also zwar von der Empfängerseite her konstituiert, durch drei verschiedene Verfahren der Interpretation; zugleich entspricht ihnen aber eine ebensolche Dreiteilung der Typen von Beziehung zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten. Da es sich nicht von selbst versteht, daß verschiedene Typen von objektiven Zusammenhängen auch verschiedene Typen von Schlüssen zu ihrer kognitiven Verarbeitung erfordern, ist dies ein erklärungsbedürftiges, aber nicht erklärtes Zusammentreffen. 2.1 Symptome Den Zusammenhang zwischen einem Symptom oder „Anzeichen“ und dem Objekt, auf das es verweist, nennt Keller „kausal“, obwohl er sich bewußt ist, daß Kausalität im eigentlichen Sinne nur einen Teil der fraglichen Beziehungen abdeckt. Neben den eigentlich kausalen Beziehungen sind auch die Beziehungen des Teils zum Ganzen sowie umgekehrt darunter zu subsumieren, ferner die Beziehung zwischen Mittel und Zweck sowie umgekehrt. Vielleicht gehören noch weitere Beziehungen dazu, denn eine systematische Abgrenzung wird nicht unternommen. Um so unklarer bleibt es, warum Keller dennoch darauf beharrt, alle diese Beziehungen mit einer „großzügigen“ Verallgemeinerung (wie er 1992 sagt) „kausal“ zu nennen, obwohl sich der seit langem etablierte Begriff der „Kontiguität“ dafür anbietet. (Unklar bleibt auch, warum diese drei Untertypen von objektiven Zusammenhängen nicht wiederum drei entsprechende Typen von interpretierenden Schlüssen erfordern.) Wie man sofort sieht, führt diese Auffassung zu einer „Zeicheninflation“ (Keller 1992:335), da schlechthin alles in Kontiguitätsbeziehungen zu allem möglichen steht. "(...) prinzipiell kann alles als Symptom seiner kausalen Folgen angesehen werden." (1992: 336) Das Umgekehrte gilt natürlich ebenfalls, und Entsprechendes läßt sich für die anderen Unterarten der Kontiguität feststellen. Keller gibt sich alle Mühe, dieser Konsequenz zu entgehen. Dem Symptom ist von seinem Ursprung her keine Zeichenhaftigkeit mitgegeben; weder daß es überhaupt Rauch gibt, noch daß dieses Feuer hier Rauch erzeugt, hat irgend etwas damit zu tun, daß ich den Rauch als Anzeichen des Feuers interpretieren kann. Aus einer ähnlichen Überlegung heraus sagt Keller: „Die Annahme, daß ein Teil stets Zeichen des Ganzen ist, würde zu einer wahren Zeicheninflation führen. Das macht deutlich, daß etwas nicht per se Symptom ist, sondern erst durch seine interpretative Nutzung dazu wird.“ (119) „Um die Übervölkerung der Welt mit Symptomen zu vermeiden, habe ich dafür plädiert, daß ein Gegenstand (im weitesten Sinne) erst durch seine interpretative Nutzung zum Symptom wird, daß es, mit anderen Worten, Symptome nur als Symptomokkurrenzen gibt.“ (122) Nicht die Interpretierbarkeit also, sondern die tatsächliche Interpretation macht das Symptom zum Zeichen und Anzeichen. Diese Auffassung führt allerdings in logische Schwierigkeiten. Zunächst widerspricht sie ganz offensichtlich der Ausgangsposition, wonach Zeichen aufgrund gewisser Eigenschaften zu erkennen geben, „welche kommunikative Absicht der Sprecher mit ihrer Verwendung zu realisieren beabsichtigt.“ (11) Von solchen Absichten kann bei Symptomen keine Rede sein, und so gesehen wären sie überhaupt keine Zeichen. Aber auch ein Beispiel wie das folgende ist schwerlich mit der Theorie zu vereinbaren: „Die Bedeutung der Flecken besteht in der Tatsache, Teil der Masernkrankheit zu sein.“ (120) Diese Tatsache hört ja nicht auf zu bestehen, wenn gerade niemand sie deutet. Folglich wäre die Bedeutung der Masernflecken doch ihre Interpretierbarkeit, und daraus folgt wiederum, daß Symptome nicht erst durch ihre Interpretation Zeichen- und Symptomcharakter annehmen. Und warum sollte man einem Phänomen, das „interpretativ genutzt“ werden kann, die interpretative Nutzbarkeit absprechen und nicht eben darin seine „Bedeutung“ sehen, ganz ebenso wie bei den anderen Zeichentypen? Der Wunsch, eine Zeicheninflation zu verhindern, kann auf andere Art befriedigt werden: indem man Symptome überhaupt nicht länger als Zeichentyp anerkennt. Keller zieht jedoch einen anderen Schluß. „Ich habe mich dazu (sic) entschieden, Zeichen, die ausgesprochenen ad-hoc-Charakter haben und Gegenstand pragmatischer Schlüsse sind, nicht zu den Symptomen zu zählen. Es handelt sich bei diesen Zeichen um Indizien ohne Symptomqualität, die Verdachtsmomente begründen mögen. Für die Dynamik der Zeichen spielen sie keine Rolle. Ich will aber gerne zugeben, daß es zwischen Symptomen und Indizien ein Kontinuum geben kann.“ (122) Aber damit macht die so entschieden vertretene Dreiteilung der Zeichentypen einer Vierteilung Platz – quartum datur! – und der nahezu unerörtert bleibende vierte Typ, die „Indizien“, umfaßt möglicherweise nicht viel weniger als alles. Die Inflation ist auf dieses neue Gebiet exportiert worden. Aber das Kunststück gelingt nicht. Ein Fuß, der aus der Lawine ragt und einen Verschütteten anzeigt, ist nach Keller ein Symptom. Daß das Fahrrad nicht vor der Haustür steht, woraus man schließen kann, daß Peter nicht zu Hause ist, soll dagegen nur ein Indiz sein. Wo ist der Unterschied? Der Hinweis auf ein „Kontinuum“ zwischen beiden Typen ist nutzlos, solange jeder Hinweis fehlt, wo und wie man überhaupt eine Grenze ziehen soll. Was heißt „ad-hoc-Charakter“, was sind „pragmatische Schlüsse“ im Unterschied zu den großzügig auszulegenden „kausalen“? Solche Fragen, die den Kern der Theorie betreffen, lassen sich nicht durch eine „Entscheidung“ erledigen. Auch am Schluß dieses Abschnitts bleibt Keller undeutlich, indem er einmal die Symptome als Zeichen gelten läßt und sie von „anderen Zeichen“ abhebt, andererseits die Erörterung der Ikone mit dem Satz beginnt: „Ikone sind echte Zeichen.“ (123) Darf man diesen Satz als „Indiz“ dafür ansehen, daß Symptome keine echten Zeichen sind? Dann hätten wir eine neue Klassifikation: echte vs. unechte Zeichen; und das wäre wieder eine ganz andere Theorie als die tatsächlich vorgetragene. An einer späteren Stelle rekapituliert Keller so: „Es gibt genau drei Verfahren, die uns zur Verfügung stehen, unsere kommunikativen Bestrebungen zu realisieren. Ich habe sie das symptomische, das ikonische und das symbolische Verfahren genannt.“ (181) Hier wechselt er offenbar unvermerkt auf die Senderseite, obwohl er doch die drei Zeichentypen nach den Interpretationsverfahren klassifizieren wollte. Für den Sender gibt es jedoch laut Keller gar kein symptomisches Verfahren, seine „kommunikativen Bestrebungen zu realisieren“, denn Symptome werden nicht gesendet, sondern sind einfach da, wo immer ein Interpret sie sieht. Es ist m. E. nicht nötig und führt nur in unlösbare Probleme, Symptome überhaupt als Zeichen anzusehen. Wenn der Arzt die Masernflecken als Teil der Krankheit „interpretiert“ (d. h. so auf sie reagiert, wie man eben auf einen Teil von etwas reagiert) – was sie zugestandenermaßen auch vor ihrer Interpretation schon sind –, braucht er sie nicht außerdem noch als Zeichen zu interpretieren. Der Wasserstrahl aus der Wand des Behälters ist durch ein Loch verursacht; es ist nicht nötig, ihn außerdem noch als Anzeichen des Loches zu betrachten. Die volkstümliche Redeweise ist vielleicht anderer Ansicht, aber es gibt keinen Grund, sich in der semiotischen Theorie daran gebunden zu fühlen. 2.2 Ikone Was Ikone zu echten Zeichen macht, ist nach Keller die absichtsvolle Verwendung im Sinne des „Griceschen Mechanismus“ (123). Keller bestreitet zunächst die repräsentationistische Definition der Ikone durch ihre Ähnlichkeit mit dem Bezeichneten. „Es stimmt einfach nicht, daß Ähnlichkeit zwischen dem Zeichen und dem Bedeuteten eine notwendige Bedingung für Ikone ist.“ (124) Zum Beweis führt er u. a. an, zwischen dem stilisierten Männlein auf der Tür einer Herrentoilette und der Herrentoilette selbst bestehe keinerlei Ähnlichkeit. Das oft herangezogene Beispiel ist jedoch falsch interpretiert. Das Piktogramm bedeutet nicht „Herrentoilette“. Vielmehr muß anderweitig bereits feststehen, daß es sich um eine Toilette handelt, und nur das Geschlecht der zur Benutzung Berechtigten ist noch offen. Es wird durch die Abbildung eines Mannes festgelegt. Das stilisierte Männlein verweist nicht auf Toiletten, sondern auf Männer, und die Ähnlichkeit ist groß genug. (Zwischen einem Mann und einer Herrentoilette besteht ein Verhältnis der Kontiguität. Man kann auch sagen, daß die Abbildung eines Mannes einem Teil der Toilette, ihrem Benutzer nämlich, ähnlich ist.) Andere Beispiele sind vom selben Schlag. Das Wort Kuckuck ähnelt zwar nicht dem Kuckuck (124), wohl aber sozusagen einem Teil von ihm, seinem Ruf nämlich, und dieser steht in Kontiguität mit dem Vogel. (Der Kuckuckusruf ist laut Keller ein Symptom des Vogels, S. 165.) Keller zitiert N. Goodmans Hinweis, ein Gemälde, das Goethe darstelle, sei einem Gemälde Schillers ähnlicher als der Person Goethe. Aber das ist ein leicht durchschaubares Sophisma. Ähnlichkeit gibt es nicht schlechthin, sondern immer nur im Hinblick auf ein Kriterium, das allbekannte Tertium comparationis. Wählt man das Kriterium in vernünftiger Weise, ist ein Porträt Goethes diesem ähnlicher als einem Porträt Schillers. Das ist der Grund, warum sich die Leute verschiedene Porträts an die Wand hängen und nicht ein und dasselbe für alle Personen, an die sie sich erinnern möchten. Kaum hat Keller bestritten, daß Ähnlichkeit ein Kriterium der Ikonizität ist, tritt er den Rückzug an: „Der Begriff der Ähnlichkeit scheint aber nicht ganz fehl am Platz zu sein. Man darf ihn nur nicht allzu wörtlich nehmen. Denn es ist nicht festgelegt, wie stark oder wie direkt die Ähnlichkeit sein muß.“ (124) Aber niemand hat behauptet, daß die Ähnlichkeit sehr stark oder sehr direkt sein muß. Und es ist kein Abgehen vom strikt wörtlichen Verständnis von „Ähnlichkeit“, wenn man auch eine geringe Ähnlichkeit immer noch als Ähnlichkeit identifiziert. Keller fährt fort: „Es kommt nicht auf die Ähnlichkeit an, sondern darauf, daß das Zeichen seinen Zweck zu erfüllen im Stande ist: Es muß beim Adressaten die vom 'Sprecher' beabsichtigte Assoziation erzeugen können. Was ein Ikon zu einem Ikon macht, ist nicht die Ähnlichkeit, sondern die Methode der Interpretation, der assoziative Schluß.“ (124f.) Was diese Assoziation ist, bleibt allerdings dunkel. Keller merkt zwar an, er verstehe darunter im Sinne der Psychologie einen „freien Einfall“, aber erstens ist das nicht die einzige „psychologische Bedeutung“ dieses Terminus, und zweitens ist nicht einzusehen, warum freie Einfälle spezifisch mit ikonischen Zeichen verbunden sein sollten. Aus Kellers Argumentation geht denn auch klar hervor, daß solche Einfälle nur dann „Assoziationen“ genannt werden sollen, wenn sie auf der Ähnlichkeit zwischen Zeichen und Bezeichnetem beruhen. Auf diesem Wege wird die zuvor heruntergespielte Ähnlichkeit in ihre vollen Rechte als Kriterium der Ikone wiedereingesetzt. Es trifft also nicht zu, was Keller behauptet: „Alles, was Assoziationen auszulösen imstande ist, kann unter geeigneten Umständen als ikonisches Zeichen verwendet werden.“ (128) Wenn man „Assoziation“ nicht willkürlich auf ikonisch ausgelöste Assoziationen einschränkt – wodurch die ganze Argumentation zirkelhaft würde – , sondern sich an den tatsächlich in der Psychologie etablierten Assoziationsbegriff hält, muß man auch z. B. Kontiguitätsassoziationen anerkennen, die ja spätestens seit den englischen Empiristen zum eisernen Bestand der Assoziationspsychologie gehören. Keller beruft sich auf einen Satz von E. Gellner: „,Freie Assoziation‘ ist tatsächlich ein ‚weißer Schimmel‘: Assoziationen sind ihrem Begriff nach frei und regellos.“ (168) Das stimmt zwar nicht, aber soweit es stimmt, lassen sich Assoziationen ja gerade nicht auf Ähnlichkeitsassoziationen einschränken, wie Keller es will und für seine Theorie braucht. Alles kann mich an alles erinnern, nicht nur an Ähnliches. Keller bemerkt offenbar nicht die destruktiven Folgen von Gellners Satz für seine eigene Theorie. Wenn aber doch die Ähnlichkeit das ikonische Zeichen begründet – wozu bedarf es dann des Umwegs über eine spekulative Psychologie der Assoziation? Ein auffälliger Mangel der Kellerschen Zeichentypologie besteht gerade darin, daß der erste Typ aufgrund der objektiv zwischen Zeichen und Bezeichnetem bestehenden Relation, nämlich der Kontiguität („Kausalität“ usw.) definiert wird, der zweite jedoch durch die angenommene Art der subjektiven (mentalen) Verarbeitung. Denn „kausal“ ist das Schließen im ersten Falle ja gerade deshalb, weil zwischen den Dingen selbst ein kausales Verhältnis besteht; im zweiten Fall ist es aber nicht deshalb assoziativ, weil die Gegenstände miteinander assoziiert sind, sondern weil sie einander ähnlich sind. Eine unverfänglichere Begriffsbildung müßte also Kontiguität und Similarität einander gegenüberstellen und zugleich offen bleiben für psychologische Einsichten in die jeweilige Art ihrer kognitiven Verarbeitung. Dann wäre auch Platz für Kontiguitätsassoziationen. Nicht aber ist es gestattet, von der Art der objektiven Beziehungen ohne weiteres auf bestimmte Arten der Verarbeitung zu schließen oder solche zu postulieren. Das kann nur zu einer pseudo-kognitiven Verdoppelung des Befundes der objektiven Beziehungen führen, im konkreten Falle zu einer unbegründeten Gleichsetzung von „Assoziation“ mit „Ähnlichkeitsassoziation“. Keller bleibt ferner eine Erklärung schuldig, was unter einem „assoziativen Schluß“ zu verstehen ist und wie sich die Idee eines „freien Einfalls“ überhaupt mit der logischen Form eines Schlusses vereinbaren läßt. Ist „assoziativer Schluß“ nicht ein hölzernes Eisen? Die Beispiele sind leider auch nicht geeignet, diese Fragen zu beantworten. „Wenn beispielsweise ein Kollege seine Brille in meinem Zimmer hat liegenlassen und ich ihn von meinem Fenster aus unten auf der Straße ins Auto steigen sehe, so kann ich gestikulierend auf meine Brille deuten, um ihm zu verstehen zu geben, daß er seine Brille bei mir vergessen hat.“ (126) Das Beispiel wird aber nicht näher analysiert, so daß man nicht erfährt, was daran ikonisch sein soll. Ist das „Zeigen auf meine Brille“ ikonisch – und wofür? Oder ist meine Brille ein Ikon seiner Brille? Gibt es ein Element der Pantomime, und wie wären überhaupt Pantomime und Mimikry semiotisch zu beurteilen? Die Ähnlichkeit ist für die Bestimmung ikonischer Zeichen so wenig belanglos, daß Keller schließlich selbst sagt: „Die Ähnlichkeit ist die Bedeutung des Ikons! Denn sie ist es, die das Ikon interpretierbar macht.“ (126) Ist nun die Ähnlichkeit ein notwendiges Kriterium für ikonische Zeichen, so ist sie andererseits nicht hinreichend. Denn sonst entstünde auch hier die Gefahr der Zeicheninflation. Die Welt ist übervölkert mit Dingen und Ereignissen, die anderen ähneln und insofern das „assoziative Schließen“ anregen. Oder nach Davidsons bekanntem Wort: „Everything is like everything, and in endless ways.“ Keller scheint diese Gefahr nicht zu sehen. Deshalb trifft er auch keine Vorkehrungen zu ihrer Abwehr. Sonst würde er vielleicht den grundlegenden Irrtum in seiner Theorie der Ikone erkennen. Ähnlichkeit ist zwar ein Kriterium für ikonische Zeichen, aber sie ist nicht hinreichend. Ähnlichkeit allein macht noch nichts zu einem Zeichen. Daß etwas überhaupt ein Zeichen ist, muß anderweitig nahegelegt sein. Die Ähnlichkeit ist etwas Hinzukommendes, im günstigen Fall eine Interpretationshilfe. Das stilisierte Männchen bedeutet, wie wir bereits gesehen haben, nicht 'Herrentoilette'. Es bedeutet vielmehr, daß die Toilette, an der es angebracht ist, nur von Männern benutzt werden soll. Vorausgesetzt ist die Konvention, daß Toiletten nach dem Geschlecht der Benutzer unterschieden sind und daß Hinweise auf das Geschlecht angebracht werden. Dieser Kontext macht das Männlein, das an sich alles und nichts bedeuten könnte, für den Benutzer zu einem Zeichenkandidaten, setzt die Interpretationsbemühung in Gang und gibt ihr eine Richtung. Entsprechendes gilt von der Pantomime am Fenster, die den anderen an seine Brille erinnern soll. Man darf bezweifeln, daß dergleichen ohne weiteres verstanden würde, wenn solche Spiele in der Gesellschaft nicht bereits eingeübt wären. Andererseits kann alles mögliche jemanden an seine Brille erinnern. Hinzuzufügen wäre, daß selbstverständlich auch Symptome ikonisch sein können. Die Spuren, die ein Fuß im Sand hinterläßt, sind Symptome und zugleich durch Ähnlichkeit mit dem verbunden, dessen Symptome sie sind. Die Spuren, die ein Hammerschlag in einer Fensterscheibe hinterläßt, sind hingegen kaum ikonisch. Fazit: Es gibt ikonische Zeichen. Ihre Ikonizität besteht in der Ähnlichkeit mit dem Bezeichneten. Diese Ähnlichkeit ist aber nicht das, was sie zu Zeichen macht, sondern nur das, was ihnen den ikonischen Charakter gibt. Es ist eine Zusatzqualität von anderweitig bereits konstituierten Zeichen. 2.3 Symbole Über Symbole sagt Keller nicht viel mehr, als daß man, um einen konkreten Anwendungsfall richtig interpretieren zu können, wissen muß, wie sie normalerweise gebraucht werden. Das Interpretieren bestehe darin, die Absicht des Sprechers zu „erraten“ (129) bzw. zu erschließen. Man könnte fragen, worin der Unterschied beispielsweise zu Symptomen besteht. Auch bei diesen muß ich einen Zusammenhang gelernt haben, z.B. den Zusammenhang zwischen Feuer und Rauch, um jenes aus diesem erschließen oder erraten zu können. Bei Symptomen schließe ich aus der erlernten Kontiguitätsbeziehung z. B. vom Rauch aufs Feuer, bei Symbolen ganz ebenso von Zeichenvorkommen auf Absichten des Sprechers. Der Unterschied besteht also allein im Typ des jeweils Erschlossenen, nicht in der Art des von Keller unterstellten Schlußverfahrens. (Das ist ein grundsätzlicher Einwand gegen die stets unterstellte Entsprechung verschiedener Schlußverfahren mit verschiedenen Typen objektiver Zusammenhänge.) Die weiteren Ausführungen zu Sinn und Bedeutung dienen nicht dazu, den Symbolbegriff näher zu erläutern, und daß die repräsentationistischen Zeichentheorien die Bedeutung des Symbols in dessen Arbitrarität sehen, ist eine falsche Behauptung, die durch Wiederholung nicht richtiger wird. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.03.2016 um 11.42 Uhr |
|
„By some we are told that thought is a sort of mental language, dealing with special signs or symbols; but this definition is no use for the linguist, who is precisely trying to base the interpretation of signs on some knowledge or thought: he finds himself in a vicious circle.“ (Eric Buyssens: „Speaking and thinking from the linguistic standpoint“. In: Géza Révész, hg.: Thinking and speaking. Amsterdam 1954:136-164, S.137) Etwas anders sagt Skinner, daß es keinen Sinn hat, das beobachtbare Sprachverhalten durch ein unbeobachtbares zu erklären, denn dieses müßte ja auch wieder erklärt werden – was aber wegen der Unbeobachtbarkeit um so schwieriger ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.03.2016 um 18.44 Uhr |
|
„Der Mann nähert sich mit seinem Mund dem der Frau, eine fraglos höchst absurde Bewegung, und preßt seine Lippen auf die ihren. Mit anderen Worten, er zeigt die Leerfunktion, während Mund-zu-Mund-Ernährung des Säuglings die Vollform darstellen würde.“ (Rudolf Bilz: Die unbewältigte Vergangenheit des Menschengeschlechts. Frankfurt 1967:22) „Da der Mensch sprechen kann, wäre es denkbar, daß ein Mann seine Geliebte mit 'Kindchen' oder 'Baby' anredete oder selbst, wenn er in die kindliche Rolle geriete, nach Kleinkinderart agrammatische Sätze spräche oder die Phonetik unserer Kleinen wieder zum Ausdruck brächte, Narrheiten, die man einem erwachsenen Manne allerdings wohl nicht zutrauen würde.“ (Ebd. 23) Weiter dann mit Ernst Leisi: Paar und Sprache – der aber Bilz nicht zu kennen scheint. Die "Paläoanthropologie" von Bilz bietet viele Anregungen und wäre noch besser, wenn nicht zuviel "philosophische Anthropologie" deutschen Stils beigemischt wäre. Jedenfalls fand ich es damals verdienstvoll, daß Suhrkamp einige Werke nachdruckte. Die Zitate sind aus der Abhandlung "Schrittmacherphänomene". |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.03.2016 um 04.17 Uhr |
|
Was ist die Tünche, die der "Prozeß der Zivilisation" über uns gelegt hat, gegen die Millionen Jahre Stammesgeschichte? Wenn wir uns mit dem Ursprung der Sprache und überhaupt mit dem Menschen beschäftigen, müssen wir scheinbare Selbstverständlichkeiten vergessen. Wir stecken den Kindern Gummischnuller in den Mund und füttern sie mit dem Löffel. Dabei merkt man schon, daß es nicht natürlich sein kann, kein Tier richtet eine solche Schweinerei an. Nein, Millionen Jahre haben unsere Frauen es so gehalten wie noch heute manche Völker (und, nach Bilz, viele Flüchtlingsfrauen im Krieg und danach): Speisen vorkauen und dann dem Atzling direkt in den Mund! Eine saubere Sache. Das muß wahrscheinlich nicht gelernt werden, jeder Mensch weiß von Natur, was zu tun ist, wenn er das hungrige schreiende Kind im Arm hält. Wir wissen auch, daß in den ungebildeten Schichten (bzw. unter Ammen in den gebildeten) das vorgekaute Brot in ein Stoffsäckchen gebunden und als Schnuller verwendet wurde. Der Speichel setzt die Stärke in Zucker um, das schmeckt. Bilz schreibt auch über die Kuckucksterz als angeborenen Kontaktlaut usw., sehr einsichtsvoll. Meine Vermutung: Die heutige Normalsprache (Sachprosa) gehört zur Tünche, Kontaktlaute, Gesang und Tanz sind viel älter. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.03.2016 um 05.16 Uhr |
|
Bis zum heutigen Tage wird der Sprachdidaktiker Stephen D. Krashen oft zitiert, der u. a. zwischen Erwerben und Lernen einer Fremdsprache unterschied (acquisition vs. learning). Das war alles längst von Skinner viel wissenschaftlicher aufgearbeitet worden: kontingenzgesteuert vs. regelgeleitet: "Wenn die Kontingenzen unzureichend sind, greifen wir auf die Regeln zurück. Die meiste Zeit zum Beispiel sprechen wir grammatisch, weil die Kontingenzen der Sprachgemeinschaft wirksam sind; wenn sie sich als unzureichend erweisen, suchen wir Hilfe bei den grammatischen Regeln." „Die sogenannten Regeln der Grammatik sind jüngst Gegenstand einer weitläufigen Kontroverse geworden. In dieser Kontroverse wurde behauptet, daß es Regeln und Anweisungen gibt, die die Sprachgemeinschaft beherrschen und denen wir gehorchen, ohne uns dessen bewußt zu sein. Gewiß haben die Menschen über Jahrtausende grammatisch gesprochen, ohne zu wissen, daß es grammatische Regeln gibt. Ein grammatisches Verhalten wurde damals wie heute durch die verstärkenden Praktiken einer Sprachgemeinschaft geformt, aufgrund derer sich einige Arten von Verhalten als wirksamer erwiesen als andere. Durch das Zusammenwirken vergangener Verstärkungen und eines gegenwärtigen Problemaufbaus wurden Sätze erzeugt. Der Sprachgebrauch aber wurde von Kontingenzen und nicht von Regeln beherrscht, ob diese nun explizit formuliert gewesen sind oder nicht.“ Auch zur mutmaßlichen Entstehung der Sprache kleidet Krashen eine ansprechende Hypothese in eine halbherzige, nicht weiter diskutierbare Form: „Krashen has also suggested that it is quite possible that all aspects of the language faculty may have nonlinguistic manifestations, that is, that language may be entirely overlaid on mental abilities also utilized in nonlinguistic ways.“ (Stephen Krashen in Whitaker/Whitaker: Studies in Neurolinguistics 3. N. Y. 1976:172) Warum „mental“? Es geht doch darum, daß Verhaltensweisen des Menschen im Dienste der Kommunikation umfunktioniert worden sind. Das kann phylogenetisch oder durch kulturelle Überformung und dann durch individuelle Konditionierung erfolgt sein. Verhalten kann man erforschen, mentale Fähigkeiten nicht, das sind nur Konstrukte. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.03.2016 um 05.05 Uhr |
|
Logopäden haben es in großem Umfang mit Schluckstörungen zu tun. Das erinnert mich an die Theorie, daß das Sprechen sich als "Exaptation" über Kauen und Schlucken gelegt haben könnte. Peter MacNeilage sagte einmal: "The reader may have shared the author's surprise, on biting his tongue, that it does not occur more often." Die Geschicklichkeit der Zunge, um nur diese zu erwähnen, beim Hin- und Herschieben der Speise zwischen Zähnen, die bis zu 80 kg Druck ausüben, ist ebenso virtuos wie die Bewegungen beim Sprechen. Das Kauen liefert den Silbenrhythmus: "Chewing, licking and sucking are extremely widespread mammalian activities, which, in terms of casual observation, have obvious similarities with speech, in that they involve successive cycles of mandibular oscillation." Kurzum: „No structure in the speech production system initially evolved for vocalization.“ Das ist noch keine Erklärung, aber man sollte es mitbedenken. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.04.2016 um 05.03 Uhr |
|
Bevor man sich mit Polemik verausgabt, könnte man sich ein Beispiel am weisen B. F. Skinner nehmen, der brieflich einmal sagte: I have never been able to understand why Chomsky becomes almost pathologically angry when writing about me but I do not see why I should submit myself to such verbal treatment. If I thought I could learn something which might lead to useful revisions of my position I would of course be willing to take the punishment, but Chomsky simply does not understand what I am talking about and I see no reason to listen to him. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.04.2016 um 17.32 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#26643 Die ZEIT beschäftigt sich und ihre Leser mit der Frage, wie man Klopapier richtig abrollt. Sie erweist sich jedoch als unfähig, die beiden Optionen verständlich zu formulieren. Leser haben denn auch moniert, daß "von oben" und "von unten" nicht angemessen sind. Wort und Bild setzen außerdem eine sehr primitive Mechanik ohne Abreißkante voraus, wie man sie in alten Schul- und Bahnhofsklos findet. Ich kenne allerdings eine liebe Verwandte, die trotz Abreißkante die Rolle so einlegt, daß der Streifen hinten an der Wand abgezogen werden muß, während er vorn an der Abreißkante blockiert. Das geht schon vierzig Jahre so, aber ich sage nichts. Habe ich mich klar ausgedrückt? Hat mich einen halben Tag gekostet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.05.2016 um 12.01 Uhr |
|
Die Idealvorstellung des strengsten Strukturalismus (Zellig Harris) war, daß der Linguist eine Sprache beschreiben solle, als verstünde er sie nicht. Zuerst wird die Form der Äußerungen festgehalten, dann die Umstände, unter denen sie auftreten. Behavioristisch gesprochen: die Topographie und die steuernden Kontingenzen. Insofern wären Strukturalismus und Behaviorismus kongeniale Partner. Aber durch das zusätzliche Postulat der Synchronizität, d. h. der Ausklammerung von Spracherwerb und Sprachgeschichte, hat sich der Strukturalismus um die eigentliche Erklärung des Sprachverhaltens gebracht. In Wirklichkeit haben natürlich die amerikanischen Linguistik-Studenten auch die entlegenste Indianersprache nicht nach dem beschriebenen Muster aufgenommen, sondern sie wußten immer schon, wie eine Sprache funktioniert (und daß es sich um Sprache handelt!), suchten nach Eigennamen, Pronomina, Sätzen usw. In „Verbal Behavior“ klammert Skinner die Gesellschaft und Geschichte bewußt aus, handelt aber nebenbei ständig davon, wie schon sein dauerndes Interesse an John Horne Tooke beweist, in dem er, wie heute jedermann, den Pionier der Grammatikalisierungsforschung erkannte. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.05.2016 um 13.15 Uhr |
|
Die angeborene Sprache der Chomsky-Schule nannte man früher göttlich, aber die Argumentation war im wesentlichen dieselbe wie im 18. Jahrhundert: Um Sprache zu lernen, muß der Mensch schon Sprache haben, denn er muß die Regeln verstehen, aus deren Befolgung Sprechen besteht. Der letzte Halbsatz ist die unbewiesene Voraussetzung eines großen Teils der Sprachtheorie bis heute. Behavioristen sagen: Sprechen besteht nicht im Befolgen von Regeln, sondern ist ein erworbenes Verhalten wie Radfahren oder Klavierspielen und ebenso zu erklären. Damit entfällt ein großer Teil des Spekulierens der letzten zweieinhalbtausend Jahre über eine Lingua mentalis. Stephan Meier-Oeser hat die Zusammenhänge sehr gut dargestellt: Im Gegensatz dazu betont J. A. Fodor: „Augustine was precisely and demonstrably right and that he was is prerequisite to any serious attemps to understand how first languages are learned.“ Wenn daher das Erlernen einer Sprache das Erlernen der Bestimmung der Extension der Prädikate derselben impliziert und dieses darin besteht, zu lernen, dass sie unter gewisse Wahrheitsregeln fallen, ein solches Lernen aber wiederum nur möglich ist, wenn man bereits über eine Sprache verfügt, in der sowohl die Prädikate wie die Regeln repräsentiert werden können, dann folgt, so Fodor: „one cannot learn a first language unless one already has one“. Zur Vermeidung eines infiniten Regresses muss dabei angenommen werden, dass diese LOT, die er, in kritischer Absetzung von Wygotsky und der „silly theory that thinking is talking to oneself“ als „central code“, „central computing language“ sowie als „medium for the computations underlying cognitive processes“ beschreibt, selbst nicht erlernt, sondern angeboren (innate) ist. (https://www.uni-muenster.de/Leibniz/meieroeser/Sprache_u_Bilder_im_Geist.pdf) Dort auch die Ursprünge in Antike und Mittelalter. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.07.2016 um 17.09 Uhr |
|
„Unlike the parodies of communication made of linked pairs of stimulus and response (Epstein, Lanza, and Skinner 1980)...“ (Jean-Louis Dessalles: Why we talk. The evolutionary origins of language. Oxford 2007:60). Die Angabe bezieht sich auf: „Symbolic communication between two pigeons (Columba livia domestica)“. Science 207 (1980):543-545. https://behavioranalysishistory.pbworks.com/w/page/35362906/Epstein,%20Robert Versteht sich, daß in dem genannten Aufsatz nicht von „linked pairs of stimulus and response“ die Rede ist, nicht einmal von Stimulus und Response. Die Verfasser beschreiben konditioniertes Verhalten zweier Tauben und bedienen sich dabei bewußt einiger Ausdrücke wie „benennen“, „fragen“, „danken“, als ob es sich um eine ähnliche Kommunikation wie zwischen Menschen handelt. Am Schluß schreiben sie, daß sie den Ablauf auch in den Begriffen der Verhaltensanalyse („Kontingenzen“, „Verstärkung“, „Shaping“ usw.) hätten beschreiben können, und werfen die Frage auf, ob man nicht die menschliche Kommunikation ebenfalls in diesen Begriffen analysieren könnte, wie von Skinner 1957 versucht. Das ist immerhin eine ernsthafte Alternative zu den „mentalen Repräsentationen“ usw., mit denen Dessalles arbeitet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.09.2016 um 04.43 Uhr |
|
Noch einmal zu "Exaptation": Der Kehlkopf war ursprünglich nicht zum Sprechen da. Der Verschluß dient auch dazu, den gesamten Brustkorb zu stabilisieren und damit den Armen Halt zu geben. Beim Heben von Lasten halten wir die Luft an. Man kann aber noch weiter zurückgehen: Unsere Vorfahren haben eine Phase als Schwinghangler durchgemacht. Es gab also Gründe, über Millionen von Jahren das Organ zu bilden, das dann sekundär für die Sprache in Dienst genommen wurde. – Die Lehre von der Sprachentstehung durch Exaptation (Gould/Lewontin u. a.) ist übrigens nicht neu. Schon Kainz berichtet 1940 darüber (Psychologie der Sprache I:276).
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.11.2016 um 05.23 Uhr |
|
Die grundlegende sprachliche Operation, das elementare Sprachverhalten besteht im "Sagen" oder "Aussagen". Auch das Benennen, das noch einfacher zu sein scheint, steht im Dienste der Prädikation. Etwas wird von etwas ausgesagt. Das wäre also naturalistisch zu rekonstruieren. Auch wenn es etwas kindlich anmutet, sollte man Skinners Versuch ernsthaft durchdenken: "Die Aufgabe der Prädikation besteht darin, die Übertragung einer Reaktion von einem Ausdruck auf einen anderen oder von einem Gegenstand auf einen anderen zu erleichtern. (362) Ein Schild mit der Aufschrift Defekt an einem Telefon hat eine einfache Wirkung auf den Leser: Er benutzt das Telefon nicht. Wenn man ihm (zum Beispiel in Abwesenheit des Telefons) mitteilt Das Telefon ist defekt, hat diese Koppelung der zwei sprachlichen Reize Telefon und defekt mit dem autoklitischen ist dieselbe Wirkung: Er begibt sich nicht zum Telefon und unternimmt nichts, um es zu benutzen. Wenn dies auf frühere Gelegenheiten zurückgeht, bei denen ähnliche Zustände mit denselben sprachlichen Reizen verbunden worden sind, dann funktioniert die gesamte Reaktion Das Telefon ist defekt als Einheit. Ihre erstmalige Wirkung kann sie aber nur erzielen, wenn defekt bereits ein wichtiger sprachlicher Reiz geworden ist, vielleicht in Reaktionen wie Das Radio ist defekt oder Das Auto ist defekt. Auch die Reaktion das Telefon muß schon in Verbindungen wie Das Telefon läutet oder Das Telefon ist in Betrieb wirksam gewesen sein. Der zum erstenmal in dieser Form gehörte sprachliche Reiz Das Telefon ist defekt bringt ein Verhalten, das zuvor von dem Reiz defekt gesteuert wurde, unter die Steuerung des Reizes Telefon und des nichtsprachlichen Reizes, den das Telefon selbst darstellt. Infolge der Tatsache, daß er diese Reaktion gehört hat, benutzt der Hörer das Telefon nicht nur nicht, sondern unterrichtet vielleicht auch Dritte davon, daß es defekt ist. Auf ähnliche Weise verändern wir, wenn wir sagen Diese Art von Pilzen ist giftig, das Verhalten des Hörers, indem wir das gesamte Verhalten, das bisher von Giften gesteuert wurde, unter die Steuerung durch eine bestimmte Art von Pilzen bringen. Wenn der Hörer dann einfach wiederholt, was wir gesagt haben oder wenn er über die Giftigkeit des Pilzes redet, ist die Wirkung sprachlicher Art. Wenn er diese Pilze meidet und dafür sorgt, daß auch andere sie nicht essen, ist es praktischer und nichtsprachlicher Art." (VB 361f.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.01.2017 um 07.07 Uhr |
|
Noch einmal zu „The model has slipped out of the linguist’s notebook into the speaker’s head.” (über den Irrweg der generativen Grammatik) In einer Rezension zu Hans Marchands bekannter englischer Wortbildungslehre (die tatsächlich unentschlossen halb-generativistisch und dadurch ziemlich gestört ist) hieß es vor Jahrzehnten: Marchand's theoretical framework gives the appearance of being very rigorous, but in actuality it can best be described as loosely and informally transformational in character. The superficial appearance is a result of Marchand's thoroughgoing classification and labeling of processes which relate complex words to sentences; however, the actual processes themselves are not formally described, as they could be within a strict transformational framework. This lack of rigor might be thought a virtue, in view of the wealth of detail that is required for an adequate description of complex word-formation in English, and the difficulties and pitfalls one faces in attempting to approach the problem rigorously, as in Lees 1960. But it is not really a virtue; and ultimately, it may be hoped, a strict formal account of English complex word-formation will be written, using the insights expressed by Marchand in this book. Was sind die „actual processes“? Offenbar dasselbe wie ein „strict formal account“. Wie gesagt: „The model has slipped out of the linguist’s notebook into the speaker’s head.” |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.03.2017 um 09.44 Uhr |
|
Man hat schon die Goldbergvariationen als Ballett, da wird auch die Hammerklaviersonate nicht lange auf sich warten lassen. Das ist nicht widersinnig, denn die Musik stammt ja aus dem Tanz. Kann man die "Kritik der reinen Vernunft" vertonen (und vertanzen)? Nein. Eher schon die "Phänomenologie des Geistes". Kant argumentiert, schreibt also aus dem Geist des Dialogs und im Sprechregister. Hegel dichtet einen Roman; schon beim Vorlesen muß man anders intonieren. Auch die "Wissenschaft der Logik" (die natürlich weder Wissenschaft noch Logik ist): Sein, reines Sein – das gibt ein wunderbares Anfangstableau, schummeriges Licht, ein Klumpen Tänzer beiderlei Geschlechts... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.03.2017 um 12.01 Uhr |
|
Du mit deinen ewigen Verkehrsregeln! Natürlich sind nicht die Regeln selbst ewig, sondern dein Gerede davon. Diese Verlagerung auf die äußerungskommentierende "Ebene" nennt man autoklitisch. Das autoklitische Element ist aber nicht metasprachlich gebraucht, sondern "integriert"; es ist also grammatisch nicht von einem Teil der "Proposition" zu unterscheiden, in diesem Fall: es könnte sich durchaus um ewige Verkehrsregeln handeln... Mit "Grammatikalisierung" ist das nicht zu erfassen, das Autoklitische ist umfassender. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.03.2017 um 07.07 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#23255 Früher soll der Mensch verwirrt in der unerklärlichen Natur gestanden haben, heute wissen wir Bescheid? Ganz im Gegenteil! Früher war die Welt geschaffen, und die Himmelserscheinungen drehten sich um die Erde. Das Umdenken zum heliozentrischen Weltbild war keine so große Sache. Wenn man heute Bücher zur Kosmologie oder auch zur Physik der Elementarteilchen liest, erkennt man ein Ausmaß an eingestandenem Unwissen, das früher unvorstellbar gewesen wäre. Wenn es gelingen sollte, die Allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantenmechanik zu verbinden, wird es auf jeden Fall so schwerverständlich sein, daß man von einem neuen "Weltbild" gar nicht mehr reden könnte. Einstweilen spricht man von Dunkler Materie, Dunkler Energie (die 95 Prozent der Welt ausmachen sollen), Anfangssingularität usw. und gesteht freimütig ein, nicht die geringste Ahnung zu haben, was das eigentlich ist, außer eben "blooming, buzzing confusion". |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.04.2017 um 07.52 Uhr |
|
Die Zeicheninflation, der "semiotische Imperialismus", hat seinen Ursprung in einem Mißverständnis. Nach Anaxagoras erblicken wir in den Erscheinungen das Nichterscheinende (ὄψις τῶν ἀδήλων τὰ φαινόμενα), aber das ist nichts Zeichenhaftes, wie die Pansemiotiker irrigerweise meinen. Diese Übertreibung ist vom selben Schlag und ebenso schädlich wie die des Strukturalismus.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.04.2017 um 04.56 Uhr |
|
http://www.univie.ac.at/iggerm/files/mitschriften/SoSe16/Schnittstellen-Patocka-SoSe16.pdf Ein Seminarpapier, in dem auch eine Karikatur des Behaviorismus enthalten ist, offenbar ganz ernst gemeint, Skinner wird ausdrücklich erwähnt: "Lernen ist ein konditionierter Reflex Adaption = Anpassung Daten werden abgelagert und aufgerufen" usw. - Es ist nicht anzunehmen, daß irgend jemand den Unsinn erkennt; man liest ja die Originaltexte nicht mehr. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der Skinner gelesen hat, und von meinen Studenten hat, soviel ich weiß, nur ein einziger meine Anregung befolgt. So tief sitzt die von Chomsky und seiner Schule verbreitete Ansicht, man wisse ja schon, was drinsteht, und es sei überholt. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 08.05.2017 um 10.54 Uhr |
|
Was Kinder manchmal für einen Eindruck und für Vorstellungen von der Wirklichkeit haben! Mein Sohn erzählte vom kürzlichen Urlaub. Für seine dreijährige Tochter war es die erste Flugreise. Als sie schon längst hoch über den Wolken waren und sich in ihrer Umgebung immer noch nichts Besonderes tat, fragte sie endlich ungeduldig: "Mama, wann fliegen wir?" |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.08.2017 um 05.01 Uhr |
|
Willem Levelt, von dem es schon ein ebenso einflußreiches wie verderbliches Buch "Speaking" (1979) gibt, hat ein weiteres verfaßt: A history of psycholinguistics: the pre-chomskyan era. (Oxford 2013) Der Titel suggeriert, daß Chomsky ein epochales Ereignis in der Geschichte der Sprachpsychologie war. Das trifft wissenschaftsgeschichtlich zu, wissenschaftstheoretisch ist es ein Skandal: die von Chomsky nicht gerade behinderte Umdeutung des Simulationskalküls in ein "mentales" Ereignis. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.08.2017 um 07.27 Uhr |
|
„Die ganze Eigenart der Psychologie als Wissenschaft liegt darin beschlossen, daß sie ihre ‚Gegenstände‘ nicht vorfindet, wie etwa die Physiologie Nerven, Blutgefäße und Sehnen, sondern daß sie jene erst durch die Benennung schafft.“ (Peter R. Hofstätter: Vom Leben des Wortes. Wien 1948:8) Die Psychologie kann zwar genau genommen keine Gegenstände schaffen, aber in gewisser Weise erfindet sie doch die Konstrukte, auf die sich die psychologische Redeweise zu beziehen scheint. (Gegen die laxe Rede vom „Schaffen“ der Wirklichkeit durch Sprache vgl. David Stove: The Plato cult and other philosophical follies. Oxford 1991.) Weniger klar drückt sich Klaus-Jürgen Bruder aus: „Die Gegenstände des psychologischen Diskurses existieren nicht unabhängig von diesem. Unser Fühlen und Denken, unser Wahrnehmen und Begehren, unsere Angst, unsere Trauer, unsere Freude, unsere Leidenschaft, unser Handeln, unser Ich selbst, kurz das Psychische wird durch unsere Rede darüber nicht nur geformt, sondern konstituiert.“ (Klaus-Jürgen Bruder: Subjektivität und Moderne. Der Diskurs der Psychologie. Frankfurt 1993:7) Mit „konstituieren“ kann aber, wie die Entgegensetzung des „Formens“ zeigt, auch nur ein Schaffen gemeint sein. Es ist kaum möglich, diese Redeweise wörtlich zu verstehen und sinnvoll zu finden. Auch der entschiedenste Sprachdeterminist nimmt nicht an, daß die Sprache die Gegenstände schafft. Die Katze, die ich streichele, die Nuß, die ich knacke – sie werden nicht durch Sprache geschaffen. Nicht einmal ein Märchenerzähler schafft die Gegenstände, von denen er erzählt, durch Sprache, sondern er beteiligt sich an einem Verstellungsspiel und veranlaßt den Hörer zu einem Verhalten, das dem Verhalten gegenüber wirklichen Gegenständen in gewisser Hinsicht ähnelt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.09.2017 um 06.50 Uhr |
|
Kognitionswissenschaft (cognitive science) ist ein neuer Name für mentalistische Psychologie. Sie tritt in unüberschaubar vielen Fassungen auf, aber es lassen sich wie früher zwei Hauptgruppen unterscheiden: 1. die subjektivistische, phänomenologische. Sie beruft sich auf die „Tatsachen des Bewußtseins“ als letzte, nicht bezweifelbare und nicht „hintergehbare“ Gewißheit. Früher sprach man häufiger von Innenschau, Introspektion; heute, nach der behavioristischen Kritik, lieber von Bewußtsein und nichtreduzierbaren „Qualia“. Die heilige Schrift dieser Richtung ist Thomas Nagels Fledermaus-Aufsatz. 2. die objektivistische, logizistische, die heute durch Computersimulation und neurologische Modelle ergänzt wird. Sie bezieht sich gern auf Chomsky und auf die Informationstheorie. Die moderne Einkleidung verdeckt den scholastischen Ursprung. Beide Richtungen kann man als naiv bezeichnen, weil sie die sprachlichen Grundlagen nicht berücksichtigen, also nicht erkennen, daß ihre Objekte alltagssprachliche Konstrukte sind. Nicht-naiv in diesem Sinn ist die behavioristische Rekonstruktion, vgl. etwa Skinners „Origins of cognitive thought“ und andere Arbeiten aus dieser Richtung. (Der 84jährige Skinner erklärt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=NpDmRc8-pyU) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.09.2017 um 04.44 Uhr |
|
Ich stelle mir x vor – das sieht aus wie der Bericht über eine Handlung. Ich sehe x vor mir – das sieht aus wie der Bericht über eine Wahrnehmung. Beides in einer radikal "privaten" Innenwelt. Und es sind nicht einmal Metaphern, sondern eben "transgressive" Ausdrucksweisen im beschriebenen Sinn. Der Gegenstand existiert gar nicht, er ist ein sprachlich verfaßtes Konstrukt, etwas Erfundenes. Man muß es funktional interpretieren: Mit Hilfe dieses Konstrukts stimmen wir unser Verhalten ab. Also: Wenn ich etwas vor meinem inneren Auge zu sehen behaupte, dann kündige ich an, mich in gewisser Hinsicht (diese Einschränkung ist wichtig!) so zu verhalten, als sähe ich es. Neurologisch kann man vielleicht nachweisen, daß beim Vorstellen dieselben Regionen aktiviert werden wie beim Wahrnehmen; es wäre dann ein Wahrnehmen ohne den Input-Anteil. Das wäre nicht überraschend, denn auch die eigentliche Wahrnehmung ist vor allem Eigenaktivität des Hirns, wie beim Träumen und Halluzinieren, nur eben mit zusätzlicher Steuerung durch Sinneseindrücke. Aber das ist alles für uns irrelevant, denn die Sprecher und Schöpfer des folkpsychologischen Konstrukts wissen nichts vom Hirn. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.10.2017 um 09.58 Uhr |
|
Computer bringt sich selbst Go bei: Trotz des Durchbruchs, den die Deep-Mind-Fachleute nun erreicht haben, ist das schlaue Programm AlphaGo Zero vor allem eine geschicktere Kombination existierender KI-Methoden. Sie verbergen sich hinter Begriffen wie „künstlichen neuronalen Netzen“ und „Reinforcement Learning“. (FAZ 20.10.17) Also operantes Konditionieren, genau nach behavioristischem Lehrbuch. Damit dies funktioniert, muß in das Programm etwas eingebaut werden, was dem "Überleben" bei Organismen entspricht. Dem Saugroboter ist es sozusagen egal, ob ihm der Strom ausgeht, er hat keinen Hunger oder Durst. Man baut eine Simulation ein, damit er rechtzeitig zur Steckdose fährt. "Belohnung" setzt die "Kontingenzen des Überlebens" voraus, phylogenetisch wie lerngeschichtlich. Erst wenn die Computer sich selbst reproduzieren, also ihre eigenen Nachkommen "zeugen" und dazu gleich noch Zufallsvariation, ist das Modell dem Original vollkommen isomorph (bei völlig verschiedenem Material, versteht sich). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.10.2017 um 08.03 Uhr |
|
„Das wissenschaftliche Studium tierischer Intelligenz wurde lange vom Behaviorismus beherrscht: Man verbat sich, selbst wenn es Ausnahmen gab, jeden Bezug auf interne mentale Prozesse. Seit drei Jahrzehnten ist in der Verhaltensforschung diese Bezugnahme dagegen selbstverständlich geworden, wenn es um die Erforschung kognitiver Fähigkeiten von Tieren geht. Zudem wird die Intelligenz von Tieren nun nicht mehr in Labyrinthen oder anderen angeblich universellen Versuchsanordnungen untersucht. Kognitive Fähigkeiten werden vielmehr als spezifische Anpassungen betrachtet: Tiere können, ebenso wie Menschen, bestimmte Aufgaben gut zu lösen, sich bei anderen, denen kein Stellenwert im Lauf ihrer evolutionären Vorgeschichte zukam, aber extrem „dumm“ anstellen. So sind Schimpansen etwa nicht sonderlich begabt, menschliche Gesichter zu unterscheiden, bei den Gesichtern ihrer Artgenossen haben sie damit jedoch keine Schwierigkeiten.“ Usw. (Thomas Weber, Rez. zu einem Buch über Vögel, FAZ 20.10.17) In Wirklichkeit hat sich an der Verhaltensforschung nichts geändert. Behavioristen stellen die dabei gewonnenen Gesetzmäßigkeiten direkt dar, oft in „Lernkurven“; Kognitivisten modellieren sie gern in einer etwas anderen Diktion. Man untersucht Tierverhalten weiterhin in experimentellen Umgebungen, aber auch im natürlichen Habitat. Die Forschung wird nicht besser, wenn man von "internen mentalen Prozessen" spricht, was übrigens eine begriffliche Kontamination ist, denn intern ist das Gehirn, nicht der Geist, der als theoretisches Konstrukt keinen Ort hat. Die Bezugnahme auf Mentales ist auch keine Neuerung der letzten 30 Jahre, sondern traditionelle anthropomorphisierende Psychologie. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.10.2017 um 08.28 Uhr |
|
Die Enkelin (ein halbes Jahr alt) fremdelt neuerdings gegenüber Opa und Oma. Vorher hat sie uns angelächelt und sich gern auf den Arm nehmen lassen. Ich könnte gekränkt sein, wenn ich nicht selbst drei Töchter aufgezogen hätte und mir die Regelmäßigkeit dieser Entwicklungsphase auch sonst bekannt wäre. Etwas überrascht lese ich nun: Als Fremdeln bezeichnet man für gewöhnlich ein Verhaltensmuster in der Entwicklung von Säuglingen, meist zwischen dem 4. und 8. Lebensmonat, bei dem ein Kind damit beginnt, fremden Personen mit starkem Misstrauen, Abneigung oder Angst zu begegnen, obwohl dies vorher kein typisches Verhalten des Kindes war. Die Angst wird stärker ausgelöst von Männern als von Frauen und von Erwachsenen mehr als von Kindern oder Kleinwüchsigen. Verständlich ist dies aus evolutionspsychologischer Sicht, denn Infantizid kommt bei allen Primaten vor, kann bis zu 40 % der noch nicht entwöhnten Jungtiere treffen und wird nahezu ausschließlich von erwachsenen, meist neu in die Gruppe eingewanderten Männchen begangen. (Verweis auf einen Beitrag des Zoologen Andreas Paul: http://oops.uni-oldenburg.de/575/2/rotang03.pdf) Das ist eine spekulative Begründung. Plausibler ist, was anschließend über die angeblich davon verschiedene Panikreaktion gesagt wird: Eine andere Art des Fremdelns ist die Panikreaktion eines Kindes beim Verlust des Kontaktes mit der Bezugsperson. Besonders heftig erfolgt die Reaktion in einer fremden Umgebung. Dieses Verhalten liegt in der sich entwickelnden Fähigkeit des Kindes, fremde Personen von Vertrauten visuell zu unterscheiden und kann sich auch auf bisher vermeintlich vertraute Personen erstrecken. Außerdem fällt das erstmalige Auftreten des Fremdelns mit der sich entwickelnden Fähigkeit des Kindes zusammen, auf eigene Faust seine Umwelt erkunden zu können (anfangs durch Krabbeln, später durch Laufen). Zoologen neigen zu unbedachten Analogieschlüssen. (Eibl-Eibesfeldt ist dafür bekannt.) Wenn Infantizid sich evolutionär herausgebildet hat, dürfte er nützlich sein. Warum hat dann das Kind Angst, statt sich willig seinem Mörder auszuliefern? Entkommen kann es ihm ohnehin nicht; die Fluchtreaktion (mehr als Weinen und Abwenden des Gesichts ist nicht möglich) hat keinen Sinn und kann sich nicht bewährt haben. Steigt die Mordlust der Männer, wenn die Kinder ein halbes Jahr alt sind, und flaut dann wieder ab? Das Fremdeln der Enkelin stellte sich übrigens nach einer zweiwöchigen Reise zu unbekannten Verwandten ein, wo viele unbekannte Gesichter sich herandrängten. Aber das hat allenfalls beschleunigend gewirkt. Das Kind muß auf jeden Fall durch eine Phase hindurch, in der andere Menschen so ähnlich, aber eben nicht genau so aussehen wie Mama und Papa. Das Mädchen hängt also erst einmal an Mutter und Vater und betrachtet nach wie vor mit Wohlgefallen den schon erwähnten, wirklich furchterregend aussehenden Familienhund (französische Bulldogge). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.11.2017 um 08.00 Uhr |
|
Wenn ich versuche, den Mund so trompetenartig vorzustülpen wie Trump (no pun intended), komme ich mir gleich wie ein anderer Mensch vor. Ich werde ein bißchen Trump. Psychologen wissen, daß dies keine so alberne Bemerkung ist. Wir sind traurig, weil wir weinen, und nicht umgekehrt. Lachen macht fröhlich. Das ist eine berühmte Theorie. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.11.2017 um 09.05 Uhr |
|
Die extreme behavioristische Schule der Psychologie – Skinner war ihr prominentester Vertreter – ging davon aus, daß alles Verhalten auf äußere Reize zurückzuführen sei und zumindest Vögel und Säugetiere im Prinzip beliebig konditionierbar seien. (Andreas Paul: Von Affen und Menschen. Darmstadt 1998:257f.) Auch dieser Primatenforscher kann also keine einzige Seite von Skinner gelesen haben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.11.2017 um 05.22 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#22272 Zur Familie dieser naiven (= mentalistischen) Psychologien gehört natürlich auch die Psychoanalyse. "Psychoanalytische Erkenntnis ist diejenige Theorie seiner selbst, die ein sich schrittweise erkennender Patient entwickelt. Nur dann ist sie auch gültig." (Andreas Hamburger: Entwicklung der Sprache. Stuttgart 1995:111) Die Psychoanalyse soll also bewußtseinseigen sein, d.h. nicht aus der alltagspsychologischen Redeweise heraustreten. Sie spricht die Sprache des Patienten. Das macht sie für Literaten so anziehend. Für Habermas ist sie genau deshalb "emanzipatorisch", was viele Kritiker belächeln, weil sie an die kaum noch aufzuhebende Abhängigkeit des Patienten von "seinem" Analytiker denken. Ein "sich schrittweise erkennender Patient", der eine "Theorie seiner selbst entwickelt" - das ist wirklich ziemlich komisch. Hinzu kommt, daß für die Psychoanalyse grundsätzlich jeder ein "Patient" ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.11.2017 um 10.45 Uhr |
|
Anzeichen sind keine Zeichen. Das scheint paradox, weil der Zeichenbegriff wohl von den Anzeichen herstammt. Aber semiotisch ist es selbstzerstörend, wenn man Zeichen so definiert, daß Anzeichen dazugehören. Denn man kann aus allem auf etwas anderes schließen, folglich gäbe es nichts Unterscheidendes mehr, alles wäre Zeichen. Manche schrecken davor nicht zurück, aber diese Zeicheninflation läßt einen entscheidenden Unterschied veschwinden. Was wir über die Sterne und den Himmel wissen, verdanken wir zum größten Teil der Spektralanalyse. Die Fraunhoferschen Linien (um es kurz auszudrücken) sind Anzeichen der Dinge, die wir dort draußen ausmachen. Aber sie existieren natürlich nicht um der Schlußfolgerungen willen, die wir daraus ziehen. Warum hebt der Kater den Schwanz und pinkelt gegen das Bein des Terrassentischs? Nicht wegen einer Blasenschwäche, sondern weil er sein Revier markieren "will" (wir wissen, was das hier bedeutet). Das ist ein wirkliches Zeichen. (In Indien habe ich mal die volle Ladung eines ausgewachsenen Tigers abgekriegt und verstand sofort, was er damit sagen wollte...) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.11.2017 um 05.34 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1432#27381 Die Speikobra soll eine Fünftelsekunde „in die Zukunft planen“, wo sich die Augen ihres bewegten Opfers befinden werden, in die sie ihr Gift spritzt. (Bericht in der SZ vom 18.5.10). Das ist wie beim Schützenfisch. Die Kobra plant nicht in die Zukunft (wohin sonst?), sondern reagiert unter der Steuerung eines gegenwärtigen Reizes so, daß die Wirkung ihres Verhaltens eine Fünftelsekunde später durch den Erfolg verstärkt wird – der Zusammenhang ist aber wohl nicht gelernt, sondern phylogenetisch hergestellt. Auch die Eichhörnchen planen nicht, wenn sie Nüsse verstecken. Deren Auffinden Wochen und Monate später hat phylogenetisch das Verhalten des Versteckens verstärkt. (Was keine Nüsse versteckte, überlebte nicht.) Plan ist unabänderlich an das Handlungsschema von Vorhersage und Ausführung gebunden. Tiere können nicht sprechen, also planen sie nicht = also ist es überflüssig, bei ihnen von Planen zu sprechen. Beim Menschen muß man so weit kommen, daß man das Planungsverhalten auch noch erklärt und dann eben auch hier nicht mehr von Planen spricht. S. "Naturalisierung der Intentionalität". |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.11.2017 um 06.53 Uhr |
|
Ohne Spiel keine Sprache. „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ (Schiller) Was ist die volle Bedeutung des Worts Mensch? Man kann da viel hineinlegen. Das bringt nicht weiter. Tiere spielen auch. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, Explorationsverhalten von Spielen zu unterscheiden. Der Unterschied zwischen Simulationsspiel und Wettkampf (play und game) ist im deutschen Wort Spiel aufgehoben, mit Folgen für die Theorien des Spiels. („Spieltheorie“ ist wieder etwas anderes.) Verstellungsverhalten ist grundlegend, die Wettkampf-Funktion kommt gegebenenfalls hinzu. Schach ist ganz offen als Kriegsspiel erkennbar, Go ebenfalls, natürlich auch Skat u. ä. Fußballer und Schachspieler kämpfen gegeneinander, anschließend trinken sie gemeinsam Bier. Nur dysfunktionale Familien verfeinden sich tödlich über einem Mensch-ärgere-dich-nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.12.2017 um 05.36 Uhr |
|
Wenn man über Sprache und Evolution nachdenkt, kommt man leicht auf den Gedanken, daß es zum Beispiel für den Schimpansen doch gewiß ein Riesenfortschritt wäre, wenn er zusätzlich zu seiner sonstigen Geschicklichkeit auch noch eine Sprache nach Art der unsrigen hätte. Dabei übersieht man, daß es gar nicht so einfach ist, Sprache in ein bereits funktionierendes System der Handlungskoordination einzufügen, ohne daß es eher stört. Dieses Bedenken ist ganz richtig ausgesprochen von mehreren Autoren in: Harnad, Stevan R./Steklis, Horst D./Lancaster, Jane (Hg.) (1976): Origins and evolution of language and speech. New York. (Annals of the New York Academiy of sciences 280) Es gilt aber auch für die Versuche, Affen eine Sprache von grundsätzlich ähnlicher Art wie die menschliche beizubringen (der Unterschied zwischen Lautgebilden und Plastikzeichen ist hier unwesentlich). Es bleibt ein erratischer Fremdkörper im perfekt angepaßten Verhaltenssystem der Tiere. Das ist der Hauptgrund für die unerträgliche Plattheit der meisten Forschungsberichte über Affen und Sprache ("Der Versuchsleiter fragte den Affen nach der Farbe" usw.). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.12.2017 um 04.43 Uhr |
|
Am radikalsten ist der „deskriptive Behaviorismus“ (Skinner 1938), der der Psychologie lediglich die Erforschung von Beziehungen zwischen Reizen (S) und Reaktionen (R) – also die Konstruktion sogenannter SR-Theorien – als Aufgabe zuweist und jedwede Analyse innerorganismischer Prozesse der Physiologie vorbehält. (Norbert Bischof in Metzger, Hb. d. Psych. I, 1:24) Letzteres stimmt und versteht sich von selbst, aber „SR“ stimmt nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.12.2017 um 13.08 Uhr |
|
Mark Galliker/Margot Klein/Sibylle Rykart: Meilensteine der Psychologie. Stuttgart 2007. Skinners Frühwerk „The Behavior of Organisms“ wird kurz erwähnt, ausführlicher besprochen wird aber nur das populärwissenschaftliche Buch „Jenseits von Freiheit und Würde“. Das eigentliche Hauptwerk „Verbal Behavior“ ist nicht erwähnt, wohl aber die Kritik Chomskys, die sich hauptsächlich darauf bezieht. Skinner betrachte den Menschen als „beliebig formbar“. Später habe er aber nicht mehr an die „beliebige Formbarkeit des Menschen“ geglaubt. (412) – Also eine sehr oberflächliche Darstellung, die nicht auf Lektüre der Originale zurückgehen kann. (Kein Wunder, daß Gallikers später erschienene „Sprachpsychologie“ (2013) nicht viel taugt (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#25547).) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.01.2018 um 07.21 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#31683 Die Wahrnehmung eines Dreiecks muß also nicht "einfacher" sein als die Wahrnehmung eines Gesichtes; sie kann sogar komplizierter sein. (Ernst Pöppel: Lust und Schmerz. Berlin u.a. 1982:80) Daraus folgert Pöppel allerdings unzulässigerweise ein Argument gegen den Physikalismus und für das Ausgehen vom "Phänomenologischen". Kreise, Dreiecke, Quadrate sind einfache geometrische Figuren, aber nicht für unser Gehirn. Das ist eher auf Gesichter eingestellt. Nach Hebb, Psychology 454ff. ist ein großes Gehirn nicht in der Lage, einfache Dinge auf einem einfachen Wege zu bewältigen. Ratten unterscheiden einfache geometrische Figuren schneller als Schimpansen, aber diese generalisieren besser. „Die physiognomischen Eigenschaften der Umgebung sind die primären, nicht die kognitiven. Und das gilt in gleicher Weise für leblose wie lebende Dinge.“ (David Katz: Gestaltpsychologie. 4. Aufl. 1969:95) „...die Überlegenheit des Komplexen und besonders des zugleich Lebensnäheren ist in der frühen Kindheit ... erheblich größer als beim Erwachsenen.“ (ebd. 160) Bei zwei guten Fotos eines Unbekannten sind wir im Zweifel, ob es sich um dieselbe Person handelt, während wir auf zwei schlechten Fotos einen Bekannten ohne weiteres identifizieren können. Das gilt für viele Gebiete der Wahrnehmung und nicht nur dort. Die sogenannten Sinnesdaten steuern etwas bei, aber viel weniger, als man denkt; das meiste ist gelernt. Auch beim Verstehen von Sprache wichtig. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 04.01.2018 um 14.58 Uhr |
|
Ich vergleiche ein gutes Foto mit einer genauen Zahl, ein schlechtes mit einer gerundeten. Kann ich bestätigen, daß es heute mittag um die 10°C warm ist? Ich komme gerade von draußen und nicke. Kann ich aber auch bestätigen, daß es heute mittag um die 10,2°C warm ist? Oh, sage ich, da bin ich mir leider nicht ganz sicher. Je besser das Foto ist, umso mehr Wert wird man auf die Verläßlichkeit der Aussage legen. Dagegen wird man dem Betrachter keinen großen Vorwurf machen, wenn auf dem unscharfen Foto doch nicht der vermeintliche Bekannte abgebildet ist. Das alles wird sicher unbewußt die Antwort beeinflussen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.01.2018 um 14.07 Uhr |
|
Dobzhanskys bekannter Satz „Nothing in biology makes sense except in the light of evolution“ ist auch auf die Sprachwissenschaft anwendbar. Die strukturalistische Sprachwissenschaft verhält sich zur historischen (und „ontogenetischen“, lerngeschichtlichen) wie Linné zu Darwin (oder auch wie die Phänomenologie zum Behaviorismus – dies würde eine längere Begründung erfordern, wird allerdings ohnehin von Strukturalisten zugegeben und als Vorzug verbucht).
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.01.2018 um 04.38 Uhr |
|
Kommunikatives Verhalten beginnt spätestens mit dem ersten Lächeln (4. bis 7. Woche). Es ist ein angeborenes Zeichen. Welchen biologischen Sinn hat es? Wahrscheinlich verstärkt das Lächeln des Säuglings die Bindung des Erwachsenen an ihn, also das fürsorgliche Verhalten. Im Internet findet man sehr viele private Mitteilungen über die starke Wirkung, die das erste Lächeln auf die Eltern ausübt (meistens von Müttern). Die „Grundlinie“ von Auge zu Auge ist die Basis aller Verständigung. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.01.2018 um 04.44 Uhr |
|
„Wie geschieht es, dass unser Körper in aller Regel unserem Willen gehorcht, dass etwa, wenn ich trinken will, sich meine Hände so bewegen, dass sie tatsächlich die Tasse ergreifen und zum Munde führen?“ (Joachim Hoffmann, Martin V. Butz, Oliver Herbort, Andrea Kiesel, Alexandra Lenhard: Spekulationen zur Struktur ideo-motorischer Beziehungen. Zeitschrift für Sportpsychologie, 14 (3), 2007: 95-103) Hoffnungslose Begriffsverwirrung: ein Ich, das dem Körper gegenübersteht und ihm Befehle gibt. Manchmal kann man nicht tun, was man will. (Als ich kurz an einer Aphasie litt, wollte mein Sprechapparat nicht so wie ich, sondern brachte Laute hervor wie ein Fremder. Ich wollte, während die Ambulanz unterwegs war, zu meiner Frau sagen, daß ich für die Klinik einen Schlafanzug einpacken müsse, aber es kam etwas ganz anderes, Sinnloses aus meinem Mund.) Das muß anders erklärt werden, wenn es – auch physiologisch – Sinn haben soll. Ich habe anderswo auf die Inkonsistenz der volkspsychologischen Redeweise ("mein Geist" und "mein Körper") hingewiesen. Das kann man wissenschaftlich nicht einfach ausbauen, man muß es überwinden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.02.2018 um 18.49 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1546#31857 „Im Vokabular eines Laien gibt es viele Worte, die eine Tätigkeit des Organismus andeuten, aber doch kein Verhalten im engeren Sinne beschreiben. Freud hat viele davon großzügig verwendet – zum Beispiel heißt es, daß das Individuum unterscheidet, sich erinnert, etwas folgert, verdrängt, entscheidet und so fort. Solche Ausdrücke beziehen sich nicht auf spezifische Handlungen. Wir sagen, daß ein Mensch zwischen zwei Gegenständen unterscheidet, wenn er sich in bezug auf sie unterschiedlich verhält; aber das Unterscheiden selbst ist kein Verhalten.“ (usw. über „Verdrängen“, „Entscheiden“) „Die Schwierigkeit besteht darin, daß man sich bei der Verwendung von Worten, die Tätigkeiten andeuten, genötigt fühlt, einen Akteur zu erfinden (...)“ (Skinner in: Ernst Topitsch (Hg.): Logik der Sozialwissenschaften. 12. Aufl. Frankfurt 1993: 400-409, S. 406; ähnlich mit weiteren Details auch in Catania/Harnad (Hg.) 1988:97f.) Unter diese Kritik fällt auch die Rede vom „Schließen“ als einer mentalen Tätigkeit. Wenn jemand z.B. zwei Sätze äußert, die untereinander in einer bestimmten logischen Beziehung stehen, so hat er, wie man sagt, eine „Schlußfolgerung“ vollzogen. Das ist aber keine besondere Verhaltensweise oder mentale Tätigkeit, sondern drückt nur noch einmal die logische Beziehung selbst aus. Man kann daher auch niemanden auffordern, etwas zu vergleichen usw. Was tatsächlich geschieht, ist etwa folgendes: Der zum Vergleichen Aufgeforderte sieht sich veranlaßt, etwas über a und b zu sagen, und dabei berücksichtigt er (aber auch das ist natürlich kein weiteres Verhalten!) den Unterschied zwischen a und b. (Sein Reden wird von Eigenschaften von a und b gesteuert.) Wenn zwischen den beiden Aussagen ein bestimmtes logisches Verhältnis besteht, so sagt man vielleicht, der Sprecher habe einen „Syllogismus“ vollzogen. Das Schließen hat, wie alles Logische, seinen Ort in der zwischenmenschlichen und insofern öffentlichen Kommunikation. Es charakterisiert das Sprachspiel des Argumentierens, also das Behaupten, Bestreiten und Beweisen. Das Logische umfaßt die allgemeinen Strukturen des Argumentierens, soweit sie sich als effizient bewährt haben. Mit der Feststellung, daß der Sprecher logisch argumentiere, charakterisiert man eine gewisse Normgerechtheit seiner Äußerungen, man schreibt ihnen also eine bestimmte Qualität zu, ohne jedoch einen verborgenen Prozeß oder ein spezielles Verhalten vorauszusetzen, das „Schließen“ genannt werden könnte. Dasselbe gilt für das Aufstellen von „Hypothesen“. Wenn das eine Tätigkeit sein soll, kann sie nur im sprachlichen Formulieren, also im (sei es auch stummen) Aussprechen von Sätzen bestehen, denen in einem bestimmten Sprachspiel die Funktion einer „Hypothese“ zukommt. Damit ist auch klar, daß es zur Tätigkeit des Hypothesenbildens ebenso wie zu der des Schließens einer Sprache bedarf – eine Folgerung, die an verschiedenen Stellen der Sprachpsychologie von Bedeutung ist. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 03.02.2018 um 23.44 Uhr |
|
Aus einer rein mathematisch-logischen Sicht stimme ich dem voll zu. Durch Nachdenken entsteht nichts Neues, es ist letztlich nur ein Umordnen von Wissen. Wenn ich A und B weiß, C jedoch nicht, und nach einer Stunde schwitzend und unter erheblichem Kalorienverbrauch erkenne, daß aus A und B unweigerlich C folgt, dann weiß ich von da an auch C. Ich habe jedoch gar nichts gewonnen, denn das Wissen um C war genau genommen schon im Wissen um A und B enthalten. Ich kann mein unverändertes Wissen jetzt lediglich anders formulieren. Letztlich hat meine anstrengende Tätigkeit gar nichts gebracht, mein Verhalten dabei war gleich null. Andererseits hängt das davon ab, was man genau unter dem "Verhalten im engeren Sinne" versteht. Das Nachdenken wird so zu einem Nichts degradiert, bzw. es wird in eine Black Box verbannt, deren Inhalt zu einer andern Welt gehört. Das ist schon schwere Kost. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.02.2018 um 04.02 Uhr |
|
Mein Eintrag ist begriffskritisch, wie bei Wittgenstein, Skinner, Hacker usw. Es geht also nicht um das Denken oder Nachdenken selbst, sondern um die Redeweise. Das gilt für das ganze Naturalisierungsunternehmen. In der alltäglichen Verständigung sind diese mentalistischen, längst in die Sprache eingebauten Ausdrucksweisen in Ordnung. Nur in der Wissenschaft führen sie nicht weiter und sogar in die falsche Richtung. "Black box" ist ja ein methodisches Prinzip und nicht die Behauptung, daß die Box leer ist. Weiter hier (um mich nicht wiederholen zu müssen): http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#15236
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.02.2018 um 04.08 Uhr |
|
Der Flügelschlag eines Schmetterlings in Peking wird nie einen Wirbelsturm in der Karibik auslösen, was immer die Philosophen dazu sagen (vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1106#36179). Aber der nicht viel stärkere Lufthauch aus dem Mund eines Chinesen in Peking kann durchaus eine noch viel stärkere Wirkung haben. „Von einem bewegten Lüftchen hangt alles ab, was Menschen je auf der Erde Menschliches dachten, wollten, taten und tun werden.“ (Johann Gottfried Herder: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, IX, 2) Das ist eben das "Wunder des Bedeutens", und der Schlüssel liegt in der Geschichte (Evolution, Kultur, Konditionierung). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.02.2018 um 05.57 Uhr |
|
Zum vorigen Eintrag: Statt selbst zu einer Wasserquelle zu gehen, kann ein Durstiger einfach „um ein Glas Wasser bitten“, d. h. ein Verhalten zeigen, das ein bestimmtes Lautmuster hervorbringt, welches seinerseits jemanden dazu veranlaßt, ihm ein Glas Wasser zu bringen. Man kann die Laute selbst leicht in physikalischen Begriffen beschreiben; aber das Glas Wasser erreicht den Sprecher erst als Ergebnis einer komplexen Reihe von Ereignissen, zu denen auch das Verhalten eines Hörers gehört. Das Endergebnis, der Empfang des Wassers, steht in keiner auswertbaren geometrischen oder mechanischen Beziehung zur Form jenes Verhaltens, das wir „um Wasser bitten“ nennen. Es ist im Gegenteil kennzeichnend für ein solches Verhalten, daß es sich gegenüber der physischen Welt als kraftlos erweist. Wir legen weder die Mauern von Jericho durch unser Geschrei nieder, noch können wir der Sonne befehlen stillzustehen oder den Wogen, sich zu glätten. Worte brechen keine Knochen. Die Folgen eines solchen Verhaltens werden durch eine Kette von Ereignissen vermittelt, die ebenso physikalischer Natur und ebenso unausweichlich wie direkte mechanische Einwirkung, aber offenkundig schwerer zu beschreiben sind. (Skinner, Verbal Behavior, Einleitung) Der Rest des Buches widmet sich dieser Beschreibung. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 08.02.2018 um 14.42 Uhr |
|
Ist denn die Kette von Ereignissen wirklich so unausweichlich (inevitable)? Ein Durstiger muß nicht reflexhaft um ein Glas Wasser bitten, sondern es laufen schon mentale Vorgänge ab, die hier aber ausgeblendet werden. Ebenso beim Hörer, der der Bitte um Wasser nachkommen oder sie verweigern kann. Man kann zwar Bedeutungen wie alles Mentale erst einmal ausblenden, aber mir scheint, daß dadurch die Ereigniskette ihren Zusammenhalt verliert. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.02.2018 um 15.16 Uhr |
|
Von Reflexen war ja nicht die Rede, und auch "Ausblenden" trifft es nicht, weil es sich um die Entscheidung für eine bestimmte Begrifflichkeit (Redeweise) handelt. Der Behaviorist behauptet nicht, daß es das Mentale gibt oder nicht gibt, er kann einfach mit diesem Wort keine Bedeutung verbinden und hält ein solches Konstrukt für überflüssig.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 08.02.2018 um 16.01 Uhr |
|
Nun gut, der Durstige hat also verschiedene Verhaltensmöglichkeiten, er kann u. a. - selbst zur Wasserquelle gehen, - jemanden um Wasser bitten, - still sitzen bleiben und verdursten. Was ist es dann, das ihn dazu bringt, sich in einer dieser Weisen zu verhalten? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.02.2018 um 17.13 Uhr |
|
Lieber Herr Riemer, das weiß ich auch nicht, aber darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, zeichenhaftes Verhalten von anderem, sozusagen mechanischen, abzugrenzen und dennoch zugleich als physisches zu erfassen, ohne das "Wunder des Bedeutens", von dem die Mentalisten gern sprechen.
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 08.02.2018 um 18.26 Uhr |
|
An dieser Stelle geht es nicht um die Abgrenzung vom Mechanischen, sondern im Hinblick auf die angebliche Unweigerlichkeit um eine Gleichsetzung.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 09.02.2018 um 00.25 Uhr |
|
Von Reflexen war nicht die Rede, aber wenn etwas in meinem Verhalten unwillkürlich, ohne Zutun meines Bewußtseins, ohne nachzudenken passiert, dann darf ich das doch Reflex nennen? Bei allem Respekt, lieber Herr Ickler, zum ersten Mal glaube ich nicht, daß Sie diesen Satz ehrlich meinen: "das weiß ich auch nicht". Es ist doch wohl absolut unstrittig, daß Menschen denken und vermöge dieser Fähigkeit Entscheidungen treffen können. Wir wissen nicht genau, wie sie es tun, aber daß sie es tun, ist sicher. Dieses Denken hat Einfluß auf ihr Verhalten. Und deswegen können wir doch nicht so tun, als ginge es beim sprachlichen Verhalten gar nicht ums Denken. Ich finde, das Denken, das ständige bewußte Überwachen allen Handelns ist genau das, was sprachliches und anderes bewußtes von rein mechanischem Verhalten (Reflexen) unterscheidet. Unser mentaler Anteil mag schwer zu fassen sein, aber daß er existiert, kann man doch nicht ernsthaft bezweifeln. Natürlich ist unser Verhalten zum großen Teil auch antrainiert und somit reflexhaft, also auch konditioniert, aber doch nicht nur. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.02.2018 um 05.39 Uhr |
|
Ich bezweifele es weder noch bezweifele ich es nicht. Das ist natürlich schwer zu vermitteln. Ich lehne die ganze mentalistische Diktion ab, indem ich die vermeintlich unbezweifelbare Gewißheit als Bestandteil unserer "folk-psychologischen" Redeweise deute. Das habe ich u.a. hier schon versucht und kann nicht alles wiederholen: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587 Das wird Sie im Augenblick nicht zufriedenstellen, aber ich hoffe es noch einmal einleuchtender darstellen zu können. Das Naturalisierungsprojekt ist ziemlich anstrengend, Skinner hat es ja auch erfahren müssen. Stoße gerade auf ein Zitat des trefflichen Eric Schwitzgebel: Early modern philosophers such as Descartes and Locke thought that we know first and best our own stream of experience and then, based on that secure knowledge, we reach more tenuous conclusions about the outside world of physical objects. I think that’s almost exactly backwards. (http://www.3ammagazine.com/3am/the-splintered-skeptic/) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.02.2018 um 18.19 Uhr |
|
Wer sich Skinners Hauptwerk "Verbal Behavior" nicht antun will oder wenig Zeit hat, dem sei der späte Aufsatz enpfohlen: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.590.4344&rep=rep1&type=pdf
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.02.2018 um 09.59 Uhr |
|
Da wir keine Sinnesorgane für Introspektion haben, müssen einschlägige Aussagen etwas anderes bedeuten, als sie zu bedeuten scheinen.Wir müssen nachsehen, wie sie funktionieren, und nicht philosophierend etwas in sie hineinlesen. Ich hatte schon angefangen mit „ich will das tun“, was eben keinen inneren Zustand des Wollens oder gar den Besitz einer Wollung bedeutet (alles schon behauptet worden!), sondern ungefähr „ich werde das tun (kann aber noch durch Einrede davon abgehalten werden)“. (Das ist nur eine bestimmte Möglichkeit, um des Arguments willen.) Die vermeintlichen inneren Zustände sind oft oder immer in stereotype Handlungsabläufe eingebettet. Ich kann mich schämen oder verlegen sein oder schuldig sein oder etwas bereuen – lauter negativ besetzte „Zustände“, in denen ich aber nicht einfach sein kann, ohne daß eine „Geschichte“ eines bestimmten Typs vorhergegangen ist. Man sagt auch, dies sei der „kognitive“ Gehalt des Gefühls oder der Stimmung (meinetwegen! – Nötig ist es nicht). Es ist einfach praktisch, die Umstände nicht immer wieder explizieren zu müssen. Wenn ich sage „ich schäme mich“, dann weiß jeder, welche Art von Geschichten dazugehört, das Konstrukt „Scham“ faßt es zusammen. „Benennungen von Liebe, Haß, Freude und Kummer, ob bei einem selbst oder bei anderen, beruhen nicht einfach auf offen zutagetretenden Manifestationen wie Lachen oder Tränen, sondern auch auf den verschiedenartigen Umständen, die das beobachtbare Verhalten hervorgerufen haben." (A. Charles Catania nach Skinner) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.02.2018 um 16.14 Uhr |
|
The human species took a crucial step forward when its vocal musculature came under operant control in the production of speech sounds. Indeed, it is possible that all the distinctive achievements of the species can be traced to that one genetic change. (...) The cry of a hungry baby, for example, presumably evolved as phylogenic behavior because it alerted the baby’s parents, but when, through an evolutionary change, the attention of the parents could begin to act as a reinforcer, crying would become an operant, with added advantages for baby and species. (B. F. Skinner: „The evolution of verbal behavior“. JEAB 1986:115-122, S. 117 – http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.590.4344&rep=rep1&type=pdf) Skinner sagt nicht ausdrücklich, wer das Verhalten "kontrollierte" (steuerte) und auf diese Weise konditionierte, aber es ist klar und geht aus dem Zusammenhang hervor, daß es der Hörer war, genauer: Die Gruppenmitglieder konditionierten einander, nachdem diese Möglichkeit physiologisch, wohl durch Mutation, gegeben war. Den einzelnen mag es so vorgekommen sein, als seien sie in der Lage, ihr vokales/verbales Verhalten "willkürlich" zu steuern. Das ist ja gerade die Figur, die ich unter "Naturalisierung der Intentionalität" beschrieben habe: Ein Organismus ist "frei", wenn und soweit er durch Zuspruch und Einspruch anderer gesteuert werden kann. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.02.2018 um 10.27 Uhr |
|
Lautes Denken ist die (hörbare oder stumme) Verbalisierung des Denkens. (Wikipedia) Nein. Lautes Denken ist Sprechen, nur nicht so streng diszipliniert wie das gewöhnliche. Was man unter "Verbalisierung des Denkens " überhaupt verstehen soll, ist auch unklar. Beim mehr oder weniger lauten Denken (Vorsichhinsprechen) wird die Sprache auch zur Selbststeuerung und Konzentrationsförderung benutzt: If a 14-foot piece of wood is cut into two pieces in a ratio of 3 to 4, how long is each piece? “Make one piece x and the other y,” she said while she scribbled. “So x plus y equals 14. And the proportion is hmmm, hmm, and cross-multiply, then—aha!—substitute. Now 4x equals 3 times 14 minus x. x equals 6 and y equals 8. Big deal.“ Skye skipped several questions to find something harder. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.02.2018 um 10.45 Uhr |
|
Wenn die Kinder das Verb denken lernen, dann lernen sie es notwendigerweise zusammen mit dem Unterschied zu sprechen, d. h. sie lernen, daß das Denken für andere nicht wahrnehmbar, sondern radikal "privat" ist. In der Schule singen sie dann: Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibet dabei: die Gedanken sind frei. usw. Das wird nicht entdeckt, sondern gehört zur Definition. Und dazu gehört auch, daß nicht nur ich denke, sondern ebenso du und er. Es gibt kein "Problem des Fremdseelischen" und keine "kognitive Revolution", durch die das Kind zu der Einsicht kommt, daß der andere auch ein Innenleben hat. |
Kommentar von Klaus Achenbach, verfaßt am 27.02.2018 um 13.58 Uhr |
|
zu #37957: Noch komplizierter kann man die Aufgabe kaum lösen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.02.2018 um 14.50 Uhr |
|
Ist halt eine elfjährige Romanheldin, die schon genug auszustehen hat, da wollen wir nicht zu streng sein.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.03.2018 um 12.02 Uhr |
|
Die hier: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#32039 und anderswo schon erwähnte Kuckucksterz (kleine Terz abwärts) ist wohl ein "Ur-Intervall". Sie leitet auch den berühmten Marsch ein, der aus dem Film "Die Brücke am River Kwai" bekannt, aber eigentlich älter ist, besonders der einglische Eintrag bei Wikipedia ist sehr informativ. Als ich 13 oder 14 war, tönte der Marsch in der Filmversion monatelang aus allen Festern, und es war ein solcher Ohrwurm, daß man kaum noch schlafen konnte. Hat man diese verderbliche Wirkung von Ohrwürmern je untersucht? Schumann litt bis zum Wahnsinn darunter, aber wohl unter selbstgemachten, wie er mich denn auch schon schlaflose Nächte gekostet hat, weil ich z. B. den gespenstischen Schlußsatz aus "Kreisleriana" nicht loswurde, ein Psychoterrorstück ohnegleichen. (Bloß nicht reinhören, ich habe Sie gewarnt!) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.03.2018 um 04.57 Uhr |
|
Handgebrauch und Sprache hängen bestimmt eng zusammen, es gibt auch eine Menge Literatur dazu. Der voll opponierbare Daumen ist die Voraussetzung des Pinzettengriffs (s. d. bei Wikipedia). Die Enkelin zeigt ihn mit 10 Monaten, er kann aber unbeobachtet schon früher aufgetreten sein. Typischerweise entdecken die Kinder beim Vorwärtskrabbeln oder -robben irgendetwas Winziges auf dem Boden und lesen es mit dem Pinzettengriff auf. Ob dieses Stadium mit einer bestimmten Entwicklungsstufe der Kommunikation zusammenhängt, scheint nicht untersucht zu sein. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.03.2018 um 05.14 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#32089 Inzwischen bin ich durch Beobachtung eines Säuglings zu dem Eindruck gelangt, daß der Silbenrhythmus wohl eher nicht vom Kauen abzuleiten ist. Ein nganganga o. ä. tritt schon vor der Aufnahme fester Speisen auf und ist auch ziemlich verschieden vom Kauen, das keineswegs aus so gleichförmigen, isochronen Kieferbewegungen besteht. Die ebd. erwähnte Geschicklichkeit der Zunge ist ein gutes Beispiel für Bewegungen, die viel zu kompliziert für bewußte Berechnung sind, obwohl die Zunge durchaus der Willkürmotorik unterliegt (s. Planimeter-Modell, Radfahren usw.). Jeder kann auch ohne Spiegel die Aufforderung befolgen, die Zungenspitze in einer bestimmten Weise zu bewegen. Viel schwerer ist: "Legen Sie den hinteren Zungenrücken an den weichen Gaumen." |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.03.2018 um 06.38 Uhr |
|
Der Behaviorismus hat sich, während die experimentelle Psychologie fraglos seine Methoden anwendet, theoretisch in viele Schulen aufgespalten. Zum Beispiel gibt es einen "teleologischen Behaviorismus", den Howard Rachlin erfunden hat. Wir trinken, weil wir Durst haben, aber auch weil es lebensnotwendig ist. Das ist allerdings weder eine Ergänzung noch eine Korrektur Skinners. Abgesehen davon, daß nach radikalbehavioristischer Lehre nicht das Konstrukt Hunger ursächlich ist, sondern die Verstärkbarkeit der Nahrungsaufnahme nach längerer Fastenzeit, muß man natürlich proximale und distale Ursachen unterscheiden, hier Konditionierung und phylogenetische Anpassung. Mit einem schon erwähnten Beispiel: Warum bellt der Hund jetzt – und warum bellen Hunde überhaupt? Diese doppelte Perspektive ist bei Skinner allgegenwärtig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.03.2018 um 06.05 Uhr |
|
Die Blütenpflanzen erzeugen den Nektar nicht für sich selbst, sondern für die Bienen, „damit“ diese sie bestäuben. Den Bienen liegt nichts an der Bestäubung, sie findet auf dem Rücken der Nektarernte statt (an den Beinen, genauer gesagt). Aber wenn sie in einer bonselschen Bienenkonferenz über die Zukunft ihres Volkes berieten, könnte eine besonders vorausschauende Biene nichts Besseres vorschlagen, als Blütenpflanzen zu bestäuben. (Ameisenvölker züchten Pilze in wohltemperierten Kulturen.) Weil das nicht möglich ist, hat die Phylogenese es mit der Prämie Nektar ausgestattet, einer proximalen Motivation des Verhaltens. Das ist ungleich sicherer als Gelerntes. Form, Farbe und Duft der Blüten sind Zeichen für die Bienen; der Nektar nicht, er ist Nahrung. Pflanzen lernen ja nichts, weil sie sich ohnehin nicht bewegen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.03.2018 um 08.44 Uhr |
|
Ergänzend zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#32039 und http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#32037 Neueste Forschungen widersprechen der These von der Mund-zu-Mund-Fütterung als Ursprung. Eine weltweit durchgeführte Studie kam zu dem Ergebnis, dass in 168 Kulturen nur bei 46 % das Küssen üblich war und bei einigen sogar als „eklig“ empfunden wird. Einige Forscher gehen nun vielmehr davon aus, dass sich das Küssen zuerst in einigen höheren Gesellschaftsschichten etablierte und sich von dort als Statusverhalten nach unten verbreitet hat. (Wikipedia Kuss) Allerdings ist es fragwürdig, Kulturen zu zählen statt die Verbreitung in der gesamten Menschheit zu messen. Kissing in humans is postulated to have evolved from the direct mouth-to-mouth regurgitation of food (kiss-feeding) from parent to offspring or male to female (courtship feeding) and has been observed in numerous mammals. The similarity in the methods between kiss-feeding and deep human kisses (e.g. French kiss) are quite pronounced; in the former, the tongue is used to push food from the mouth of the mother to the child with the child receiving both the mother´s food and tongue in sucking movements, and the latter is the same but forgoes the premasticated food. In fact, through observations across various species and cultures, it can be confirmed that the act of kissing and premastication has most likely evolved from the similar relationship-based feeding behaviours. (Wikipedia Kiss) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.03.2018 um 04.48 Uhr |
|
Die "Botenstoffe", wie man sie nennt, sind wohl Zeichen im strengen Sinne. Zehntausende davon haben sich unter den Kontingenzen des Überlebens entwickelt. „Nothing in biology makes sense except in the light of evolution“ (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#37585) Das heißt aber nicht, daß alles Sinn hat. Ich habe gerade einen Blick auf Relikte geworfen (Weisheitszähne, Brustwarzen beim Mann...). Der Bau des Säugetierauges ist als Ingenieursleistung beklagenswert unvollkommen, wie Helmholtz bemerkte. Und überhaupt wird meistens nicht die "einfachste" Lösung gefunden, weil die Evolution zwar viel Zeit, aber keinen Verstand hat. Die Aufgabe, den Blutzuckerspiegel zu regeln, würde ein Ingenieur sicher einfacher lösen als die Natur mit ihren "Signalkaskaden" (s. die vereinfachte Darstellung unter Wikipedia "Homöostase"). Sind Sprachen so einfach wie möglich? Oder unterliegen sie einer Modernisierung, die unterschiedlich weit fortgeschritten ist? (Jespersen: "Progress in language") Wie steht es bei Schriftsystemen? Die chinesische Schrift hat vielleicht Sekundärvorzüge, aber am heutigen Zweck gemessen läßt sie sich vereinfachen und ist ja auch vereinfacht worden (Kurzzeichen und Pinyin). Für manche Zwecke ist auch die Alphabetschrift nicht einfach genug und wäre durch Stenographie ersetzbar, bei der die Redundanz weiter vermindert ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.04.2018 um 05.52 Uhr |
|
One can imagine a bunch of interacting robots getting on fine without any awareness of qualia; but surely they wouldn’t spend hours looking at pictures, or listening to Beethoven. This is just how behaviourist psychologists a few years ago described us – as lacking consciousness, or qualia of red or pain or the sound of violins. Why an audience without music qualia would sit through a symphony was hardly questioned. Now, psychology has abandoned the behaviourism of J B Watson and B F Skinner, who tried to make psychology seem more scientific and less whimsical by denying consciousness. (Richard L. Gregory) Aber das ist keine Frage der Tatsachen, sondern eine der Redeweise. Auch hier wieder das Pathos des Höheren, als könnten die Mentalisten etwas erklären, wozu der Behaviorismus zu einfältig ist. Mal ist es der „Faust“, mal Beethoven. Eine vulgäre Argumentation, die sich an den intellektuellen Stammtisch richtet. Sie wertet den Sprecher auf, der mit so tollen Sachen wie Symphonien und ff lateinischen „Qualia“ aufwarten kann. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.04.2018 um 06.35 Uhr |
|
Gerade wollte ich das Konstrukt der psychologischen Redeweise (transgressive Innenwelt-Metapher) mit der Funktion chinesischer Schmerzpuppen vergleichen, entdeckte aber unter diesem Stichwort, daß deren Deutung inzwischen stark bezweifelt wird: https://de.wikipedia.org/wiki/Schmerzpuppe Das finde ich (auch semiotisch) interessant genug, um es hier einzurücken. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.04.2018 um 04.08 Uhr |
|
Wer sich ein Bild von Skinners Behaviorismus zurechtgelegt hat wie Dieter E. Zimmer: Der Behaviorismus wollte alles Verhalten aus dem Lernen erklären und alles Lernen, auch das sprachliche, aus dem Mechanismus von stimulus und response, Reiz und Reaktion. - dürfte überrascht sein, wenn er mal Skinner selbst liest: I do not formulate behavior in terms of stimuli and responses. It is the cognitivists’ computer model that does that, with its input and output. (In: A. Charles Catania/Stevan R. Harnad (Hg.): The selection of behavior. Cambridge u.a. 1988:337) Skinner hat das oft gesagt, weitgehend vergeblich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.04.2018 um 17.28 Uhr |
|
Vor längerer Zeit hat man einen 50.000 Jahre alten Neandertaler aus dem Irak untersucht und gefunden, daß er nach einem Sturz schwer behindert noch jahrelang gelebt hat. Folglich müssen seine Stammesgenossen für ihn gesorgt haben. Man schließt daraus, daß es damals schon Mitgefühl (empathy, compassion) gegeben haben muß. Das ist voreilig. Es kann sich in Jahrtausenden eine Konvention herausgebildet haben, wie man mit Verletzten oder Behinderten umgeht. Individuelle Gefühle müssen dabei keine Rolle gespielt haben. Nach William James sind wir traurig, weil wir weinen. Man könnte sagen: Wir haben Mitgefühl, weil wir helfen. (Oder: helfen wollen, aber nicht können.) Noch radikaler gedacht: Nach Rudolf Bilz ("timor est fuga", nach Augustinus, Thomas) besteht Angst darin, daß man flieht (aber nicht kann...). Die sogenannten Gefühle fallen gewissermaßen als überflüssig aus dem Verhalten heraus. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.05.2018 um 03.37 Uhr |
|
"Beim Fremdsprachenlernen wird von seiten des Lehrers häufig zunächst deklaratives Wissen vermittelt: Man weiß dann als Schüler zum Beispiel, nach welchen Regeln im Englischen verneinende Sätze konstruiert werden. Durch Übung wird aus diesem Wissen vielleicht bald ein automatisiertes Können." (Herrmann/Grabowski:292) (s. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1586) Ziemlich mysteriös. Üben kann man doch nicht das Wissen, sondern nur das Sprechen. Dazu braucht man aber das deklarative Wissen nicht. Nach meiner Auffassung konstruiert man nach den Regeln einen fremdsprachlichen Ausdruck, simuliert also das Sprechen in der Fremdsprache; diesen Ausdruck nutzt man dann als Vorlage, um ihn als Verhaltensmuster einzuüben, entweder gesondert oder gleich im Ernstfall echter Verwendung. Das eigentliche Lernen besteht in dieser Einübung, nicht in der Konstruktion. Aber gerade das Üben bleibt in dem genannten Buch wie in der gesamten Chomsky-Nachfolge ausgespart, als perhorreszierte Gewohnheitsbildung (habit formation) des „Behaviorismus“. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.05.2018 um 11.18 Uhr |
|
Betrachten wir ein Geschicklichkeitsspiel, eine kleine Kugel ist durch Drehung des Gehäuses unter Ausnutzung ihres Gewichts in die Mitte eines Labyrinths zu befördern. Ich weiß genau, wie es geht, aber das Wissen nützt mir nichts, ich kriege es zu Anfang einfach nicht hin. Darum gibt es auch zunächst nichts zu üben. Das reine Wissen kann man nicht üben, das sehe ich auch so. Aber da ich dieses Wissen besitze, handle ich entsprechend, bis ich einmal wenigstens ein Stück des Anfangsweges geschafft habe. Jetzt beginnt die Phase der Übung, ich tue es immer wieder und erhöhe meine Geschicklichkeit, bis ich schließlich ganz schnell und fast automatisch zum gewünschten Ergebnis komme. Am Anfang habe ich nur das deklarative Wissen, und selbstverständlich brauche ich das auch, sonst würde ich es nie schaffen. Mit der Zeit entsteht aus Wissen und Übung das fast automatisierte Können. Was ist daran mysteriös? Wieso sagen Sie "Aber gerade das Üben bleibt in dem genannten Buch ... ausgespart", wo Sie doch eben daraus "Durch Übung wird aus diesem Wissen vielleicht bald ein automatisiertes Können" zitiert haben? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.05.2018 um 12.32 Uhr |
|
Diesen Unterschied hat Skinner einmal so dargestellt: Einen Ball zu fangen lernt man als Geschicklichkeit ohne jede Berechnung. Dagegen einen Satelliten bei der Rückkehr abzufangen fordert vom Kapitän des Schiffes eine genaue mathematische Berechnung. „Wenn die Kontingenzen unzureichend sind, greifen wir auf die Regeln zurück. Die meiste Zeit zum Beispiel sprechen wir grammatisch, weil die Kontingenzen der Sprachgemeinschaft wirksam sind; wenn sie sich als unzureichend erweisen, suchen wir Hilfe bei den grammatischen Regeln.“ (Skinner: Upon 98) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.05.2018 um 12.57 Uhr |
|
Entweder sprechen wir grammatisch oder nach grammatischen Regeln? Wie ist das zu verstehen?
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.05.2018 um 14.28 Uhr |
|
Entschuldigung für die Frage, ich glaube, jetzt ist es mir klar: Es geht nicht um zwei Arten verschiedenen grammatischen Sprechens, sondern um zwei verschiedene Gründe für grammatisches Sprechen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.05.2018 um 15.44 Uhr |
|
So ist es gemeint: "grammatisch richtig" vs. "nach grammatischen Regeln". Schon mal zitiert: „Die sogenannten Regeln der Grammatik sind jüngst Gegenstand einer weitläufigen Kontroverse geworden. In dieser Kontroverse wurde behauptet, daß es Regeln und Anweisungen gibt, die die Sprachgemeinschaft beherrschen und denen wir gehorchen, ohne uns dessen bewußt zu sein. Gewiß haben die Menschen über Jahrtausende grammatisch gesprochen, ohne zu wissen, daß es grammatische Regeln gibt. Ein grammatisches Verhalten wurde damals wie heute durch die verstärkenden Praktiken einer Sprachgemeinschaft geformt, aufgrund derer sich einige Arten von Verhalten als wirksamer erwiesen als andere. Durch das Zusammenwirken vergangener Verstärkungen und eines gegenwärtigen Problemaufbaus wurden Sätze erzeugt. Der Sprachgebrauch aber wurde von Kontingenzen und nicht von Regeln beherrscht, ob diese nun explizit formuliert gewesen sind oder nicht.“ (B. F. Skinner: Was ist Behaviorismus, Reinbek 1978: 146) "To say ´the child who learns a language has in some sense constructed the grammar for himself´ (Chomsky 1959:57) is as misleading as to say that a dog which has learned to catch a ball has in some sense constructed the relevant part of the science of mechanics." (B. F. Skinner: Contingencies of reinforcement. New York 1969:124) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.05.2018 um 07.50 Uhr |
|
Zu meiner Rezension http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#21839 Ich wende eigentlich nur dieselbe Begriffskritik an, wie der Hauptautor Theo Herrmann selbst sie in seinem grundlegenden und vielmehr grundstürzenden Artikel 1982 in derselben Zeitschrift vorgetragen hat. Bemerkenswerterweise hat Herrmann an mehreren Stellen eingestanden, daß diese Kritik berechtigt ist (das findet man ja sonst selten): Im übrigen sei eingeräumt, daß auch meine eigenen Arbeiten (...) nicht immer dem dritten Postulat entsprechen. (d.h. der Vermeidung von Akteur-System-Kontamination) (Sprache & Kognition 1982:10) Es wäre vorteilhaft, wenn die Psychologie, die sich auf mentale Repräsentationen beruft, ihre Begrifflichkeit klärte und den Ausdruck „mentale Repräsentation“ sparsamer und präziser verwendete. (Meine eigenen Arbeiten lassen diesbezüglich viele Wünschen offen). (Sprache & Kognition 1988:174) Da Herrmann in seinen weiteren, lehrbuchmäßigen Werken bis zu seinem Tod in der von ihm vernichtend kritisierten Mischbegrifflichkeit weitergeschrieben hat, gibt er eigentlich zu, umfassend versagt zu haben. Dem entspricht seine persönliche Mitteilung an mich: er könne es sich als Psychologe nicht erlauben, vom Mentalismus abzulassen, wie ich als Nichtpsychologe es tun könne und solle. Das methodologische Geplänkel, das sich in der Zeitschrift im Anschluß an die erste Ausgabe noch einige Jahre hinzog, scheint Herrmann ziemlich verdrossen zu haben. Er verzweifelte offensichtlich an der Unmöglichkeit, sich selbst Fachkollegen und Schülern verständlich zu machen. Obwohl sich Herrmann meiner Ansicht nach sehr klar ausdrückt, sehe ich eine Möglichkeit, das Grundproblem auch mal anders darzustellen, indem ich die semiotische Natur der "transgressiven" psychologischen Redeweise mehr linguistisch untersuche und die allzuviel diskutierte Wissenschaftstheorie beiseite lasse. Auch fehlt mir natürlich jede Scheu vor behavioristischen Sichtweisen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.05.2018 um 04.49 Uhr |
|
Wie Frauen einparken, hängt von ihrem Selbstvertrauen ab. (SZ 23.10.10) Eine typische Pseudoerklärung durch ein alltagspsychologisches Konstrukt. Sie ist aber nicht ganz wertlos. Man kann das Konstrukt in zwei Schritten operationalisieren. Zunächst wird das spezielle Verhalten in ein allgemeineres eingeordnet. Die Frau, die selbstbewußt einparkt, verhält sich auch sonst selbstbewußt; das läßt sich als konsistentes Verhalten unter Risiko darstellen. Was mag die Ursache sein? Teils angeborenes "Temperament" (auch so ein Konstrukt, das ähnliche Verhaltensdispositionen zusammenfaßt), größtenteils aber wohl Verstärkungspläne in der Lerngeschichte. Man denkt an jene Ratten, die, wenn man ihnen einmal die Chance gegeben hat, aus dem Wasserbecken herauszukommen, ohne weiteres 24 Stunden darin herumpaddeln, während sie sonst alsbald absaufen. (Ich habe gerade Frauen mit Ratten verglichen.) Jeder kennt das Sprichwort: Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Eine kurze Zusammenfassung des Behaviorismus. Wenn wir kleine Kinder beobachten, stellen wir den Unterschied fest: Manche geben gleich auf, andere machen so lange weiter, bis sie etwas zusammengebaut haben. Schon kleinste Erfolge stellen die Weichen fürs ganze Leben. Pädagogisch klug ist es, ab und zu zu loben. "Hilf mir, es selbst zu tun." Unklug wäre es, dem Kind beim ersten Anflug von "Ungeduld" gleich Hilfe oder etwas ganz anderes anzubieten ("erlernte Hilflosigkeit"). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.05.2018 um 05.02 Uhr |
|
Eine bekannte Witzfigur war früher die Autofahrerin, die am Straßenrand wartet, bis ein Mann vorbeikommt und ihr den Reifen wechselt. Man soll zwar glauben, daß diese Hilflosigkeit erlernt war, aber aus neueren Untersuchungen scheint hervorzugehen, daß Männer sich immer noch und vielleicht angeborenermaßen mehr zutrauen, risikofreudiger und daher auch gefährlicher leben. Ich habe schon John L. Locke zitiert, der dies auch für wahrscheinlich hält und auf seinen mutmaßlichen evolutionären Sinn untersucht. Unterschiedliches Sprachverhalten würde sich davon ableiten. Alles natürlich nur statistisch zu nehmen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.06.2018 um 04.12 Uhr |
|
Wenn Eibl-Eibesfeldt ein bedeutender Forscher war, würde man zu seinem Tod eine etwas tiefergehende Würdigung erwarten als die Huldigung durch einen engen Freund (FAZ). Die fragwürdige Vermischung der (nicht abgleiteten, sondern vorausgehenden) politisch-ideologischen Ansichten mit der windigen "Ethologie" wird anderswo wenigstens erwähnt. In der internationalen anthropologischen Literatur habe ich kaum Erwähnungen des Pfundskerls gefunden, als der er seinen Freunden in Erinnerung bleiben wird.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.06.2018 um 05.28 Uhr |
|
Ich mache das Geräusch Sitz!, und der Hund setzt sich. Das ist nicht sehr geheimnisvoll, ich habe ja die Konditionierung noch in Erinnerung. Muß der Hund das Zeichen verstanden haben, bevor er es befolgt? Aber Verstehen ist kein gesondertes Verhalten, es besteht im Befolgen. Allerdings kommt es vor, daß der Hund nicht gehorcht; man hat den Eindruck, als wüßte er genau, was von ihm verlangt wird, widersetze sich aber. Dann wird er eben von anderen Reizen stärker gesteuert. Menschliche Sprache funktioniert in dieser Hinsicht genau so. Wir glauben naiverweise, daß nicht das Geräusch, sondern dessen „Inhalt“ den anderen zu etwas veranlaßt. Der Inhalt ist ein Surrogat der nicht mehr gegenwärtigen („transphänomenalen“) Konditionierungsgeschichte. Diese Redeweise hat sich bewährt, man darf sie aber nicht überstrapazieren; wissenschaftstauglich ist sie nicht. Es ist die revolutionäre Leistung des Behaviorismus, das „Verstehen“ und andere mentalistische Konstrukte auszuschalten. Natürlich ist es sprachlich nicht ganz richtig zu sagen, das Verstehen einer Instruktion „bestehe“ im Befolgen. Eigentlich ist es eine sprachkritische Aussage, nur etwas salopp ausgedrückt. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 07.06.2018 um 10.10 Uhr |
|
Ich kann mich einfach nicht mit dem Gedanken anfreunden, daß der intelligente Mensch wie ein Tier von äußeren Reizen gesteuert wird. Reize wirken wohl auf den Menschen ein, aber im allgemeinen (abgesehen von angeborenen oder eingeübten Reflexen) lösen sie zunächst ein Nachdenken aus. Im Ergebnis entscheidet der Mensch selbst, wie er auf einen Reiz (z. B. Sprache) reagiert.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.06.2018 um 10.32 Uhr |
|
Wer sagt, daß ein Tier (nur) von äußeren Reizen gesteuert wird? Die Sache mit dem Nachdenken ist keine inhaltliche Frage, sondern eine begriffskritische, jedenfalls aus meiner (und Skinners) Sicht. Ich bestreite also gar nicht, daß der Mensch nachdenkt, höhere Tiere wahrscheinlich auch. So drücken wir uns eben aus, das hat seinen guten (begrenzten) Sinn. Aber für die Wissenschaft muß es objektiviert werden. Keine leichte Aufgabe, zugegeben. Sprechen ist immerhin noch faßbarer als Denken. Sprechen ist Verhalten und beobachtbar, Denken ist ein volkspsychologisches Konstrukt vielfältiger Herkunft. Ganz wesentlich ist es nach dem Sprachverhalten modelliert und zum guten Teil wohl durch gelerntes stummes Sprechen motiviert. Zum Beweis habe ich oft angeführt, daß Denken sprachlich wie Reden behandelt wird, mit Doppelpunkt und Anführungszeichen bzw. wie indirekte Rede. Diese Besonderheit wird kaum bemerkt und erklärt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.07.2018 um 05.13 Uhr |
|
Sprache heißt im weiteren Sinne jede Mitteilung innerer Zustände eines lebenden Wesens an andere durch Ausdrucksbewegungen oder Zeichen. (Friedrich Kirchner: Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe (1907)) (http://www.textlog.de/2083.html) Auch das ist ein Beispiel für den vermeintlichen Vorrang des Inneren vor dem Äußeren, zu dem man erst auf umstrittenen Wegen hingelangen müsse. Im Grunde hat sich daran außerhalb des Behaviorismus wenig geändert. Die „inneren Zustände“ sind nicht somatisch zu verstehen, sondern im Sinne des transgressiven Modells. Man kann dieses konstruierte Innere ebenso gut „Geist“ nennen. Die Vorstellung, dieses Innere sei das primär Gegebene, macht empirische Forschung unmöglich. „Introspektion“ war eine Sackgasse. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.07.2018 um 04.32 Uhr |
|
„Für Skinner ist sprachliches Verhalten wie jedes Verhalten ein Ergebnis von Konditionierung. Kinder hören sprachliche Äußerungen (= stimulus), imitieren diese Äußerungen (= response) und werden verstärkt in diesem Verhalten (= reinforcement). (...) Eigentlich kann – in diesem Ansatz gedacht – ein Kind nur solche Wörter und Sätze produzieren, die es genau so schon einmal gehört hat.“ Usw. (Monika Rothweiler in Jörg Meibauer u. a.: Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart 2002:285f.) So schreiben sie dahin, ohne sich zu schämen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.07.2018 um 09.45 Uhr |
|
Es ist nämlich ganz gewiß, daß wir die organisierten Wesen und deren innere Möglichkeit nach bloß mechanischen Prinzipien der Natur nicht einmal zureichend kennenlernen, viel weniger uns erklären können; und zwar so gewiß, daß man dreist sagen kann, es ist für Menschen ungereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu fassen, oder zu hoffen, daß noch etwa dereinst ein Newton aufstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Grashalms nach Naturgesetzen, die keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen werde: sondern man muß diese Einsicht den Menschen schlechterdings absprechen. (Kant, Kr. d. U.) Für Haeckel war natürlich Darwin dieser Newton des Grashalms. Manche (wie Volker Gerhardt) versuchen zu zeigen, daß Kants Ansicht weder durch Darwin noch durch Watson/Crick überholt sei. Aber mir scheint, daß die Erklärungsfigur der Evolution tatsächlich bei Kant noch nicht recht greifbar ist, vom genetischen „Code“ ganz zu schweigen. Auch wenn weder die Entstehung des Lebens noch das Funktionieren der Organismen vollständig erklärt sind – „begreiflich nach Naturgesetzen, die keine Absicht geordnet hat“, ist das alles durchaus. Ein Sonderfall der (wechselseitigen) Anpassung sind die natürlichen Zeichen (Vogelrufe, Schwanzfedern der Paradiesvögel, Balzverhalten, aber nicht Jahresringe). In der Ontogenese: Wir beobachten, wie das Kind im Hantieren immer geschickter wird. Dazu braucht es keinen Partner. Aber der Auf- und Ausbau des Repertoires sprachlicher Reaktionen läuft über einen anderen Menschen, der viele tausend davon differentiell verstärkt. Diese große Zahl macht das objektive Studium der Sprache als Verhalten so schwierig. Skinner bemerkt 1947: Great diversity of form. It is possible to develop hundreds of thousands of different forms of response with the same effector without trying to find hundreds of thousands of objects which will move in different ways as a result of these complex patterns. In sports movements are relatively limited—for example, the things you can do with a tennis racquet. Only a few movements are selected by the mechanical action on a ball. (Hefferline notes, S. 57) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 01.08.2018 um 23.13 Uhr |
|
Was kann man sich als sprachlich Interessierter Schöneres vorstellen, als wenn der Enkel (2 1/2) angelaufen kommt und aufgeregt ruft: "Opa, duck mal!"
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.08.2018 um 17.17 Uhr |
|
We ask the Behaviourist, "what is the difference between sloping arms in obedience to an order und just sloping arms?“ The Behaviourist peers and listens and finds no behavioural difference, so he plays the Reductionist trick. He says, „Obeying the order to slope arms is Nothing But sloping arms. There isn’t something else that the soldier does as well.“ So there is no such thing as obeying or disobeying – which is rubbish. (Gilbert Ryle: On Thinking. Oxford 1979:18) Diese Art Behaviorismus mag es geben, es ist aber nicht die „molare“ Sicht Skinners. Richtig verstanden, beobachtet der Behaviorist nicht nur die Muskelbewegung, sondern ihre Einbettung in einen größeren Zusammenhang, eine Geschichte, aus der sich die jeweilige Funktion erklärt. [Vgl. meine „Naturalisierung der Intentionalität“.] So wird auch der Unterschied zwischen Gehorchen und Nichtgehorchen beobachtbar. Allerdings hat Ryle recht, daß das Gehorchen kein eigenes Verhalten neben oder hinter der Muskelbewegung ist, sondern, wie er sagt, „adverbial“ diese Bewegung oder irgendeine andere näher spezifiziert. Ryle untersucht sehr feinsinnig eine ganze Reihe von Verben dieser Art und kommt zu Beobachtungen, die manche linguistische Semantik übertreffen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.08.2018 um 06.03 Uhr |
|
„It is a paradox for conscious humans to deny consciousness.“ – „How can conscious scientists deny the existence of consciousness?“ (Bernard Baars gegen Skinner) Abgesehen davon, daß Skinner nicht die Existenz von Bewußtsein bestreitet, sondern die Brauchbarkeit dieses Begriffs für die Verhaltensanalyse: Wie kann ein namhafter Wissenschaftler eine so offensichtliche Petitio principii begehen? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.08.2018 um 12.31 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#32051 Um die Unmöglichkeit "regelgeleiteten" Sprechens zu erläutern, zitiert Skinner gern die bekannten Verse: The centipede was happy quite, until a toad in fun Said, „Pray which leg goes after which?“ That work’d her mind to such a pitch, She lay distracted in a ditch, considering how to run. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.10.2018 um 10.34 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#39201 Man hat, wie gesagt, oft bestritten, daß Darwin der "Newton des Grashalms" gewesen sei, und es stimmt ja auch, daß Darwin nur die Entwicklung der Lebewesen, nicht die Entstehung des Lebens aus nichtlebender Materie behandelt hat. („Darwin ist in gewisser Weise genau dieser von Kant beschriebene ´Newton des Grashalms´.“ (Slavoj Žižek: Absoluter Gegenstoß. Kindle, Endnoten 15) – Die Einschränkung kann man so verstehen, daß nicht die Entstehung von Leben, sondern erst die evolutionäre Anpassung der Lebewesen gemeint ist.) Aber Kapitel 85 der Kr. d. Urteilskraft trennt m. E. hier gar nicht so scharf, sondern handelt von der Teleologie allgemein. Wenn man Dennetts Begriff anwendet, dann hat Kant den "intentionalen Standpunkt" als für die Naturforschung unentbehrlich angesehen, ohne damit objektive Zweckmäßigkeit zu behaupten (s. Anfang des Kapitels 85). Diese These ist aber durch die Evolutionslehre tatsächlich überholt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.10.2018 um 06.33 Uhr |
|
Warum die Annahme "kognitiver Karten" nichts erklärt: The discoveries of Hubel and Wiesel are admirable. But to discover a mapping is not to discover a map. To use a map as a map, there has to be a map – and there are none in the brain; one has to be able to read the map – but brains lack eyes and cannot read. (Bennett/Hacker) Weiteres unter dem Stichwort Planimeter, Wüstenameisen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.10.2018 um 05.24 Uhr |
|
Auch der Philosoph Fred Dretske behauptet, daß natürliche Zeichen etwas bedeuten (mean, indicate), auch wenn niemand sie deutet. Daß Wasser nach Norden fließt, bedeutet ein Gefälle. Sich ausdehnendes Metall zeigt Wärme an. Diese natürlichen Zeichen können nichts fehlanzeigen. Wenn Tom keine Masern hat, bedeuten die roten Flecken dies auch nicht, sondern vielleicht irgendetwas anderes. ("Misrepresentation" in: Bogdan, Radu J. (Hg.) (1986): Belief. Form, Content, and Function. Oxford) Folglich ist alles Zeichen, der Begriff hat nichts Unterscheidendes mehr. (Das Masernbeispiel wird von Rudi Keller in der Weise ausgeführt, wie ich es in meinem Aufsatz "Wirkliche Zeichen" kritisiert habe; die Zeicheninflation macht die ganze Theorie zunichte.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.10.2018 um 04.01 Uhr |
|
The subsequent development of Western thought certainly saw its share of radical mechanists – from the Enlightenment’s La Mettrie to this century’s B. F. Skinner25 –, but mechanism in this sense is indeed rank metaphysics, not science. On such ultimate issues genuine science is silent, for it addresses only those questions whose answers can be verified empirically. (Fn. 25: Notably both of these thinkers included human beings within their mechanistic framework, thus obviating the Cartesian dualism that ecoradicals find so objectionable.) (Lewis in Paul R. Gross/Norman Levitt/Martin W. Lewis (Hg): The flight from science and reason. New York 1996: 214) Aber wieso ist Skinner Mechanist? (Ob „Materialist“ gemeint ist? Aber auch diese Frage stellt sich nicht. Wie die gesamte experimentelle Psychologie ist der Behaviorismus unabhängig von philosophischen Theorien über Materie, Geist usw.) Er selbst sagt: "Nebenbei gesagt, stellen nicht die Behavioristen, sondern die kognitiven Psychologen, die den Geist als einen Computer auffassen, den Menschen als Maschine dar." (Was ist Behaviorismus? 1978:127) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.10.2018 um 04.58 Uhr |
|
Aus einem Interview des 83jährigen Skinner: For Dr. Skinner, the mind is irrelevant to understanding why people behave as they do. In his view, most assumptions about mental life made by laymen and psychologists alike are based on fallacies. In his address next week before the American Psychological Association, he will argue that all the words that describe mental activities actually refer to some behavior. "No one invented a word for mental experience that comes from the mind," Dr. Skinner said. "They all have their roots in a reference to action. To contemplate, for instance, means to look at a template, or picture. Consider comes from roots meaning to look at the stars until you see a pattern. Compare means to put things side by side to see if they match." "All the words for mental experience go back to what people do," Dr. Skinner continued. "Over thousands of years, people have used these terms to express something that goes on in their bodies. But these are action terms; they do not mean that these things are going on inside the mind." (https://www.nytimes.com/1987/08/25/science/embattled-giant-of-psychology-speaks-his-mind.html) Das Interesse an der Herkunft der psychologischen Ausdrücke der Allgemeinsprache ist kein bloß etymologisches, wortgeschichtliches. Die Übertragung vom Körperliche ins konstruierte Mentale ist nicht eigentlich metaphorisch, sondern "transgressiv" in einem genauer zu untersuchenden Sinn, gerade wegen der Konstruiertheit des Mentalen, das es ohne diese Übertragung gar nicht gäbe (und das es auch tatsächlich nicht gibt außer eben als bestenfalls nützliche Fiktion). Der Mentalismus nimmt dieses folkpsychologische Konstrukt hin und baut es aus, der Behaviorismus nicht. Darum kann man die kognitivistische (mentalistische) Psychologie naiv nennen, sie ist sozusagen sprachkritisch unbelehrt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.11.2018 um 04.11 Uhr |
|
"Der Behaviorismus war eine radikale Form der Milieutheorie, wonach Verhalten und Persönlichkeit ausschließlich Produkte der Umwelt sind. (...) Die behavioristische Theorie war gut brauchbar zur Beschreibung sehr einfacher Lernprozesse. Sie lieferte aber kein umfassendes Modell des Geistes. Heute wird das behavioristische Verstärkungslernen vor allem noch in der Tierdressur und der Werbung genutzt. Der Behaviorismus wurde erst in den 1970er Jahren im Zuge der so genannten kognitiven Wende in der Psychologie weitgehend ad acta gelegt. Die Vorstellung des passiv reagierenden Menschen wurde durch das vom planenden, selbsttätig handelnden und wahrnehmenden Individuums abgelöst. Man gestand dem Menschen zu, eigenständig zu denken. Anknüpfend an die europäische Psychologie der ersten Jahrhunderthälfte suchte man nun nach den allgemeinen Gesetzen der geistigen Tätigkeit und rückte unter Bezug auf das Paradigma der Informationsverarbeitung das Denken ins Zentrum. Die Fähigkeit zum Verständnis, zu rationalem, zielgerichtetem und verantwortungsvollem Handeln wurde grundsätzlich bei allen Menschen vorausgesetzt." (Detlev Ganten u.a.: Leben, Natur, Wissenschaft. Alles, was man wissen muss. Frankfurt 2003:478) Man muß das genaue Gegenteil der Wahrheit nur oft und selbstsicher genug wiederholen, dann wird es geglaubt. Die Verfasser sorgen dafür, daß andere sich ebenso wenig mit dem Gegenstand befassen wie sie selbst. (Man beachte auch die rhetorische Ausschmückung mit Hochwertwörtern wie "verantwortungsvoll"! Wer könnte da widerstehen?) Interessant ist die ausdrücklich erklärte Rückkehr zur „europäischen“, also wohl geisteswissenschaftlichen, nicht-experimentellen, nicht-empirischen Psychologie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. „Mind is back!“ (Skinners ironische Kritik) oder eben ganz ernsthaft: „The rediscovery of mind“ (Searle). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.11.2018 um 04.44 Uhr |
|
Edward C. Tolman war zwar mit "purposive behavior" und der Erfindung der heute weit verbreiteten "Kognitiven Karten" auf dem Holzweg. Im deutschen Wikipedia-Eintrag über ihn kann man das auch gut sehen. Was dort aber fehlt und nur im englischen Eintrag erwähnt wird, sind seine Verdienste um die Überwindung der McCarthy-Verfolgung von Intellektuellen. Leicht geraten Regierungskritiker in den Ruf, Feinde des Volkes zu sein. Dann kommt es auf die Besetzung der Gerichte an. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.11.2018 um 09.58 Uhr |
|
"Men act upon the world, and change it, and are changed in turn by the consequences of their action." Das kleine Kind greift sich einen Legostein (besser Duplo). Durch das Greifen lernt es schon etwas über den Gegenstand (Form, Größe, Gewicht, Oberfläche). Es steckt ihn in den Mund. Die Lippen und vor allem die sehr dicht mit Sensoren bestückte Zunge lehren weitere Einzelheiten, auch der Geschmack wird wahrgenommen. Es klopft mit den Steinen auf den Boden, läßt sie fallen. Dabei geben sie bestimmte Geräusche von sich. Mit eineinhalb Jahren lernt das Kind, die Steine zentriert aufeinanderzustapeln. Das Ergebnis befriedigt (verstärkt), nicht nur wegen des Passens, sondern weil sich etwas Größeres gestalten läßt: zehn Klötze aufeinander! usw. So auch mit den eigenen Geräuschen und Artikulationen. Jedes Verhalten ist zugleich ein Lernen: was man tun kann und wie die Welt beschaffen ist. Diese Erfahrungen haben etwas Verallgemeinerndes. Das gelernte Verhalten läßt sich auf ähnliche Gegenstände anwenden, es "bildet Kategorien". Das ist keine zusätzliche Leistung, im Gegenteil: Man müßte das Kind mit allerlei Maßnahmen dazu bringen, seine Tätigkeit nur auf diese bestimmten Duplosteine anzuwenden und nicht auf andere, nicht auf Holzbausteine usw. Diese unendlich vielen Lernschrittchen werden leicht übersehen oder verkannt. Man sagt dann, die Dohle habe „noch nie“ mit einer bestimmten Aufgabe zu tun gehabt. Aber wenn sie zwei Jahre alt ist, hat sie mit unüberschaubar vielen ähnlichen Aufgaben zu tun gehabt und dabei tausend winzige Verhaltensweisen gelernt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.12.2018 um 06.25 Uhr |
|
Jürgen Kaube würdigt Noam Chomsky zum 90. Geburtstag: „An Chomskys Argument, dass Kinder schneller sprechen lernen, als es durch das, was sie hören, erklärbar wäre, kommt jedenfalls keine Sprachwissenschaft mehr vorbei.“ (FAZ 7.12.18) Das Argument spielt in der Sprachwissenschaft praktisch keine Rolle mehr, es war von vornherein verfehlt. Erstens gibt es keinen Vergleichsmaßstab, der von überraschend schnellem Spracherwerb des Kindes zu sprechen erlaubt. Zweitens beruhte das Argument nicht auf Beobachtung, sondern war eine reine Phantasie. Drittens lernt das Kind seine Muttersprache nicht (nur) durch Analyse eines Inputs, durch Zuhören also – mit diesem wirklichkeitsfernen Bild des Spracherwerbs war natürlich die Erforschung der allmählichen Konditionierung von vornherein unmöglich. Dies alles ist in unzähligen Aufsätzen und Büchern zur Kritik des Nativismus dargelegt worden, die vielleicht weniger schmissig daherkommen als die starke These. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.12.2018 um 05.20 Uhr |
|
Auch eine Erinnerung zu Chomskys 90. Geburtstag, mal nicht zur Linguistik: Chomsky told a forum in New York in December, 1967 that in China “one finds many things that are really quite admirable.” He believed the Chinese had gone some way to empowering the masses along lines endorsed by his own libertarian socialist principles: China is an important example of a new society in which very interesting and positive things happened at the local level, in which a good deal of the collectivization and communization was really based on mass participation and took place after a level of understanding had been reached in the peasantry that led to this next step. When he provided this endorsement of what he called Mao Tse-tung’s “relatively livable” and “just society,” Chomsky was probably unaware he was speaking only five years after the end of the great Chinese famine of 1958–1962, the worst in human history. He did not know, because the full story did not come out for another two decades, that the very collectivization he endorsed was the principal cause of this famine, one of the greatest human catastrophes ever, with a total death toll of thirty million people. s. https://en.wikipedia.org/wiki/Political_positions_of_Noam_Chomsky#cite_note-autogenerated5-10 Ich habe schon mehrmals von der Chinabegeisterung vieler Kommilitonen in den sechziger und siebziger Jahre im roten Marburg berichtet, der ich selbst keineswegs verfallen war, obwohl oder weil ich damals anfing, Chinesisch zu lernen. Ich kannte zwar nicht das ganze Ausmaß der Leiden des Volks unter Mao, aber die nur zu bekannte Propagandasprache der Veröffentlichungen reichte mir schon, dem schönen Schein nicht zu glauben. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 09.12.2018 um 11.34 Uhr |
|
In der DDR gab es keine solche besondere Chinabegeisterung. Statt dessen war China Teil der allgemeinen kommunistischen Propaganda. Wir wußten, China ist ein sozialistisches Land, also befreundet, es baute wie wir den Kommunismus auf. In der Schule erfuhren wir Jungen Pioniere mit dem blauen Halstuch, daß die chinesischen Pioniere wie die sowjetischen ein rotes Halstuch trugen. Das war für uns Schüler schon exotisch genug, und natürlich bewundernswert! In solcher Atmosphäre erzogen, erinnere ich mich noch genau an mein Erstaunen über das Sakrileg während meines Studiums: 1979 im Grenzkrieg mit Vietnam wurde China plötzlich auf Plakaten und Aufklebern als gelbe Kralle dargestellt! Zum ersten Mal wurde ein kommunistisches Land offiziell und noch dazu in so rassistischer Weise als Agressor angeprangert. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 09.12.2018 um 13.44 Uhr |
|
Chomsky schenkte der Propaganda Jan Myrdals Glauben. Heute schenkt man den anonymen Insinuationen von Wikipedia Glauben: Chomsky was probably unaware . . .
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.12.2018 um 04.30 Uhr |
|
Wenn man sich zur „synchronischen“ Sicht entschließt, also die Geschichte (in jedem Sinn: phylogenetisch, lerngeschichtlich...) ausklammert, erscheint das Funktionieren von Zeichen als eine Art Wunder. Dann existieren die „Bedeutungen“ irgendwie, als zweite Menge von Elementen neben den Geräuschen. Entweder versteht man darunter die Dinge oder Ideen davon oder ein zweites mentales Lexikon. Platon war wie die Eleaten davon überzeugt, daß dasjenige, wovon man spricht, irgendwie existieren muß: „Plato never puts the relational character of speaking (and believing) in question or the requirement that the relata must always exist or obtain.“ (Victor Caston: „Intentionality in Ancient Philosophy“, Stanford Encyclopedia of Philosophy – guter Artikel übrigens!) Das hat seine genaue Entsprechung in der wunderbaren Zweckmäßigkeit in der Natur, die erst durch die Einbeziehung der Stammesgeschichte verständlich wurde. Als man noch keine annähernd zutreffende Vorstellung von den erdgeschichtlichen Zeiträumen hatte, konnte die offensichtliche Teleologie als Gottesbeweis dienen. So scheint das Funktionieren der Zeichen die Existenz eines „Geistes“ zu beweisen. Die genaue Beobachtung der Konditionierung löst diese Konstrukte auf, auch wenn sie einen gewissen praktischen Nutzen behalten (dem sie ja ihre Entstehung verdanken). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.01.2019 um 10.34 Uhr |
|
Manche Vögel stellen sich lahm, „um einen Jäger vom Nest wegzulocken“. Dieses Verhalten ist zeichenhaft. Der finale Infinitiv, mit dem wir es beschreiben, steht für die Angepaßtheit. Die Anpassung hat in der Vergangenheit stattgefunden (unter den „Kontingenzen des Überlebens“), aber wir sprechen so, als werde das Verhalten von einem „Ziel“ in der Zukunft gesteuert. Naturalistisch gesehen kann die Zukunft die Gegenwart nicht steuern. ("The future cannot be acting now, however, and elsewhere in science purpose has given way to words referring to past consequences." (Skinner) Etwas ähnliches meint Skinner, wenn er sagt, Bedeutung sei ein "Surrogat für Geschichte". Das gegenwärtige Meinen ist eine Steuerung durch Faktoren, die in der Vergangenheit gewirkt haben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.01.2019 um 09.50 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#38797 Theo Herrmann wußte immer, daß er und seine Schüler mit dem Anschluß an den kognitivistischen Mainstream im Grund auf dem falschen Dampfer waren. Man kann gut beobachten, wie dieses Desaster seinen Lauf nahm. In frühen Werken wie dem Lehrbuch der empirischen Persönlichkeitsforschung (Göttingen 1969) übt Herrmann schon dieselbe scharfsinnige Kritik an der Hypostasierung von Konstrukten wie in jenem Aufsatz von 1982 (im ersten Heft von "Sprache & Kognition", also programmatisch so hervorgehoben wie nur denkbar) und beruft sich ausdrücklich auf Skinner (Science and Human Behavior, 1953), den er auch sonst mehrmals anführt. Aber wie auch brieflich an mich eingestanden, konnte er als deutscher Psychologieprofessor damit nicht bestehen und schrieb dann fast ein halbes Jahrhundert gegen seine Überzeugung innerhalb des mentalistischen Paradigmas. Diese Bücher, oft zusammen mit Grabowski, sind nicht gut, sie wiederholen ständig dieselben wenigen Beispiele und kommen nicht vom Fleck. Skinner wird nicht mehr erwähnt (höchstens in Zusammenhang mit Chomskys Kritik), die Begriffe sind nicht operationalisiert, wie doch ursprünglich gefordert. Nicht nur Herrmann selbst ermunterte mich zur Veröffentlichung meiner behavioristischen Texte, sogar eines Verrisses von Herrmann/Grabowski, in "Sprache & Kognition", wo sie quer zum ganzen übrigen Inhalt (außer eben jener Programmschrift) standen, auch sein ebenfalls schon verstorbener Schüler Werner Deutsch, den ich aus Studienzeiten kannte, hatte dafür Verständnis und lud mich zu einem Vortrag nach Braunschweig ein. Die Zeitschrift ging dann bald ein, es ist nicht schade drum. Mir sind die Zusammenhänge jetzt beim Wiederlesen noch klarer geworden, es ist ein Trauerspiel von exemplarischer Bedeutung: das Versinken der (Sprach-)Psychologie im "mentalistischen Sumpf". Allmählich versucht man sich wieder herauszuarbeiten, daher jetzt die Mode mit dem "Embodiment". |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.01.2019 um 16.24 Uhr |
|
Skinners Hauptwerk (neben "Verbal Behavior") "Science and Human Behavior" von 1953 habe ich in einer Ausgabe, die aus der U.S. Army Library Bad Tölz stammt. (Vgl. https://www.usarmygermany.com/Sont.htm?https&&&www.usarmygermany.com/USAREUR_City_BadToelz.htm#Flint) Ein Aufkleber verrät, daß das Buch nach dem USAREUR (U.S. Army Europe) Library Program angeschafft wurde. Solche gebrauchten Bücher sprechen mich oft eigentümlich an. In diesem Fall steckt noch die Leihkarte hinten drin. Das Buch ist 20mal ausgeliehen worden, was man wohl kaum erwarten würde. In unserer Universitätsbibliothek könnte man lange auf den ersten Ausleiher warten, das kann ich nach vielen Erfahrungen mit blitzneuen Büchern sagen, die auch nach 20 Jahren noch niemand gelesen hat, um so mehr, je besser sie sind. Die Unterschriften sind nur teilweise leserlich, der erste Ausleiher war ein Robert Zimmerman, aber Bob Dylan kann es nicht gewesen sein; sonst hätte ich jetzt ein wertvolles Autogramm. Ich denke natürlich daran, wie es den Männern (mindestens eine Frau namens Barbara war auch dabei) heute geht, falls sie noch leben, nach Vietnamkrieg und allem. Aber natürlich haben auch Familienmitglieder die Bibliothek benutzt. 1975 ist als Ausleiher "Base Lib. 09240" eingetragen, wohl eine andere Bibliothek (Fernleihe?). Dann folgen Richard A. Bauer, Dan Marshall... Viele Grüße! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.02.2019 um 08.53 Uhr |
|
Was die Sprache für den Menschen bedeutet, kann man sich an einem Beispiel klar machen, das Skinner vorgetragen hat (wie hier vor einigen Jahren schon erwähnt). Durch die Sprache sind völlig neue, willkürliche Kategorisierungen möglich. Zum Beispiel gibt es keine natürliche Reaktion auf alles, was rot oder rund ist. Kein Tier reagiert einheitlich auf Blut, Tomaten, Feuer, Sonnenuntergänge usw., nur weil sie rot sind. Durch die Sprache wird alles anders: Jetzt gibt es die Reaktion „rot“, „rund“ usw. – Dadurch können wir die Welt unbegrenzt neu strukturieren und dann weiter erforschen, z. B. das Runde berechnen. Wir können gemeinschaftlich daran arbeiten, die Aufmerksamkeit auf bisher nicht bemerkte Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu richten und das Wissen darüber einander mitzuteilen und generationenübergreifend weiterzugeben. Man denkt natürlich gleich an Sokrates und sein „Definitionsbegehren“, ganz mit Recht, aber die Sache selbst ist viel elementarer. Die Gegenstände der Wissenschaft, ob es um elektromagnetische Felder, Koevolution oder Possessivkomposita geht, sind durch lange Entwicklungsgeschichten, die man in diesen Fällen sogar noch nachvollziehen kann, herauspräpariert worden, und nun kann jeder, der sich dafür interessiert, auf dem Erreichten aufbauen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.02.2019 um 20.36 Uhr |
|
Denken und Sprache haben im Wesentlichen die gleiche Struktur, beider Kern ist die Möglichkeit, die Welt mit abstrakter Einstellung zu betrachten. So repräsentieren beide in gleicher Weise das Charakteristische der menschlichen Natur. Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, daß diese Fähigkeit mit verschiedenen Mitteln zum Ausdruck gebracht wird. (Kurt Goldstein: Ausgewählte Schriften. The Hague 1971:465) Kein Wunder. Die Sprache gibt es wirklich, das Denken dagegen ist ein Konstrukt, das nachweislich nach dem Vorbild des Sprechens entwickelt worden ist. Daher sind sie strukturgleich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.03.2019 um 16.01 Uhr |
|
Wie doof muß man sein, um das Rad nicht zu erfinden? In Amerika vor Kolumbus (und Australien) hat man es nicht erfunden, bei sonst erstaunlichen Kulturleistungen, z. B. Schrift. Das ist ein ziemlich großes Rätsel. Warum wurde das Rad nicht überall erfunden und nicht schneller? Jonnie Hughes meint, aus Mangel an Vorstellungskraft im Sinne Poppers: "We must, in fact, possess an imagination, because without one, we couldn’t have a Popperian intelligence." Das ist allerdings eine Petitio principii, denn die Popperschen Wesen sind gerade dadurch definiert, daß sie Problemlösungen an inneren Modellen durchspielen (mentales Probehandeln), was ich bereits mit Skinner als Pseudoerklärung durch einen Homunkulus mit der Folge des unendlichen Regresses zurückgewiesen habe. Erfindungen brauchen eher wegen des Konservatismus der Gesellschaft so lange. Die lebenswichtigen Fertigkeiten wurden an die nächste Generation weitergegeben und waren viel zu wichtig, als daß man irgendwelche Neuerungen, also Abweichungen, hätte zulassen können. Aus diesem Grund blieben Faustkeile Hunderttausende von Jahren unverändert. A Plains Indian upon first sighting a French trapper sitting atop his wheeled wagon may well have thought, just as the eminent Victorian biologist Thomas Henry Huxley thought upon hearing Darwin’s theory of natural selection, ‘How extremely stupid not to have thought of that!’ (On the origin of tepees. New York 2011:188) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.03.2019 um 06.34 Uhr |
|
Die beschleunigte Entwicklung von Wissenschaft und Technik in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten (exponentiell, kann man wohl locker sagen) ist also meiner Ansicht nach nicht auf irgendwelche Veränderungen im menschlichen Gehirn oder "Geist" zurückzuführen, sondern auf Veränderungen im Umgang der Menschen miteinander, insbesondere die Schaffung von Freiräumen, in denen Neuerung und Widerspruch nicht mehr bestraft, sondern belohnt wurden. Man könnte auch sagen, daß die Einführung des Konkurrenzprinzips wie (parallel dazu) in der Wirtschaft den plötzlichen Schub verursacht hat.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 25.03.2019 um 00.20 Uhr |
|
Die immer schnellere Wissensentwicklung wird natürlich durch die gesellschaftlichen Veränderungen begünstigt: Demokratisierung, individuelle Freiheiten, dadurch bessere Lebensbedingungen für alle, bessere Bildung für alle, das alles nützt den Wissenschaften und bringt sie schneller vorwärts. Auch der Konkurrenzkampf wirkt beschleunigend, das ist ganz klar. Aber das Grundprinzip ist viel einfacher. Wissen verzweigt sich wie ein Baum, es wird immer detaillierter. Erst bilden sich drei Zweige am Stamm, dann weitere drei an jedem Zweig und Stamm, und schwubs sind es schon über eine Million Zweige in der 10. Generation. Mehr Wissen ist jeweils die Grundlage für noch mehr Wissen. Es muß einfach explodieren, wenn man es nicht gewaltsam daran hindert.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.03.2019 um 05.13 Uhr |
|
Ein schönes Bild, aber ich bezweifle, wie übrigens die gesamte Wissenssoziologie, die Zwangsläufigkeit und Autonomie dieser Vermehrung des Wissens. Die gesellschaftlichen Umstände sind keine Zutat. Die "Gewaltsamkeit", die Sie mit Recht ansprechen, ist das Entscheidende, auch wenn sie von den Beteiigten nicht als gewaltsam erlebt wird, sondern einfach als die selbstverständliche Norm oder Gewohnheit: Man macht das einfach so, basta. Nachträglich kommen einem die Beteiligten (und auch wir uns selbst) wie vernagelt vor: How stupid... Denkpsychologen haben solche Hindernisse ebenfalls studiert, aber ohne den sozialen Aspekt. Für mich hängt das alles mit den Spekulationen über den Ursprung der Sprache zusammen. Ich bezweifle ja, daß das freie Reden aller mit allen am Anfang stand. Genau wie bei den Affen nicht jeder sich mit jeder paaren darf, durfte auch nicht jeder mit jedem sprechen und nicht immer und über alles. Wie man Faustkeile macht oder Büffel jagt, das ergibt sich nicht (nur) aus der Natur der Sache, sondern steht fest, basta. (Falls der "große Sprung" vor 40.000 Jahren nicht eine optische Täuschung ist, dürfte er kaum in einer plötzlichen Neuentwicklung des Gehirns begründet gewesen sein, sondern in Veränderungen der Sozialstruktur.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.03.2019 um 05.17 Uhr |
|
Jonnie Hughes greift die Schichtenlehre Dennetts auf und unterscheidet Darwinsche, Skinnersche, Poppersche und Dennettsche Lebewesen: HOW DID THE HUMAN CROSS THE ROAD? (THE ´DENNETTIAN´ CREATURES) Fortunately, on many occasions, we humans don´t even have to come up with a plan, because we are Dennettian creatures, named after Daniel Dennett, the American philosopher to whom I owe this entire section; its based, up to this point, on his Tower of Generate and Test, a model that describes the ways different brains react to the problems they encounter. Dennettian creatures can do something far more impressive still than Popperians. We can solve the problem of how to cross the road safely without ever having experienced that situation in our lives before, and we can do it without taking any time to think about it. „How?“ you ask. Simple: someone tells us how. Dennettian creatures are able to „borrow“ the lived experiences of other members of their species. They can either watch or listen to or read about the experiences of fellow Dennettian creatures and then make use of their solutions to Life´s problems. In short: Dennettian creatures cheat; they swap thoughts! While all those jellyfish are chancing that their immediate ancestors have survived similar situations, and the sea slug is crossing its proverbial fingers and plumbing for one of the few behaviours it can muster, and the chicken is standing there thinking about what to do next, we, the crème de la crème of Dennettians, can just shout across the road to someone who has already solved the problem and get their thoughts on the best way to do it. „I should go to the top of the hill if I were you. The cars slow down as they climb; you´ll be able to see them for miles, and there are far fewer jellyfish.“ (Jonnie Hughes: On the origin of tepees. New York: Free Press; 2011:30) Geht das nun zwei Stufen über Skinner hinaus? Bei Skinner steht: The development of environmental control of the vocal musculature greatly extended the help one person receives from others. By behaving verbally people cooperate more successfully in common ventures. By taking advice, heeding warnings, following instructions, and observing rules, they profit from what others have already learned. Ethical practices are strengthened by being codified in laws, and special techniques of ethical and intellectual self-management are devised and taught. Self-observation or awareness emerges when one person asks another a question such as “What are you going to do?” or “Why did you do that?” The invention of the alphabet spread these advantages over great distances and periods of time. (Upon further reflection. 1987:54) Dies hat also durchaus seinen Platz in Skinners Psychologie. Ich habe es unter den Funktionen der Sprache schon erörtert. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.03.2019 um 07.17 Uhr |
|
Man denkt ja gewöhnlich: Wenn das „Prinzip“ der Sprache einmal entdeckt ist, dann kann jedes Kind eine voll ausgebaute Sprache spontan entwickeln. Diese Illusion wird durch Berichte über vermeintlich spontan entstandene Sprachen verstärkt (Al-Sayyid usw.). Wer „Proto-Sprachen“ ansetzt, denkt sich eine einfache, aber unbegrenzt produktive Syntax aus, und warum sollte der ohnehin wenig bedeutsame Wortschatz nicht nach Bedarf unendlich vermehrt werden? Dieses rationalistische Bild scheint mir ganz falsch zu sein. Wie begrenzt unsere Alltagssprache ist, sieht man übrigens daran, daß sie kaum Nebensätze oder Genitive zuläßt. Es gehört sich einfach nicht, wie so manches andere. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.04.2019 um 08.12 Uhr |
|
Wörter wie Qi, Prâna, Pneuma, Lebenskraft bezeichnen keine wirklichen Objekte, sind aber weder sinn- noch funktionslos. Als man noch sehr wenig über das Leben und den Organismus wußte, mußte man gleichwohl mit diesen hochkomplexen Systemen zurechtkommen und "erfand" – sicher im Laufe von Jahrtausenden – fiktive Gegenstände und Modelle, eben Konstrukte, nützliche Fiktionen also. Wir atmen, solange wir leben, und der Atem trägt die Stimme. Der biologische Sinn des Atmens ist im Gegensatz zu Essen und Trinken nicht ohne weiteres erkennbar. Auch die Entstehung des Windes ist unklar. Obwohl das Qi eine Fiktion ist, hat die darauf beruhende Praxis reale Wirkungen: Medizin (Akupunktur) Meditation und Gymnastik, Fengshui usw. Chinesische Naturwissenschaftler und Techniker machen sicher keinen Gebrauch vom Qi, aber das schließt nicht aus, daß sie den Begriff in anderen Lebensbereichen anerkennen; auch bei uns sind die Ansichten der Menschen nicht widerspruchsfrei, sondern nach „Abteilungen“ getrennt. Qi is a non-scientific, unverifiable concept. A 1997 consensus statement on acupuncture by the United States National Institutes of Health noted that concepts such as qi "are difficult to reconcile with contemporary biomedical information". (Wikipedia) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.04.2019 um 05.59 Uhr |
|
„So scheinen viele Psychologen ein ernstes Problem darin zu sehen, objektives Verhalten durch subjektive Kognitionen zu erklären, und ‚teleologische‘ Modelle zu verwenden; während sie andererseits im Alltag ständig Verhalten aus Zielen und Planungen voraussagen und durch Pläne vorausbestimmen, etwa wenn sie ihrem Freund den Weg zum Bahnhof beschreiben (d.h. ihm einen Plan übermitteln) und erwarten, daß er daraufhin den richtigen Weg gehen wird (Verhalten voraussagen). Kein vernünftiger Weg führt um die Feststellung herum, daß Menschen zielgerichtet und zielbewußt handeln; daher müssen auch unsere Handlungstheorien vom Zielbegriff ausgehen.“ (Mario v. Cranach et al.: Zielgerichtetes Handeln. Bern 1980:22) Das heißt doch nur: Wenn man sich am Gespräch der Menschen über Handlungen beteiligen will, muß man deren Sprache übernehmen. Außerhalb der Bildungssprache mit ihren mentalen Konstrukten gibt es nur Verhalten, keine Handlung und keine Intentionen. Ich bezweifle aber, daß sich in dieser Begrifflichkeit eine "Handlungstheorie" entwickeln läßt. Dagegen spricht schon das Flickenteppichhafte des folkpsychologischen Vokabulars. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.04.2019 um 21.19 Uhr |
|
„Verbale Äußerungen sind keine Reize, die mechanische Reaktionen verursachen. Wenn wir mit unserem Reden jemanden beeinflussen wollen, so liefern wir immer einen Grund oder etwas Ähnliches dafür, daß er tut, was wir wollen.“ (David Hamlyn: "Verhalten". In: Beckermann (Hg.): 85-105, S. 103.) Vgl. auch: „But rules themselves, like maxims and laws, are not physical objects at all, pace Skinner´s explicit assertion that they are: They are saying types and, as such, are individuated by their content, not their form. A fortiori they are not tokens and cannot function as stimuli.“ (Jonathan Cohen in: Catania/Harnad [Hg.] 1988:237) (Warum eigentlich „mechanisch“? Das verlangt doch niemand, auch nicht der Behaviorist.) Verbale Äußerungen sind Reize mit einer Geschichte, und in dieser Geschichte (Konditionierung) liegt der Grund für ihre Wirkung, nicht in ihrer Form, die zu ihrer Identifizierung beiträgt. Der „content“ entspricht der geheimnisvollen mentalen „Rückseite“ des bilateralen Zeichens (= der Bedeutung). |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 09.04.2019 um 10.46 Uhr |
|
Lieber Prof. Ickler, ich habe noch nicht verstanden, wie Sie bzw. der Behaviorismus damit umgehen, daß der Mensch bei all seinen Handlungen eine Wahl hat. Es ist ja nicht so, daß aufgrund einer langen Konditionierungsgeschichte die Reaktion auf einen Reiz unabänderlich festgelegt ist, nicht einmal, daß sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit feststeht. Der Mensch macht bei der Reaktion auf jeden Reiz von seinem Wissen, seinen Erfahrungen, seiner Intuition Gebrauch, oft ist die Reaktion auch von der aktuellen Laune oder von konkreten Umgebungsbedingungen abhängig. Ein Reiz setzt zunächst einmal das Denken in Gang, der Mensch entscheidet, wie er reagiert. Er hat eine Wahl. Bei Ihnen liest sich das für mich immer so, als ob der Mensch aufgrund seiner Konditionierung gar nicht anders könne, als automatisch das Vorbestimmte zu tun. (Ich glaube, D. Hamlyn hat hier statt "mechanisch" auch "automatisch" gemeint, oder vielleicht ist die Übersetzung nicht ganz korrekt.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 09.04.2019 um 11.14 Uhr |
|
Nun habe ich auch hier wieder mentale Begriffe verwendet. Es ist schwer, diese zu vermeiden. Sagen wir einfach, das Verhalten eines Menschen ist nicht durch den Reiz mit einer noch so langen Konditionierung festgelegt. Der Mensch verhält sich unterschiedlich, nicht voraussagbar. Er wählt. Ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll, als daß er (nach)denkt.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 14.04.2019 um 14.32 Uhr |
|
Einerseits Bewußtsein, Denken, Erinnerungsvermögen, Wille, Willensfreiheit, freie Wahl im Denken und Handeln, andererseits Gehirn, Gehirnströme, Nervenzellen, Nervenbahnen, der ganze Organismus – das sind selbstverständlich zwei verschiedene Welten, die man begrifflich auseinanderhalten muß. Daß jedoch eine dieser beiden Welten gar nicht existiert, ist für mich eine unhaltbare Spekulation. Es würde bedeuten, daß der Mensch ein geistloser Automat ist. Also muß es zwischen mentaler und physischer Welt eine Verbindung geben. Ich kann mich an ein bestimmtes Wissen erinnern, kann Erfahrungen (weiteres Wissen) sammeln, Schlüsse ziehen und selbstbestimmend handeln. Logischerweise hat jeder Mensch dieselben Fähigkeiten. Die Wissenschaft sagt aber auch, daß der Mensch aus nichts als materiellen Bausteinen besteht. Also muß die mentale Seite irgendwie mit der materiellen verbunden sein. Wie diese Verbindung genau aussieht, ist eben das Thema von Psychologen, bisher ist dabei anscheinend noch nichts Gescheites herausgekommen. Teilweise bringen Wissenschaftler wohl auch Begriffe, die nur auf einer Seite definiert sind, durcheinander. Am einfachsten kommt mir dabei noch das Problem der Wissensspeicherung vor. Wir haben zwar keine Ahnung davon, wie es geht, aber daß es stattfindet, ist einfach logisch, sonst würde gar nichts gehen. Wie dieser Wissensspeicher (Mensch) sich plötzlich seiner selbst bewußt wird, ist noch viel schwieriger, vielleicht niemals zu erklären, aber daß er dieses Selbstbewußtsein erlangt, ist schlechterdings nicht bezweifelbar. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.04.2019 um 08.28 Uhr |
|
Als Behaviorist sage ich nicht, daß Geist, Bewußtsein usw. nicht existieren, sondern daß dies nicht Gegenstände neben dem Körper, dem Gehirn, den Artikulationsbewegungen usw. sind. Es sind (ich wiederhole mich) "Konstrukte"; als solche existieren sie und haben günstigenfalls einen Nutzen, einen Erklärungswert, zumindest Ordnungswert. Damit verschiebt sich die Frage nach den "Beziehungen" zwischen beiden Bereichen (also das Leib-Seele-Problem, wie man früher sagte). In etwa vergleichbar wäre die Frage, in welcher Beziehung die Intelligenzverteilung oder die durchschnittliche Lebenserwartung zur Gaußschen Glockenkurve stehen. Oder ein wenig anders: Das Bohrsche Modell zum Atom. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.04.2019 um 08.32 Uhr |
|
As Ian Tattersall (1998: 166–73) noted in earlier work, language is a product of the brain, whereas speech is located in the vocal tract. (Alan Barnard: Language in prehistory. Cambridge 2016:8) Was soll das bedeuten? Das Gehirn steuert die Artikulationsorgane in einer bei anderen Tieren noch nicht bekannten Weise (Willkürmotorik). Die Modulierbarkeit der Stimme (und Gestik) unter dem Einfluß anderer Gruppenmitglieder im Dienste der Verständigung nennt man Sprache. Gelernt werden kann es nicht ohne das Gehirn. Die schräge Darstellung oben entspricht dem mentalistischen Bild: Hinter dem Sprechen (parole) steht als zweiter Gegenstand die Sprache (langue), das System. Ich sehe im Sprachsystem die regelhaften Züge des Sprechens, keine zweite "Entität". Hinter dem Apfel, der von Newtons Baum fällt, steht nicht das Gravitationsgesetz, sondern dieses beschreibt den Fall. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 18.04.2019 um 15.56 Uhr |
|
Was berechtigt uns eigentlich, das Bewußtsein, Erinnerungen usw. nur als ideelle Konstrukte, nicht als reale Gegenstände aufzufassen? Wie kann ein Mensch sich ohne reale (abgespeicherte und wiedergeholte) Erinnerung heute so verhalten, daß es zusammen mit dem gestrigen Verhalten einen Sinn ergibt? Wie geht Konditionierung, Lernen, ohne daß das Geübte, Gelernte gespeichert wird? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.04.2019 um 16.31 Uhr |
|
Lieber Herr Riemer, Sie formulieren Ihre Zweifel und Fragen immer so, daß es schwer oder unmöglich ist, darauf zu antworten. Das liegt an den stillschweigenden Voraussetzungen bzw. an dem, was Sie uns Behavioristen unterstellen. Nehmen wir den verhältnismäßig einfachen Fall des Lernens, also der Verhaltensänderung unter der Steuerung durch gewisse Reize, die entweder ein anderer setzt oder die sich aus dem Verhalten selbst ergeben (Lernen am Erfolg). Das wird eifrig untersucht, und man stellt dann die verschiedenen Lernkurven auf, die verschiedenen Verstärkungsintervallen oder -plänen entsprechen. So weit und nicht weiter wagt sich der experimentierende Psychologe Skinnerscher Observanz. Skinner sagt nun in kritischer Absicht, daß der Begriff der Speicherung entweder die Verhaltensänderung nochmals ausdrückt und deshalb tautologisch und überflüssig ist oder daß er mehr behauptet, als man weiß, und dazu noch etwas Irreführendes. Gespeichert wird nicht das neue Verhalten (was ja schon begrifflich unmöglich ist), sondern allenfalls eine Veränderung des Organismus, die aber (wie ich es ausdrücke) keine Ähnlichkeit mit dem gelernten Verhalten hat, ihm nicht isomorph ist usw. Eins meiner Beispiele war die Spur, die ein Gewässer sich im Gelände gebahnt hat; nachfolgende Ströme werden diesem Bett folgen und es weiter ausbauen usw. Warum sollte man diese Veränderung zusätzlich "Speichern" nennen? Man kann jetzt über Hirnvorgänge spekulieren (was aber der Behaviorist gerade nicht tut, deshalb nennt Skinner seine Richtung "radikalen" Behaviorimus). Es ist möglich, daß ein erfolgreiches Innervationsschema eine "Bahnung" bewirkt, so daß bei nächster Gelegenheit dieselben Nervenbündel erregt werden (wahrscheinlich ist die Durchlässigkeit der Synapsen teils erhöht, teils vermindert). Wiederum: Warum sollte man das Speicherung nennen? Damit ist nichts gewonnen. Bücher kann ich speichern und bei Gelegenheit wieder hervorholen; sie waren die ganze Zeit identisch vorhanden. Das ist mit "Erinnerungen" ganz anders. Aber wie gesagt: das muß man gar nicht berücksichtigen, wenn man nicht ernsthaft Neurophysiologie treiben will. Was spricht dafür, die mentalistischen Begriffe als Konstrukte aufzufassen? Sie sind nicht beobachtbar (wir haben schlicht keine Nerven, die dafür geeignet wären). Sie sind in jeder Kultur und zu jeder Zeit grundverschieden und inkommensurabel, nicht übersetzbar. Unsere heutigen Grundbegriffe wie "Bewußtsein" sind ganz jungen Datums. Das "Speicher"-Bild ist bekanntlich eines von mehreren, mit denen Platon experimentiert, um das Erinnern anschaulich zu machen – ohne Erfolg. Ein Speicher erfordert jemanden, der das Gespeicherte heraussucht – wie macht er das? Und wer soll das sein, ein Homunkulus? Das ist alles durchexerziert worden. Ich bleibe also bei dieser Aufteilung: Der Psychologe untersucht das Verhalten des Organismus und seine Veränderung unter kontrollierten Einflüssen. Der Neurologe untersucht die Vorgänge im Gehirn und ihre Veränderung beim Lernen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.04.2019 um 05.08 Uhr |
|
Das sogenannte Denken wird fast immer nach dem Muster des Sprechens modelliert. Verbreitet ist die Auffassung des Denkens als eines „Gesprächs der Seele mit sich selbst“ (Platon Soph. 263e). Zu einem Gespräch gehören allerdings zwei, und so wird auch für das innere Abwägen eine Spaltung angesetzt, so daß z. B. die „Stimme des Gewissens“ als zweite Instanz angenommen wird (Michael Billig erwägt es). Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß Argument und Gegenargument vom selben Subjekt vorgebracht werden. Ein Streitgespräch der Seele mit sich selbst ist so wenig ein echtes „agonales“ Gespräch, wie ein Gedankenexperiment ein echtes Experiment ist. Es fehlt das Widerständige des „anderen“. Um das Für und Wider einer Sache abzuwägen, brauche ich keine zwei Instanzen anzunehmen, sondern das tue ich jederzeit beim Überlegen. Ein wirklicher Gesprächspartner ist nicht einfach die Hypostasierung eines Vertreters bestimmter Behauptungen, sondern eine Person mit einer unendlich komplexen Konditionierungsgeschichte. Es gibt zwar maschinelle Dialogsimulationen, sie werden aber erst dann lebensecht wirken, wenn das digitale Gegenüber eine ähnliche, auf Erfahrungen gegründete Komplexität und damit Unberechenbarkeit erhält wie ein wirklicher Mensch. Die IPA-Entwickler arbeiten dran. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.04.2019 um 08.41 Uhr |
|
Gegen die "Zeicheninflation", die herkömmliche Zeichentheorien unbrauchbar macht (ich habe es am Beispiel Rudi Kellers gezeigt) muß man immer wieder auf der genetisch-historischen Perspektive bestehen. So sehen es auch die Biologen: An important distinction can be made between a cue and a signal. Like signals, cues can provide information to others. For instance, the rustling of a mouse as it forages in the undergrowth is a cue that may convey information to a predator about the mouse’s location. However, this information is purely a by-product of the mouse´s foraging activity: the rustling was not shaped by natural selection to convey that information. In contrast, signals have been shaped by natural selection for the specific purpose of conveying information and thereby influencing others’ behavior, ultimately impacting both the signaler’s and the recipient’s fitness. (Mark E. Laidre/Rufus A. Johnstone: Animal signals. Current Biology Vol 23 No 18, R829-R833 - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982213009317) Cue könnte man hier mit "Anzeichen" übersetzen, signal mit "Zeichen". Aus der Sicht des "Empfängers" gibt es keinen Unterschied, aber für eine naturalistische Analyse ist die Unterscheidung das A und O. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 23.04.2019 um 02.24 Uhr |
|
Auch der Philosoph Fred Dretske behauptet, daß natürliche Zeichen etwas bedeuten ... Folglich ist alles Zeichen, der Begriff hat nichts Unterscheidendes mehr. ... ... die Zeicheninflation macht die ganze Theorie zunichte 1240#39915 Wie viele Zeichen gibt es eigentlich insgesamt? Wenn es theoretisch unmöglich ist, eine vollständige Liste aller Zeichen anzugeben, was ich annehme, dann kann es unendlich viele geben. Haben wir also nicht sowieso schon eine "Zeicheninflation"? Wenn alles, was eine Bedeutung hat, ein Zeichen wäre, wenn alles für irgendetwas stünde, dann wäre es eben so. Eine Zeicheninflation allein wäre weder eine Widerlegung dieses Zeichenbegriffs noch machte sie ihn sinnlos. (Solange der Autofahrer Auto fährt, braucht er nur die für ihn interessanten Zeichen zu beachten, die unendlich vielen anderen stören ihn überhaupt nicht.) Der Saussuresche Zeichenbegriff besagt m.W. u.a. nur, daß jedes Zeichen eine Bedeutung hat, aber nicht, daß hinter jeder Bedeutung ein Zeichen steckt. Z. B. zeigen rote Flecken nicht eindeutig Masern an, sind also auch kein entsprechendes natürliches Zeichen. (Eines unter vielen Anzeichen für Masern vielleicht, wenn man Anzeichen so definiert.) M. E. muß man den zweiseitigen Zeichenbegriff so verstehen, daß die Bedeutung eines Zeichens eindeutig festgelegt ist. Dann kann man auch nicht jede beliebige Sache ein Zeichen nennen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 23.04.2019 um 10.46 Uhr |
|
Die roten Flecken bedeuten irgendetwas, folglich sind sie Zeichen für irgendetwas. Da alles irgendetwas bedeutet, sind es alles Zeichen. Auf diese Art kann man keinen Widerspruch erzeugen, denn die Prämisse ist falsch. Niemand behauptet, daß alles was irgendeine Bedeutung hat, ein Zeichen ist. Die Behauptung ist, daß jedes Zeichen eine (eindeutige) Bedeutung hat. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.04.2019 um 14.17 Uhr |
|
Sie haben recht, die Inflation allein macht das Geld nicht wertlos; denn auch wenn eine Briefmarke 40 Millionen Reichsmark kostet (solche hatte ich als Kind in meiner leider verlorenen Briefmarkensammlung), kostet sie doch immerhin noch ETWAS. (Ich komme darauf zurück.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 23.04.2019 um 16.12 Uhr |
|
Vor allem meinte ich eigentlich, daß der Vorwurf einer Zeicheninflation sowieso nicht zutrifft, weil m.E. lange nicht alles nach der Saussureschen Theorie ein Zeichen ist, was von ihren Gegnern als solches verspottet wird.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.04.2019 um 08.44 Uhr |
|
Wo beginnt und endet das Zeichenhafte? Der Duft von Blüten und Stinkmorcheln hat sich entwickelt, um Bienen bzw. Fliegen anzulocken (in einem evolutionär aufgeklärten Sinn der teleologischen Darstellung). Sie verbreiten die Pollen bzw. Sporen. Der Duft ist also zeichenhaft. Daß auch Elefanten sich an Blumen erfreuen, ist eine Nebenwirkung. Wie steht es mit dem Geschmack? Bei einigen Früchten bezweckt er den Verzehr durch Tiere, die dann den Samen ausscheiden und verbreiten. Bei vielen Pflanzen ist der Wohlgeschmack ein Nebenprodukt von Stoffen, die eigentlich der Schädlingsabwehr dienen, so die vielen ätherischen Öle in Pfefferminze usw. Ebenso die Gifte in Tabak und Kaffee, die wir als Drogen nutzen. Die Stacheln der Opuntien wehren Freßfeinde ab, andere Bewehrungen gewähren nützlichen Freunden Schutz. Daran ist nichts Zeichenhaftes. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 26.04.2019 um 13.27 Uhr |
|
Indem ein Tier den Geschmack einer Frucht wahrnimmt, hat es schon getan, was es sollte, es hat die Frucht gefressen. Da bleibt nichts mehr zu zeigen, ein Zeichen ergäbe keinen Sinn. Also, nehme ich an, hat der Geschmack im Gegensatz zum Duft für niemanden etwas Zeichenhaftes? Tiere haben natürlich gelernt, vorher zu "wissen", welche Früchte wie schmecken, und Pflanzen haben ihren Geschmack auf die Vorlieben der für sie nützlichen Tiere eingestellt. Also ist Geschmack zwar kein Zeichen, er "bedeutet" nichts, hat aber dennoch den Zweck, Tiere zum Fressen zu verführen. Nicht Zeichen, sondern irgendein Hilfsmittel. Sehe ich das so richtig? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.05.2019 um 05.11 Uhr |
|
Ein „Mental Map“ ist eine vereinfachte und subjektive Abbildung unserer mehrdimensionalen komplexen Realität. Wir alle speichern die Räume, die wir nutzen, als landkartenähnliche Bilder. (...) Über jeden Raum entstehen subjektive Karten, die wir in unserem Kopf speichern. (http://www.was-schafft-raum.at/download/1-2_mental%20map.pdf) Das wird in Schulen gelehrt. Die Redeweise vom „Kopf“, in dem etwas „gespeichert“ werde, läßt keinen Zweifel an der realistischen Deutung. Die Verfasserin, eine Architektin, hat offenbar keine Ahnung von den begrifflichen Schwierigkeiten. Es gibt zahllose Anleitungen, wie man mentale Karten anfertigt und benutzt, natürlich auch mit Hilfe kommerzieller Angebote. Die Zeichnung auf dem Papier wird ebenfalls „mental“ genannt. Um sich räumlich zu orientieren, erschaffen Menschen eine kognitive Karte in ihrem Kopf. Diese Karte zeigt unter anderem, wo sie selbst sich im Verhältnis zu einem bestimmten Ort befinden. Dadurch können sie den Weg zur Küche finden, ohne dass sie in diesem Moment die Küche sehen können. Diese Fähigkeit geht durch eine Demenz zunehmend verloren. (Deutsche Alzheimer Gesellschaft https://www.deutsche-alzheimer.de/unser-service/archiv-alzheimer-info/ohne-kognitive-karte-den-weg-finden.html) Diese volkstümliche Psychologie ist eine Weltmacht, man kann zur Zeit nichts gegen sie ausrichten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.05.2019 um 13.27 Uhr |
|
Susan Blackmore feiert die „sensomotorische Theorie des Sehens“ von Kevin O’Regan und Alva Noë: „Ihrem völlig neuen Ansatz zufolge ist Sehen keine innere Darstellung der Welt, sondern eine Form des Handeln in der Welt.“ (Bewusstsein:107) Was soll daran neu sein? Es ist die Grundlage des Behaviorismus: „Seeing is behaving and, like all behaving, is to be explained either by natural selection (many animals respond visually shortly after birth) or operant conditioning. We do not see the world by taking it in and processing it. The world takes control of behaviour when either survival or reinforcement has been contingent upon it. That can occur only when something is done about what is seen. Seeing is only part of behaving; it is behaving up to the point of action.“ (Skinner: The Origins of Cognitive Thought. Recent Issues 1989) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.05.2019 um 06.10 Uhr |
|
Noch etwas von Frans de Waal: In einer Besprechung von Robert Sapolskys „Behave“ schreibt er: „Sapolsky remains mercifully brief about B. F. Skinner and his followers, who dominated behavioral science with strikingly unbiological approaches for most of last century. We clearly have left these ideas behind.“ Was meint er nur? Gilt das operante Konditionieren nicht mehr? Oder spricht er nur den Chomskyschen Erledigungstopos nach? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.05.2019 um 04.05 Uhr |
|
Susan Blackmore zweifelt am Bewußtseinsstrom und führt auch empirische Befunde an, die ihm widersprechen. Man könnte immer noch sagen, daß die Illusion als solche aber ein unwiderlegbares Phänomen sei. Auf dessen Evidenz als Ausgangspunkt der Psychologie haben sich die Psychologen und Philosophen nicht erst seit William James berufen. Nach Blackmore beantworten wir die Frage nach unserem Bewußtsein nur dann, wenn sie uns gestellt wird, während wir in der ganzen übrigen Zeit nichts darüber sagen können. Das ist richtig: die introspektive Rede ist eben ein Verständigungsmittel zu bestimmten Zwecken. Wir können auch nicht rückblickend sagen, wie es sich die ganze Zeit mit uns verhalten hat, in der wir nicht darauf geachtet haben. (Über das Nichtbeachtete, den „Hintergrund“, zu sprechen ist unmöglich.) Analog ist die Sehwelt nicht als Kontinuum lückenlos gegeben, sondern wir können bei Bedarf immer wieder überall hingucken, zwischendurch sehen wir aber viel weniger, oft gar nichts. Die Entsprechung von Blickstrahl – wie die Phänomenologen sagen – und Aufmerksamkeits-Scheinwerfer ist schlagend. In beiden Bereichen sind die Psychologen seit langem bemüht nachzuweisen, was uns alles entgeht, im peripheren Sehen, im blinden Fleck einerseits, bei change blindness, Gorilla-Videos usw. andererseits. Das Ergebnis ist immer, daß die erlebte Geschlossenheit und Vollständigkeit – des Sehfeldes wie des Bewußtseins – eine Illusion ist, wenn auch eine praktisch nützliche, die „wir konstruieren“. Die Welt um uns herum ist ja wirklich so lückenlos, wie wir sie uns einbilden. Der Zusammenhang mit der Sprache wird gewöhnlich übersehen: die „Konstruktion“ ist eine sprachliche Veranstaltung und damit auch eine gemeinschaftliche. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.07.2019 um 04.44 Uhr |
|
Nach dem Neurologen Robert Sapolsky war der Pilot, der eine Passagiermaschine gegen eine Felswand steuerte und 149 Menschen mit in den Tod riß, nicht für sein Tun verantwortlich; er war ebenfalls Opfer seiner Krankheit, einer Depression. https://www.focus.de/panorama/welt/es-war-nicht-er-der-das-getan-hat-neurologe-sicher-andreas-l-ist-kein-taeter-sondern-ein-opfer_id_4590759.html Die Empörung sollte nicht seiner These gelten, sondern der Tatsache, daß er als Neurologe über Schuld und Verantwortung spricht, Begriffe, die in seinem Fach nicht vorkommen (nicht vorkommen sollten). Hätte der Pilot durch Zureden von seinem Tun abgehalten werden können? Daran zweifelt wohl niemand. Auch Depressive sind mehr oder weniger ansprechbar. Weil der Mann etwas wollte, konnte er auch anders, das gehört zum Begriff des Willens. Und der Wille ist mit der Sprachfähigkeit gegeben. Auch Richter schieben die Frage der Schuldfähigkeit gern auf Gutachter ab; das sollte man ihnen nicht durchgehen lassen. Und umgekehrt sollte man Neurologen usw. nicht abnehmen, was sie über Moral und Zurechenbarkeit sagen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.07.2019 um 15.26 Uhr |
|
Auf dem Flachbildschirm im Wartezimmer des Arztes läuft ein Video über Ohr-Akupunktur. Es wird als Tatsache dargestellt, daß in der Ohrmuschel der ganze Körper abgebildet sei, mit Dutzenden von Punkten für „Organe, Körperteile und Funktionen“. Linderung und Heilung wird versprochen, teilweise auch „sofortiges“ Nachlassen der Schmerzen. Die Praxis bietet das an, natürlich gegen Selbstzahlung, weil die Kassen es (mit wenigen Ausnahmen) trotz aller Lobbyarbeit noch nicht übernehmen. Eine Abbildung des Körpers soll nach ähnlichen magischen Vorstellungen auch auf den Fußsohlen, im Gesicht, in der Handschrift usw. vorliegen. Physiologisch hat das keinen Sinn, und bei einer „symbolischen“ Darstellung müßte man fragen, wie und zu welchem Zweck sich etwas derartiges hätte entwickeln können. Außerhalb des Klassenzimmers herrscht, aus der Sicht der Wissenschaft, der wilde Westen. Es ist, als gäbe man den Leuten zu verstehen: Vergeßt alles, was ihr gelernt habt! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.08.2019 um 17.10 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#37957 Der sonderbare erste Satz des Eintrags ist inzwischen geändert: Lautes Denken ist die hörbare Verbalisierung des Denkens. Aber das Ganze ist immer noch verkorkst. Direkte Verbalisierung: die innere Stimme wird hörbar gemacht, also das laute Denken im engeren Sinne. Der Proband spricht alles aus, was ihm beim Bearbeiten einer Aufgabe durch den Kopf geht. Keineswegs alles, und das Ganze ist umgekehrt: Denken in diesem Sinn ist stummes (zum Verstummen gewordenes) Sprechen, und nur das kann wieder laut werden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.08.2019 um 04.34 Uhr |
|
„In the 1950s, researchers thought that children learn language through imitation, guided by principles of shaping and reinforcement (Skinner, 1957).“ (Brian MacWhinney: Language Emergence) Wie ist es möglich, daß ein angesehener Wissenschaftler einen solchen Unsinn schreibt und nicht einmal den Widerspruch zwischen Imitation und Shaping bemerkt? Der Verfasser ist unverschämt genug, Skinners Werk in der Bibliographie anzuführen, obwohl er es nicht gelesen haben kann. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.08.2019 um 09.24 Uhr |
|
Der Mensch soll ja ein instinktreduziertes Mängelwesen sein. Das Experimentum crucis mit dem Spracherwerb (Psammetich, Kaiser Friedrich II. usw.) ist gescheitert, aber wie ist es mit anderen, noch elementareren Verhaltensweisen? Würden die Höhlenkinder wirklich von sich aus darauf kommen, was sie miteinander anstellen müssen, um sich fortzupflanzen? Wüßten die Frauen, daß sie das Neugeborene anlegen müssen? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.08.2019 um 05.48 Uhr |
|
Kleine Kinder unterscheiden bereits zwischen belebten (personhaften) und unbelebten Objekten. Sie wundern sich nicht, daß Personen etwas können, was Dinge nicht können (z. B. an unerwarteten Orten auftauchen). Paul Bloom hat sich besonders damit beschäftigt. Schlafende Erwachsene sind Kindern oft unheimlich. Sie wissen zwar, daß sie selbst auch schlafen, aber was das eigentlich ist, wissen sie nicht, weil sie es ja nicht erleben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.08.2019 um 04.43 Uhr |
|
Unlike many other human traits such as humor, art, dancing or music the survival value of language is obvious; it helps us communicate our thoughts and intentions. Es ist nicht nötig, einen bestimmten Autor anzugeben, fast jeder könnte es so oder ähnlich gesagt haben. Nur wenige zweifeln, etwa Rafael E. Núñez. Die Menschen haben die längste Zeit nicht erfolgreicher gelebt als die anderen Primaten, der Vorteil der Sprache kann nicht überwältigend gewesen sein. Die Menschen haben Musik, Religion und anderen cheese-cake (Pinker) entwickelt, aber immer am Rande der Auslöschung dahinvegetiert. Daraus kann man schließen, daß sie das volle Potential der Sprachlichkeit nicht ausgeschöpft haben, vor allem nicht die Akkumulation von technischen Fertigkeiten. Dazu war ein soziales Klima der Verstärkung von Neuerungen nötig. Das war offensichtlich nicht gegeben, sonst hätte man nicht 500.000 Jahre lang dieselben Faustkeile hergestellt. Heutzutage geht der Modellwechsel bekanntlich schneller... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.08.2019 um 05.17 Uhr |
|
Man hat daran erinnert, daß zwischen dem ersten Bogen (Jagdbogen) und der ISS nur etwa 20.000 Jahre liegen. Der Mensch hat sich körperlich seither so gut wie nicht verändert, d. h. auch der Steinzeitmensch hätte grundsätzlich über Intelligenz und Geschicklichkeit verfügt, zum Mond zu fliegen und Smartphones zu bauen, wie heute die Angehörigen ähnlich lebender Völker. Den Fortschritt nehmen wir als selbstverständlich hin, aber das Beharren wird um so erklärungsbedürftiger. Ich vermute also, daß es der Preis der Stabilisierung durch Rituale, Tabus, Rangordnung war, und interessiere mich für die sprachliche Seite dieses Konservatismus (Verteilung des Rederechts usw., weniger die Struktur der Rede). Vgl.: Stanley H. Ambrose: „Paleolithic technology and human evolution“ (Science 291, 2001:1748-1753) . An der Verbreitung des Smartphones (von Null auf zwei Milliarden in zehn Jahren) kann man auch sehen, welche Dynamik das kapitalistische Wirtschaften entfesselt. Prämierung des Neuen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.09.2019 um 07.33 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#39915 Nach Grice, Dretske u. a. ist der Rauch ein natürliches Zeichen für Feuer, Fingerabdrücke, Masern usw. sind natürliche Informationsträger und daher Zeichen. Der Stand des Quecksilbers in einem Thermometer ... Die Fußspuren usw. „enthalten“ so viel Information, wie man gelernt hat, aus ihnen zu entnehmen. Man selbst hat sich durch das Lernen verändert. Dieser Informationsbegriff ist rein technisch, mathematisch, hat aber nichts mit Semiotik zu tun. Spuren sind Muster, einige Muster sind Zeichen. Dazu werden sie durch ihre Geschichte, nicht durch ihre Deutung. Die Auswertung von Mustern ist ein Lernen, das den auswertenden Organismus verändert, nicht die ausgewerteten Muster. Das ist wie mit den schon gelesenen Büchern Karl Valentins. Gelesene und ungelesene Bücher bilden keine zwei Kategorien von Büchern, weil der Unterschied nicht in den Büchern, sondern im Leser liegt, also: Gelesenhaben vs. Nichtgelesenhaben, nicht Gelesensein vs. Nichtgelesensein. (Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#31975) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.09.2019 um 05.18 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#24148 Es ist kein Zufall, daß auch das Kinderspiel "Ich sehe was, was du nicht siehst" fast immer mit der unnatürlichsten Kategorisierung überhaupt arbeitet, nämlich der Farbe. Vgl. die Darstellung unter https://www.spielewiki.org/wiki/Ich_sehe_was,_was_du_nicht_siehst – wo gar nichts anderes in Erwägung gezogen wird. Darum wählt Skinner die Farbe, um die vollkommene Willkür der Abstraktion zu illustrieren. Farbenblinde sind zwar leicht beeinträchtigt, aber (wie Linkshänder) nicht "behindert". Manchmal erfährt man von einem Bekannten erst nach Jahren, daß er rot-grün-blind ist. Zu den klassischen Fragen der Philologie gehört, ob Homer farbenblind war, wegen der merkwürdigen Bezeichnungen für das Meer usw. – Andererseits sind bei ihm junge Männer und Frauen (diese auch auf Vasenbildern) blond, ältere Männer wie Odysseus und auch Zeus schwarzhaarig. Das kann man nur erklären, wenn man Farbe eher für etwas Symbolisches hält. Ähnlich wie in der ägyptischen Kunst wichtige Personen größer sind (Bedeutungsperspektive). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.03.2020 um 07.04 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#41115 (usw.) Dawkins hat die klassische Evolutionstheorie insofern neu gedeutet, als er das Gen und nicht den Organismus bzw. die Art als Subjekt der Ausbildung von Überlebensstrategien auffaßte. Darüber streiten die theoretischen Biologen immer noch, und ich will mich nicht einmischen. (Das Corona-Virus ist ein Anlaß, sich wieder damit zu beschäftigen.) Mit dem "Mem" hat er das evolutionäre Modell auf kulturell, also gesellschaftlich geformte Verhaltenseinheiten ausgedehnt. Dennett hat besonders in seinem neuen Buch ("From Bach...") diese von ihm entschieden unterstützte Theorie sehr gut dargestellt. Meme sind Verhaltenseinheiten, die wiederholt, nachgeahmt, vorgemacht, belohnt, unterdrückt und kommentiert werden können. Wer nicht Mem sagen möchte, bleibt bei Idee, Praxis, Methode, Glaube, Tradition, Ritual o. ä. (so Dennett). Es ist also nichts Neues. Eine besondere Bedeutung hat die Einsicht, daß Meme keinen externen Nutzen haben müssen, um sich zu erhalten und weiterzuentwickeln. Es ist gleichsam so, als hätten sie ein "egoistisches" Interesse daran, sich zu erhalten und fortzupflanzen (durch Stafettenkontinuität). Gesellschaftlich erscheint das als Beharrungsvermögen oder Neuerungsfeindschaft, worin ich, wie gesagt, dann doch einen sekundären Überlebenswert sehe. Faustkeile macht man so und nicht anders, Zelte baut man so, Büffel jagt man so usw. Die dadurch erreichte Stabilität hat das Überleben der Gruppe bisher gesichert und wird es wohl auch weiterhin tun. (Das ist der "konservative" Irrtum, jedenfalls auf längere Sicht, aber verständlich.) Die Moderne (wenn ich das mal so sagen darf) belohnt wenigstens in gewissen, sozial gesicherten Räumen gerade umgekehrt das Neue. Dadurch kommt ein Konkurrenzdruck und Überbietungswettbewerb in die Gesellschaft, der einerseits zu exponentiellem Wachstum in Wissenschaft und Technik führt, aber auch zu manchen Fehlentwicklungen, vor allem Verunsicherungen des alten Adam in uns, der darauf nicht vorbereitet ist (s.o.). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.04.2020 um 10.05 Uhr |
|
Zu den ungelösten Fragen der Biologie gehört: Warum zwinkern wir normalerweise mit beiden Augen gleichzeitig? Die Antwort dürfte ähnlich sein wie bei der Frage nach dem Sinn von Brustwarzen beim Mann: Weil es einfacher ist und die „Natur“ sich nicht die Mühe gemacht hat, diesen Atavismus wegzuretuschieren. (Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#38348) Man denkt leicht, es müsse umgekehrt sein, also aufwendiger, das andere Auge mit dem ersten zu synchronisieren. Möglicherweise ist es außerdem für das Gehirn leichter, den visuellen Eindruck aus beiden Augen zu integrieren, wenn beide Augen synchron arbeiten. Die Fledermaus hält sich gewissermaßen beide Ohren gleichzeitig zu, um nicht vom eigenen Schrei taub zu werden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.04.2020 um 05.41 Uhr |
|
Wenn die Viren nicht so unsympathisch wären, würden die Kreationisten sie zu ihren Lieblingstierchen machen. Wissenschaftler versuchen uns wenigstens eine Ahnung vom unendlich komplexen Zusammenspiel so vieler Faktoren zu vermitteln, das als "reiner Zufall" gewiß nicht erklärbar ist. Nirgendwo sind wir so nahe an einer rein biochemischen Erklärung, und nirgndwo wird deutlicher, daß nur die Evolution Sinn hineinbringt (im Sinne des vielzitierten Wortes von Dobzhansky). Wenn sie nur nicht so verdammt klein wären. Überhaupt die DNS! Wir lesen, daß die DNS in jeder einzelnen Zelle eines "primitiven" Lebewesens zum Beispiel 100mal Platz hätte für die gesamte Encyclopedia Britannica. Das Weltall ist natürlich auf den ersten Blick eindrucksvoller. So voreingenommen sind wir. Ich hatte schon den frommen Gellert zitiert: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1589#39902. Aber jetzt sind erst mal die Viren dran, und jeder weiß, daß wir es nicht mit dem Staunen bewenden lassen dürfen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.04.2020 um 06.26 Uhr |
|
Wie u. a. Dawkins zeigt, kann man Bücher nach beliebig vielen Gesichtspunkten anordnen: nach dem Inhalt, nach der Größe, nach der Farbe, nach dem Verfassernamen usw. Keine dieser Anordungen ist wahr oder falsch. Um ein Buch zu finden, braucht man ab einer gewissen Größe Kataloge, in denen die nichtgewählten Optionen zu ihrem Recht kommen, soweit sie praktisch relevant sind. Lebewesen kann man ebenso anordnen, aber hier gibt es eine Ordnung, die die "wahre" ist. Das ist die auf Abstammung beruhende, "kladistische". Vor Darwin ist die Linnésche Systematik entwickelt worden, und sie enthält aus naheliegenden Gründen unbeabsichtigt auch schon die Grundlage für unzählige Verwandtschaftsbeziehungen. Vieles mußte aber neu geordnet werden. Wie ebenfalls Dawkins anmerkt, kann man Sprachen ebenfalls kladistisch ordnen, wie es die Stammbaumtheorie tut. Anders als bei den biologischen Verzweigungen streben die sprachgeschichtlichen jedoch nicht ausschließlich auseinander, sondern können sich auch wieder vereinigen (Sprachkontakt). Dieser Unterschied macht jenen Theoretikern zu schaffen, die die Verbreitung von Sprachen und Menschengruppen parallel setzen wollen (Cavalli-Sforza u. a.). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.04.2020 um 05.58 Uhr |
|
Das menschliche Auge ist bekanntlich eine Fehlkonstruktion, weil die lichtempfindliche Schicht auf der falschen Seite (hinter den Leitungsbahnen) liegt (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#38348). Was soll man aber erst zum Nervus laryngeus recurrens sagen, der einen solchen Umweg macht (bei der Giraffe 5 m!)? Dawkins führt ihn gern als zweites Musterbeispiel für bad design an und natürlich als Beweis für die Evolution. Unsere fischartigen Vorfahren hatten keinen Hals, und später war es nicht mehr möglich, die Verkabelung vernünftiger zu gestalten. Ein hübsches Beispiel ist auch der scheele Blick der Flundern. Statt von vornherein nach Art der Rochen usw. konstruiert zu sein, haben sich die am Boden lebenden, aber der Form nach den Heringen gleichen Fische auf die Seite gelegt (mal die linke, mal die rechte) und das nunmehr dem Sandboden zugewandte zweite Auge um den Kopf herumwandern lassen. Kein schöner Anblick, aber so ist das Leben. |
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 18.04.2020 um 15.25 Uhr |
|
http://www.si-journal.de/index2.php?artikel=jg21/heft2/sij212-k.html
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.04.2020 um 16.20 Uhr |
|
Danke für den Link! Ich habe den Artikel (und Verlinktes vom selben Autor) mehrmals gelesen, um seine "Design"-Logik zu verstehen, aber vergeblich.
|
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 18.04.2020 um 16.55 Uhr |
|
Ganz begriffen habe ich es auch nicht. Anscheinend treffen die Müllerzellen eine Photonenauswahl für die Rezeptoren, was zu einem besseren Ergebnis führt als eine direkte Einstrahlung. Vielleicht weiß man es aber auch noch gar nicht so genau. Die Fehlkonstruktion ist immerhin umstritten.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.04.2020 um 17.50 Uhr |
|
Wenn man das Beispiel nicht aus dem kreationistischen Zusammenhang herauslöst, wird die Diskussion hoffnungslos. Die Bemerkung von Helmholtz und den Neueren beruht doch auf der nicht ganz ernst gemeinten Unterstellung, ein Auge müsse wie ein Fotoapparat gebaut sein. Das kommt ja auch vor (Kephalopoden). Im Fall des Säugetierauges war es anders, und dann hat "die Evolution das Beste daraus gemacht", sogar etwas sehr Raffiniertes. Die Kamera-Phase ist ja auch nur ein kleiner Teil des Seh-Computers in uns. Die sekundäre Nutzuung eines Zwischenergebnisses der Evolution nennt man auch Exaptation. Geblieben ist der blinde Fleck, aber auch dafür ist ein Ausgleich geschaffen, so daß im Normalfall kein Schaden entsteht. Aber wie gesagt, mit den Evangelikalen kann man nicht reden. Sie wissen immer schon, worauf sie hinauswollen, das ist an anderen Stellen auch bei dem Herrn Ullrich ganz deutlich. |
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 18.04.2020 um 18.20 Uhr |
|
Den kreationistischen Zusammenhang habe ich, ehrlich gesagt, gar nicht bemerkt. Das Stichwort Design hätte wohl einen Herrgottsalarm bei mir klingeln lassen sollen, aber in einer besonders raffinierten evolutionären Konstruktion ein Argument gegen die Evolution zu sehen, lag mir zu fern.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.04.2020 um 20.07 Uhr |
|
Ja, das ist mit unserem normalen Verstand nicht zu begreifen. Für den Nervus recurrens habe ich noch keine ID-Antwort gefunden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.04.2020 um 06.55 Uhr |
|
Sprache und auf ihrer Grundlage dann auch Kultur hat die Menschheit in eine besondere Lage gebracht: weltbeherrschend, allen anderen Arten unendlich überlegen, „sich die Erde untertan“ machend. Aber das hat sehr lange gedauert. Am Anfang können Sprache und kulturelle Akkumulation von Fertigkeiten keinen großen Vorteil geboten haben. Die großen Affen waren wie alle Tiere ziemlich perfekt an ihre Nische angepaßt – wozu sollte Sprache da gut sein? Noch heute können sie nichts damit anfangen, selbst wenn man ihnen eine einfache Zeichensprache beigebracht hat, die sie rein technisch gut beherrschen. Sie teilen weder uns noch einander irgend etwas Neues mit und geben ihre „Errungenschaft“ nicht an ihre Kinder weiter. Es erinnert an Menschen, die zum erstenmal einen Taschenrechner besitzen, dessen Ergebnisse aber doch lieber auf dem gewohnten Abakus nachrechnen. Oder dies: Little Baddow was the site of an anecdote about my grandfather which I think tells us something revealing about human nature. It was much later, during the Second World War, and Grandfather was out on his bicycle. A German bomber flew over and dropped a bomb (bomber crews on both sides occasionally did this in rural areas when, for some reason, they had failed to find their urban target and shrank from returning home with a bomb on board). Grandfather mistook where the bomb had fallen, and his first desperate thought was that it had hit Water Hall and killed his wife and daughter. Panic seems to have sparked an atavistic reversion to ancestral behaviour: he leapt off his bike, hurled it into the ditch, and ran all the way home. I think I can imagine doing that in extremis. (Richard Dawkins) |
Kommentar von Theodor Icker, verfaßt am 20.04.2020 um 05.15 Uhr |
|
Sprachwandel wird oft als kulturelles Analogon der Evolution herangezogen, und eine gewisse Gemeinsamkeit ist unverkennbar: Language evolves, because it has both the great stability and the slight changeability that are prerequisites for any evolving system. (Dawkins) Im übrigen hat aber gerade der am besten untersuchte Kern, der Lautwandel, keinen klaren evolutionären Sinn. Weder sind die Neuerungen zufällig, noch seligiert eine sich ändernde Umgebung (natürlich?, sozial?) die Varianten. Anpassung ist hier nicht erkennbar. Sprache muß sich zwar anpassen, aber das geschieht im Wortschatz, in der Bedeutung und wahrscheinlich in der gesamten Handhabung der Sprache, ihrer logischen Disziplinierung, ihrer Befreiung von irrationalen Funktionen, kurz: in der Ausbildung von Fachsprachen. Die radikalste Verfachlichung finden wir ausgerechnet im antiken Indien: Paninis Grammatik. Wer zum erstenmal damit in Berührung kommt, glaubt seinen Augen nicht zu trauen: Wie war das „between muddle and mystery“ möglich? Vergleichbares im Westen wäre Euklid, aber bei der Mathematik wundert es einen weniger. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.04.2020 um 05.51 Uhr |
|
Es ist entgegen dem Augenschein nicht ausgemacht, daß unser Gehirn sprachspezifische Regionen hat. Es ist immer möglich, daß diese Regionen nur für Sprache mitbenutzt werden. Das Experimentum crucis ist nicht möglich, weil ein Mensch nicht ohne Kommunikation aufwachsen kann. Inwieweit ist also der Mensch auch anatomisch-physiologisch "von Natur ein Kulturwesen"? Ein Problem sind die zeitlichen Dimensionen. Wesentliche genetische Veränderungn ereignen sich eher in "geologischen" als in historischen Zeiträumen. Menschen und Schimpansen trennten sich vor 6 Mill. Jahren, aber wie alt ist die Sprache? Jedenfalls viel älter als das Klavierspielen (für das wir kein Zentrum im Gehirn suchen), aber nicht so alt wie Feuermachen und Milchviehhaltung. Eine genetische Adaptation an den Unterhalt des Feuers scheint nicht ausgeschlossen (mir aber unwahrscheinlich), und was die Milch betrifft, so scheinen sich gewisse Menschengruppen eine Laktosetoleranz zugelegt zu haben, die dann doch recht jung wäre. So könnte sich das Hirn an die Sprachlichkeit des Menschen angepaßt haben (und dann auch umgekehrt wiederum andere sprachliche Möglichkeiten gefördert haben). Aber natürlich keine bestimmten Sprachen oder Sprachtypen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.04.2020 um 06.36 Uhr |
|
Die bekanntesten Werke von Richard Dawkins werden (z. B. bei Wikipedia) als "populärwissenschaftlich" vorgestellt. Das sind sie auch, und Dawkins selbst hat es immer wieder gesagt. "The selfish gene" kommt ohne die Mathematik aus, die man etwa bei Hamilton findet, auf den Dawkins sich oft bezieht und den er zu seinen vier Heiligen zählt. Als sein bestes Buch bezeichnet er "The extended phenotype", das auch wohl am schwersten lesbar ist, gleichwohl immer noch "populärwissenschaftlich". Der Titel (erst recht auf deutsch: "Der erweiterte Phänotyp") zieht natürlich nicht gerade die Millionen an, die das "Egoistische Gen" gelesen haben. Man sollte sich aber nicht abschrecken lassen. Nun aber: Diese beiden Bücher haben durchaus die Beachtung der Fachwelt gefunden, und zwar wie kaum ein anderes Werk seit Darwin selbst, den sie auf den neuesten Stand bringen. Darüber denkt Dawkins selbst an mehreren Stellen nach. Im Gegensatz zu anderen populärwissenschaftlichen Büchern denkt man beim Lesen ständig: Er könnte die Mathematik nachliefern, es ist aber für die Theorie nicht wesentlich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.04.2020 um 06.49 Uhr |
|
Dawkins überlegt, wie die ersten „Replikatoren“ entstanden sein könnten. Er zieht oft die Kristallbildung heran. Wie wir aus der Schule wissen, lagern sich die Ionen in der Kochsalzlösung ihrer Form entsprechend an vorhandene Kerne an und bauen lauter Repliken zu einem würfelförmigen Gebilde auf, alle identisch. So könnten auch organische Moleküle sich aneinander gelagert haben. Oder sie bildeten negative Abdrücke, diese dann wieder positive usw., wie wir es aus der Replikation der DNS kennen. Beim Vorhandensein von Trillionen Bausteinen in der Ursuppe könnte das in einer Milliarde Jahren einmal oder mehrmals passiert sein, und dann wäre es losgegangen. Replikatoren sind stabiler als die anderen Teilchen und würden bald alle überwiegen. Unter (simulierten) gleichen Bedingungen könnten wir das in unserer begrenzten Lebenszeit nicht abwarten, aber mit ein wenig Nachhilfe könnte es gelingen, Leben zu schaffen. Es würde aber sicher nicht das „Alphabet“ des uns bekannten Lebens entwickeln, auch wenn eine andere Basis als der versatile Kohlenstoff schwer denkbar ist.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.04.2020 um 04.49 Uhr |
|
Rauch wird nach Rudi Keller dadurch ein Anzeichen des Feuers, daß ich ihn als Anzeichen des Feuers deute oder nutze (s. o.). Dadurch ändert sich am Rauch aber gar nichts, es wird zu nichts anderem, schon gar nicht wird er zu einem semiotischen Ereignis. Vielmehr bin ich es, der durch die Erkenntnis des Zusammenhangs ein anderer wird. Der Rauch bleibt ein Teil des Bestandssystems „rauchendes Feuer“. Ebenso wie der Fuß, der aus der Lawine ragt (Kellers Beispiel). Ein Topf ist kein Anzeichen und folglich auch kein Zeichen für die Suppe, die vermutlich darin ist. Das ist doch nicht so schwer zu begreifen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.04.2020 um 17.24 Uhr |
|
Anhand der kleinen Pause zwischen dem „Ti-ti-ti-ti-ti-ti“ und dem „Tüüüüüh“ kann man das ungefähre Alter der Goldammer erkennen. (Wikipedia) Ist die Länge der Pause ein Zeichen für andere Goldammern? Für uns ist sie nur ein Anzeichen oder Symptom, also kein wirkliches Zeichen. Ich weiß nicht, ob das bei den Vögeln untersucht worden ist, es dürfte nicht so schwer sein. Überhaupt: was entnehmen die Artgenossen, für die er "bestimmt" ist, aus dem Gesang? Beim Sprechen ist als Zutat meist eine gewisse Dialektfärbung beigemischt, die zwar Symptom ist ("Aha, ein Sachse!"), aber normalerweise keine Zeichenfunktion hat, weil sie sich nicht um der Deutung willen entwickelt hat, also nicht "semantisiert" worden ist. Sie kann aber zeichenhaft verwendet werden, wenn man die Wahl hat. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.04.2020 um 17.52 Uhr |
|
Ich hatte hier schon zitiert: „Die Anerkennung auch der Symptome als semiotischer Vorgänge bedeutet keineswegs eine Entkonventionalisierung der Semiotik, so dass man sie als Sprache Gottes oder des Seins betrachten könnte. Sie bedeutet nur eine Feststellung von Interpretationskonventionen auch in der Art und Weise, wie wir versuchen, Naturphänomene zu entziffern, als ob diese Zeichen wären, die etwas mitteilen. Die Kultur hat nämlich einige Phänomene selektioniert und als Zeichen aufgestellt, weil diese in der Tat unter geeigneten Umständen etwas mitteilen.“ (Umberto Eco: Einführung in die Semiotik. München 1972:30) (Übers. Jürgen Trabant) Hier geht alles durcheinander. Aus allem läßt sich auf etwas anderes schließen (wenn man sich so intellektuell ausdrücken will), aber dadurch wird es nicht zum Zeichen. Deuten kann man es freilich als solches, aber das ist dann oft Aberglaube. Wirkliche Zusammenhänge gibt es zum Beispiel zwischen Fieber und Krankheit, vermutete zwischen Handlinien und Schicksal, nur eingebildete zwischen Vogelflug und politischer Zukunft des römischen Reichs... Symptome "teilen" nichts "mit". Diese Metapher sollte man vermeiden, weil sie nicht mehr zwischen wirklichen und scheinbaren Zeichen zu unterscheiden erlaubt. (Nicht daß ich die Handlesekunst für etwas anderes als Humbug hielte! Ich will aber nicht ganz ausschließen, daß zwischen den Linien und dem sonstigen Körperzustand, auch den erblichen Aussichten, ein gewisser Zusammenhang bestehen könnte. Reine Theorie natürlich.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.04.2020 um 04.17 Uhr |
|
Dawkins hat immer wieder gezeigt, daß ein „halbes Auge“ oder ein „halber Flügel“ besser sind als gar keine Augen und Flügel. Das ist ein gutes Argument gegen die Kreationisten, die ja immer sagen, mit einem halben Auge sei keinem gedient. Ebenso könnte man sagen, daß ein bißchen Sprache besser sei als gar keine. Manche meinen ja, daß die Sprache wie Athene aus dem Haupt des Zeus gesprungen sein müsse, mit allem Drum und Dran. Als wenn, nachdem einmal das „Prinzip“ entdeckt gewesen sei, die Sprache, wie wir sie kennen, sich unweigerlich habe entfalten müssen. Ich nehme das Gegenteil an. Es ist denkbar (aber ein willkürliches Beispiel), daß eine Protosprache 100.000 Jahre lang nur für Wiegenlieder benutzt wurde, bevor man weitere Verwendungsmöglichkeiten entdeckte ("Exaptation"). Auf einer höheren Ebene hat man das als „Ausbau“ bezeichnet und regelrecht „Ausbausprachen“ unterschieden (Heinz Kloss, Nazi-Germanist mit Karriere in der Bundesrepubik).
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.05.2020 um 05.31 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#43396 Die FAZ berichtet etwas fassungslos, daß J. K. Rowling während der Corona-Ausgangsbeschränkung ihre Bibliothek nach der Einbandfarbe umgeordnet hat, und fragt, wie sie denn nun ihre Bücher wiederfinde. Nun, wer seine Bücher liebt und kennt, findet sie auch nach der Farbe, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.06.2020 um 11.28 Uhr |
|
In seinen beiden ersten Büchern (Selfish gene, Extendend phenotype) entwickelt Dawkins die Idee, daß die Gene sich erstens der Körper als „Vehikel“ bedienen, um sich zu vermehren (den Finalsatz im aufgeklärten evolutionären Sinn des Überlebens verstanden), zweitens aber darüber hinaus der Artefakte, ohne die eine Art nicht überleben könnte: Nester, Bienenwaben, Köcherfliegenköcher, Termitenbauten, Biberbauten und -seen usw. Es ist kein wesentlicher Unterschied zwischen dem Schneckenhaus, das mit dem Wachstum der Schnecke entsteht, und dem Schneckenhaus, das der Einsiedlerkrebs sich sucht, oder dem Kokon, den die Raupe sich baut. Die Kultur (die „Meme“) gehört gewissermaßen zum „extended phenotype“ des Menschen. Ohne ein Minimum an Kultur, z. B. Kleidung und überlieferte Technik des Nahrungserwerbs, kann die Art jedenfalls in unseren Breiten nicht bestehen. Diese Kultur muß also ebenso alt sein wie der Homo sapiens selbst. Gehört die Sprache dazu? Ist jenes Minimum ohne Sprache denkbar? Ich glaube es nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.06.2020 um 06.49 Uhr |
|
Das Kastensystem in seiner derzeitigen Form müsse erst relativ spät entstanden sein, folgern die Forscher. Das bestätigt die Rigveda, eine alte hinduistische Schrift. Indiens Kastengesellschaft entstand vor 1900 Jahren Indiens Gesellschaft ist gespalten, das Kastensystem erlaubt nur wenig Mischung. Erbgutanalysen zeigen nun, dass die Spaltung relativ spät begann. (SPIEGEL 9.8.13) Die Herausbildung des indischen Kastensystems fand nach gängiger Einschätzung im 2. Jahrtausend v. Chr. statt, als das Rigveda entstand. (Wikipedia Kaste) (Veda ist maskulin, und der Rigveda ist keine „Schrift“.) Erbgutanalysen können direkt nichts über das Alter der sozialen Institution Kaste herausfinden, höchstens über einige Aspekte wie Endogamie. Für ein hohes Alter der Kasteneinteilung sprechen die „Original Sanskrit Texts I“, die John Muir 1858 herausgegeben hat. (https://ia800301.us.archive.org/27/items/originalsanskrit01muir/originalsanskrit01muir.pdf – dasselbe Exemplar ist auch nachgedruckt bei „Forgotten Books“, aber typographisch unbefriedigend) Nach der Memtheorie (die man dazu aber nicht braucht) entwickeln sich einige kulturelle Subsysteme in Koevolution mit den Genen. So ist die Viehzucht kulturell, die Laktoseverträglichkeit genetisch. Mutually suitable teeth, claws, guts, and sense organs evolved in carnivore gene pools, while a different stable set of characteristics emerged from herbivore gene pools. Does anything analogous occur in meme pools? Has the god meme, say, become associated with any other particular memes, and does this association assist the survival of each of the participating memes? Perhaps we could regard an organized church, with its architecture, rituals, laws, music, art and written tradition, as a co-adapted stable set of mutually assisting memes. (Dawkins) Natürlich „paßt“ alles irgendwie zusammen, aber wenn man will, kann man auch Widersprüche finden. Zum Beispiel stimmen manche Praktiken nicht mit der Doktrin überein. Gerade Dawkins, aber auch andere Religionskritiker (Dennett, Hitchens, Flasch...), aber auch christliche Kirchenkritiker (Garry Wills) haben gezeigt, wie einige Aspekte des Alten und Neuen Testaments von den Kirchen übergangen oder ins Gegenteil verkehrt werden. Freilich könnte man das auch wieder als Herstellung eines geschlossenen Systems deuten – wenn man will... Und diese Beliebigkeit entwertet die Hauptthese. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 14.06.2020 um 02.18 Uhr |
|
Mal noch was Lustiges, Kindermund hatten wir ja hier auch schon. Unsere Enkelin Aurelia (gerade 4 geworden) möchte auf meinem Tablet immer den Zeichentrickfilm zu dem Lied "Alle meine Entchen" sehen und hören. Ihre Schwester Lorelei (5 1/2) kam heute zu mir und sagte: "Du, Opa, ich habe gesehen, daß du Aurelia die Entchen gezeigt hast. Und ich will jetzt Rapunzel sehen!" Tja, da hatte der Opa keine Wahl. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.06.2020 um 08.57 Uhr |
|
Von Autos weiß ich nicht viel, aber mir scheint, daß das sogenannte "Trittbrett", das heute meistens in der metaphorischen Zusammensetzung vorkommt, länger als technisch nötig die Personenwagen geziert hat. Offenbar aus der Kutschenzeit überkommen, sollte es den Einstieg erleichtern, der wegen der Einstiegshöhe früher schwieriger war als heute. Hatte nicht der VW-Käfer noch lange ein solches, freilich bis zur Unbrauchbarkeit schmales Brett? Hat überhaupt jemand seinen Fuß darauf gesetzt? Man scheint lange das Gefühl gehabt zu haben, daß zur einem ordentlichen Fahzeug ein Trittbrett gehört. Andererseits scheint die funktionelle Ausnüchterung manchal zu weit zu gehen. Wenn die Mountainbiker mich überholen, amüsiert mich der Anblick des Dreckstreifens, der sich über ihren Rücken zieht, weil sie kein Schutzblech haben. Würde ein solches das Fahren nennenswert erschweren, oder warum fehlt es? Wer wäscht denn das aus, wenn nicht die Ehefrau, die während der Ausfahrt ohnehin mit der Zubereitung von Sauerbraten und Klößen genug zu tun hatte? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.06.2020 um 07.09 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#43436 Die Kreationisten lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Wie ich gerade sehe, bringen sie es fertig, auch den sonderbaren Verlauf des Nervus laryngeus recurrens noch zu ihren Gunsten zu deuten (Markus Rammerstorfer). Eine rhetorische Glanzleistung. (Berufung auf Erich Blechschmidt gehört dazu.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.07.2020 um 16.52 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#43272 und zum konservativen Charakter der in Stafettenkontinuität weitergegebenen Technik: The role of a public product of problem solving in the accumulation and transmission of folk wisdom is exemplified by a formula once used by blacksmith’s apprentices. Proper operation of the bellows of a forge was presumably first conditioned by the effects on the bed of coals. Best results followed full strokes, from wide open to tightly closed, the opening stroke being swift and the closing stroke slow and steady. Such behavior is described in the verse: Up high, down low, Up quick, down slow – And that’s the way to blow. (Salaman 1957) The first two lines describe behavior, the third is essentially a social reinforcer. A blacksmith might have composed the poem for his own use in facilitating effective behavior or in discussing effective behavior with other blacksmiths. By occasionally reciting the poem, possibly in phase with the action, he could strengthen important characteristics of his own behavior. By recalling it upon a remote occasion, he could reinstate an effective performance. The poem must also have proved useful in teaching an apprentice to operate the bellows. It could even generate appropriate behavior in an apprentice who does not see the effect on the fire. (Skinner: An operant analysis of problem solving) Das beschreibt auch eine sehr alte Funktion der Sprache. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.07.2020 um 05.03 Uhr |
|
Miller, Galanter, Pribram: Strategien des Handelns. Stuttgart 1973 (Plans and the Structure of Behavior, 1960) Im Namenregister der deutschen Ausgabe lautet die einzige Erwähnung Skinners: „Skinner, B. F. siehe Chomsky N. 29“ Das entspricht dem Niveau der Skinner-Rezeption damals und noch auf viele Jahre (wie in meinem Aufsatz dokumentiert). Der Behaviorismus wird als „automatenhaftes Reiz-Reaktions-Konzept vom Menschen“ bezeichnet. Hans Aebli stimmt in seinem hymnischen Vorwort zu. Aebli popularisierte Piaget und machte ihn zum Stoff für die Ausbildung von Lehramtskandidaten. Inzwischen durch andere Moden verdrängt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.07.2020 um 06.33 Uhr |
|
Man kann nicht sinnvoll fragen, was das Denken wirklich ist. Es handelt sich ja um ein folkpsychologisches Konstrukt, also eine nützliche Fiktion, und darüber hinaus hat es keine Wirklichkeit. Man fragt ja auch nicht nach der „Wahrheit über Rotkäppchen“, oder wer Zeus wirklich war. Denken ist ein universales Konstrukt, weil alle Kinder lernen, „für sich zu behalten“, was sie sagen wollen. Die Gründe sind überall dieselben: 1. Ungleiche Verteilung des Rederechts; dabei kommen Kinder zuletzt. 2. Indiskretheit des noch nicht disziplinierten kindlichen Sprechens („Kindermund...“, „Kinder und Narren...“) 3. Kindliches Reden und Dazwischenreden stört: Children should be seen and not heard. Das ist eine der Quellen des Konstrukts „Denken“. In diesem Sinn ist Denken sprachlich, was sich ja auch vielfältig beweisen läßt. Aber weil es unter demselben Namen ein Konglomerat verschiedener Konstrukte gibt, ist der Streit über das Verhältnis von Sprechen und Denken unlösbar, wie jeder Streit um Äquivokationen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.07.2020 um 04.45 Uhr |
|
In Skinner’s public scientific debate with Noam Chomsky, I tended toward the latter though I thought Chomsky approached Skinner rather superficially and unaware of Fred’s fundamental difference from the “stimulus–response” behaviorists. I was amused by a Chomsky story that Fred told. He had come to some Harvard affair with his wife and two daughters. At the end of the formalities, a man came over to their table and he and Fred engaged in friendly, animated conversation. After the man left, one of the daughters asked who he was. When Fred acknowledged that it had been Noam Chomsky, the young woman said, “And you still talk to him?” Of course, their politics were much closer than their theories ever were. (George Mandler: Interesting Times. An Encounter With the 20th Century 1924 – 2002. Mahwah, New Jersey/London 2002:161) Das fiel mir ein, als ich mal wieder in alten sowjetmarxistischen Psychologiebüchern blätterte. Man geniert sich für die Verfasser, weil sie bei jeder Gelegenheit ihre vulgären Sprüchlein anbringen, mit Engels und Lenin als Universalgelehrten und unvergänglichen Autoritäten. Den Behaviorismus darf man nicht erwähnen, ohne ihn "reaktionär" zu nennen, was besonders komisch ist, wenn man den eingefleischten metaphysischen Dualismus der offiziellen marxistischen Doktrin bedenkt. Noch Adorno und die anderen Salonmarxisten finden den Wiener Kreis reaktionär, obwohl die meisten Mitglieder zum Sozialismus neigten. Die Vergabe von Etiketten bei sonst gebildeten und intelligenten Menschen ist peinlich. All dies trägt zur Verstaubtheit einer ganzen Epoche bei. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.07.2020 um 16.09 Uhr |
|
LAD (Language acquisition device) Von Noam Chomsky (...) postulierter spezieller menschlicher Mechanismus zur Erklärung des Phänomens, dass Kinder, obwohl die sprachlichen Äußerungen ihrer Umwelt nur einen defizitären und unvollständigen Input darstellen, die syntaktischen Regeln ihrer Muttersprache in verhältnismäßig kurzer Zeit beherrschen und eine fast unbegrenzte Menge grammatischer Ausdrücke erzeugen und verstehen können. Jedes Kind ist mit einem angeborenen Schema für zulässige Grammatiken ausgestattet (...) und mit einem System von kognitiven Prozeduren zur Entwicklung und Überprüfung von Hypothesen über den Input. So formuliert das Kind Hypothesen über die grammatische Struktur der gehörten Sätze, leitet Voraussagen von ihnen ab und überprüft diese Voraussagen an neuen Sätzen. Es eliminiert diejenigen, die der Evidenz widersprechen und validiert diejenigen, die nicht durch ein Einfachheitskriterium eliminiert wurden. Dieser Mechanismus wurde mit dem ersten Input in Gang gesetzt. Das Kind leistet somit eine Theoriebildung, die derjenigen eines Linguisten vergleichbar ist, der eine deskriptiv und explanativ adäquate Theorie einer Sprache konstruiert. (Hadumod Bußmann: Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart 2002:622) Diese Darstellung liest sich wie ein Karnevalsscherz. Sie findet sich fast wörtlich so bei McNeill. Man sehe sich einen Säugling an und versuche zu denken, daß er Hypothesen über die Struktur der elterlichen Sprache formuliert. Es muß wohl metaphorisch gemeint sein, aber dann verliert es jeden Wert. Der Säugling verhält sich dann nur noch so, als ob er Regeln aufbaute usw. Und doch hat es so oder ähnlich lange Zeit in ernsthaften Büchern gestanden, mitsamt den halbübersetzten Chomskyschen Termini wie „explanativ adäquat“, die man seit „Syntactic Structures“ nicht anzutasten wagte. Generationen von Studenten haben es nachsprechen müssen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.08.2020 um 11.41 Uhr |
|
"Further research showed conclusively, however, that we do not just learn language but that we are innately ´wired´ to speak." (Richard L. Gregory (Hg.): The Oxford Companion to the Mind. Oxford 1989:73) = Wir könnten die Sprache nicht lernen, wenn wir sie nicht lernen könnten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.08.2020 um 12.03 Uhr |
|
Wenn ein Verhalten regelmäßig belohnt ("verstärkt") wird, ist es nicht sehr stabil, sondern läßt nach, sobald die Belohnung ausbleibt. Dagegen braucht die zufällige Belohnung zwar länger, bis sie das gewünschte Verhalten etabliert hat, aber dann sitzt es viel fester. Schimpansen haben bis zu 4.000 mal ein Verhalten gezeigt, immer "in der Hoffnung auf" Belohnung, um es vermenschlichend auszudrücken (die Hoffnung stirbt tatsächlich zuletzt). Skinner hat diese Erkenntnis zur Erklärung der Spielsucht genutzt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.08.2020 um 04.54 Uhr |
|
Beim Zuwerfen eines Balls muß das Kind die Richtung und die aufzuwendende Kraft „berechnen“, vor allem aber das Loslassen im richtigen Zeitpunkt. Zunächst wird der Ball, weil zu spät losgelassen, senkrecht hochgeworfen oder gar rückwärts, so daß er hinter das Kind fällt. Auch das macht Spaß, so daß die Konditionierung des „richtigen“ Ablaufs stockt. Kinder brauchen lange, bis sie sich auf einer Schaukel selbst in die Höhe bringen. Der Effekt der abwechselnd ausgestreckten und wieder eingeklappten Unterschenkel ist nicht so deutlich, daß er ihre Bewegungskoordination steuern könnte. Man hilft mit Kommandos nach, aber lange vergeblich. So verbingen wir einen großen Teil unseres Lebens damit, die lieben Kleinen "anzustoßen". |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.09.2020 um 05.10 Uhr |
|
The human species took a crucial step forward when its vocal musculature came under operant control in the production of speech sounds. Indeed, it is possible that all the distinctive achievements of the species can be traced to that one genetic change. Other species behave vocally, of course, and the behavior is sometimes modified slightly during the lifetime of the individual (as in birdsong, for example), but there the principal contingencies of selection have remained phylogenic-either physical (as in echo location) or social. Parrots and a few other birds imitate human speech, but it is hard to change the behavior or bring it under stimulus control through operant conditioning. Some of the organs involved in the production of speech sounds were already subject to operant conditioning. The diaphragm must have participated in controlled breathing, the tongue and jaw in chewing and swallowing, the jaw and teeth in biting and tearing, and the lips in sipping and sucking, all of which could be changed through operant conditioning. Only the vocal cords and pharynx seem to have served no prior operant function. They presumably evolved as organs for the production of phylogenic calls and cries. The crucial step in the evolution of verbal behavior appears, then, to have been the genetic change that brought them under the control of operant conditioning and made possible the coordination of all these systems in the production of speech sounds. Since other primates have not taken that step, the change in man was presumably recent. The possibility that it may not yet be complete in all members of the species may explain why there are so many speech disorders – and perhaps even so many individual differences in complex verbal behavior, such as mathematics. (Skinner: The evolution of verbal behavior) Auch die sogenannten Stimmlippen können aber bereits eine Funktion beim Abschließen des Brustkorbs gehabt haben, wie wir es heute noch beim Heben vollziehen und wie es dem Schwinghangler unter unseren Vorfahren genutzt haben muß (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#33413). Die abschließende Bemerkung über Mathematik als Sprachverhalten könnte man zu der Überlegung erweitern, ob die sogenannte Intelligenz nicht in weitem Umfang Sprachfähigkeit ist, wenn man letztere in einem umfassenden Sinn versteht. Der Gedanke, daß keineswegs alle Menschen über die gleiche Sprachfähigkeit verfügen, ist interessant, gerade weil er der durch Chomsky verbreiteten Legende widerspricht. Sie erklärt sich durch dessen Beschränkung auf elementare Syntax. Wenn man den Wortschatz, die Beherrschung von Fachsprachen, das wissenschaftliche Argumentieren hinzunimmt, werden die Unterschiede offensichtlich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.09.2020 um 04.42 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#33413 Auch wenn die sogenannten Sprechorgane ursprünglich nicht zum Sprechen da waren, sondern für diese Funktion nur "exaptiert" wurden, kann man doch annehmen, daß sie genug Zeit hatten, sich auch anatomisch-physiologisch auf Sprache zu spezialisieren. Es gibt eine Koevolution der Organe, so auch in diesem Fall. Zum Beispiel haben die Gehörknöchelchen ihr optimale Leistungsfähigkeit gerade im mittleren Frequenzbereich der Sprechstimme. Das hat schon Gutzmann festgestellt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.09.2020 um 09.10 Uhr |
|
Auch die wirklichen Zeichen haben eine natürliche („physische“) Beziehung zum gesteuerten Gegenstand, aber sie ist „historisch“ vermittelt und im Laufe der Zeit immer indirekter geworden. Der Schlüssel paßt noch ins Schloß, aber der Öffnungsmechanismus kann sich von der physischen Übertragung der manuellen Kraft entfernt haben – hin zur „Information“ auf einer Transponder-Karte. Der Fliehkraftregler wirkt mechanisch auf das Ventil, der Bimetallthermostat nutzt zusätzlich die Wärmeausdehnung; man kann die Steuergröße aber auch messen und digital weiterverarbeiten. Dem genetischen Code, der letzten Endes chemisch wirkt, kann man nicht mehr ansehen, was er eigentlich steuert. Wie die Buchstaben eines Textes folgen die Moleküle der Erbsubstanz gleichförmig aufeinander. So auch die Sprache, besonders in ihrer schriftlichen Form. Ob ein Text „Emotionen“ weckt, ist ihm zunächst nicht anzusehen. (Friedrich Kainz III 432ff. zieht daraus einen Einwand gegen die James-Langesche Theorie der Emotionen: Das Entschlüsseln der Wortbedeutungen sei "cortikal", sie sprächen nicht wie primärer Gefühlsausdruck unmittelbar das Stammhirn an. Das ist ein anderer Ausdruck für die Arbitrarität der Zeichen, ihre "Intellektualisierung" gewissermaßen, oder eben der Unterschied zwischen Blaupause und Rezept...) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.11.2020 um 06.27 Uhr |
|
Die Memtheorie gehört nicht zu den glücklichen Einfällen von Richard Dawkins, und die Popularisierung durch Susan Blackmore und weitere Ausschlachtung durch Daniel Dennett hat ihr auch nicht aufgeholfen. Als Beispiele von "Memen" werden u. a. genannt (hier ungeordnet nach ihrem Auftreten in maßgebenden Texten): Sprache (Wörter usw.), Feuer(machen, -unterhalten), Musik (Musikstücke, Teile davon), Scheunen, Stetsonhüte, Affenhocke, Gott (Gottesglaube), Ideologien, Religionen (und alle einzelnen Lehren und Rituale), Memtheorie, Frisuren, Zigarettenrauchen, Baseballkappen (evtl. verkehrt herum getragen), Rocksaumhöhe, Demokratie, Rechtsfahren, Händeschütteln, Pizza, Coca Cola, Tango, Rad, Gewölbe, Blutrache, rechte Winkel, Schrift, Alphabet, Kalender, Odyssee, Infinitesimalrechnung, Schach, Perspektivezeichnen, Evolutionslehre, Impressionismus, Greensleeves, Lippenlesen, Dekonstruktionismus, Kooperation, Bildung, Umweltschutz, Abrüstung, Gefangenendilemma, Figaros Hochzeit, Moby Dick, arbeitsfreies Wochenende, Mehrwegflaschen, Nachkolorierung, Flugzeugentführungen, Computerviren, Graffiti, Telefonwerbung, „Hustler“-Magazin, Antisemitismus, Durchschnittsnoten... Die Reihe läßt sich unendlich fortsetzen, Milliarden größere und kleinere Ausschnitte der menschlichen Kultur, ob benannt oder nicht, lassen sich herausgreifen. Schon dies weckt wenig Vertrauen in die Theorie: „The problem is that, if memes explain everything, then they explain nothing.“ (Robert Aunger: „What’s the matter with memes?“ In Alan Grafen and Mark Ridley, Hg.: Richard Dawkins: How a Scientist Changed the Way We Think. Oxford 2006:178f.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.11.2020 um 08.14 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#44317 Für Vor- und Frühmenschen glaubt man durch anatomische Untersuchungen ebenfalls feststellen zu können, daß ihr Hörvermögen im selben Frequenzbereich wie heute am empfindlichsten war, also in jenem, der auch die eigene Lautgebung kennzeichnet (3 bis 5 kHz). Das ist auch bei Schimpansen so, aber eben in einem ganz anderen Frequenzbereich. Die Arbeiten von Ignacio Martinez und anderen werden seit Jahren in seriösen Fachzeitschriften veröffentlicht; sie werden wohl zutreffen. Die neuroanatomischen Strukturen, die die Lauterzeugung unter operative Konditionierung brachten und dem Menschen eigentümlich sind, fossilieren nicht und sind auch heute noch nicht genau bekannt. Man hat nur festgestellt, daß die Lautgebung bei Schimpansen usw. sich nicht modifizieren läßt und daher als Material für Sprache nicht in Frage kommt; daher das Ausweichen auf Gebärden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.12.2020 um 06.31 Uhr |
|
Ähnlich wird auch spekuliert, ob der Neandertaler eher den Pinzettengriff oder den Kraftgriff beherrschte und nutzte. Die fragmentarisch erhaltenden Fossilien werden nach relativer Länge und Opponierbarkeit des Daumens untersucht, bisher nicht mit unumstrittenen Ergebnissen. Selbst wenn die Hand noch nicht für den Pinzettengriff optimiert war (ist unser Körperbau denn optimal?), kann er doch schon das Verhalten geprägt haben. Die erhaltenen Artefakte sind aufschlußreicher als die Anatomie. Werkzeuge, geknotete Schnüre usw. setzen große Geschicklichkeit voraus. Was die heutigen Menschenaffen betrifft, so würde mich mehr interessieren, warum sie keine Tonleiter spielen lernen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.12.2020 um 08.02 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#24148 usw. Die primäre Klassifizierung folgt wie bei den Tieren der vitalen Bedeutung, aber durch die Sprache wird es uns möglich, die Gegenstände nach beliebigen Kriterien zu ordnen. Skinners Beispiel war die Farbe Rot. Kürbisse und Bananen sind "Beeren", Erdbeeren sind "Nüsse" usw. Das Saxophon gehört der Definition nach, anders als sein metallischer Korpus (meist aus versilbertem, vergoldetem oder lackiertem Messing) vermuten lässt, zur Familie der Holzblasinstrumente, da sein Ton mit Hilfe eines aufschlagenden Rohrblatts am Mundstück erzeugt wird. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.12.2020 um 20.33 Uhr |
|
Ich denke, Botaniker tun nicht gut daran, solche allgemeinen, umgangssprachlichen Begriffe wie "Beere" auch für die wissenschaftliche Klassifikation zu verwenden. Wenn Erdbeere, Brombeere, Himbeere, Vogelbeere, kirsebaer (norw./dän. Kirsche) keine Beeren sind, Kürbis, Melone, Tomate und Gurke aber doch, dann wirkt die Wissenschaft auf mich ziemlich abgehoben. Es wäre wohl kein Problem, Beeren Beeren sein zu lassen und sich für die Wissenschaft geeignetere Namen zu suchen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.01.2021 um 08.07 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=907#23788 Wir wissen nicht, wie "ausdrucksstark" (was immer das heißt) eine Sprache mit einem ganz anderen, unter Umständen auch sehr armen Vokalsystem wäre oder sein könnte. Der Morsecode führt uns immerhin vor, was auch mit zwei Zeichen plus Pausen möglich ist. Die Analogie hinkt zwar, aber spekulativer als die Geschichten über den Homo erectus oder den Neandertaler ist sie auch nicht. Neuroanatomische Neuerungen sind im fossilen Material nicht enthalten. Das scheint aber angesichts der kulturellen Relikte nicht so wichtig zu sein: Ist es denkbar, daß Menschen ohne Sprache das Feuer beherrschen, Werkzeuge herstellen, ihre Toten bestatten und all dies an ihre Nachkommen weitergeben? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.01.2021 um 07.18 Uhr |
|
Exaptationen sind in der Biologie allgegenwärtig, schon weil Evolution nach dem Muster "Umbau eines Schiffs auf hoher See" verläuft. Schwimmblasen werden zu Lungen, Kiemen zu Ohren, Flossen zu Füßen und wieder zu Flossen, Kauwerkzeuge zu Sprechorganen usw. Ebenso in der Kultur. Die Etymologie verrät oft noch die Herkunft. Das "kroatische" Halstuch wurde zur Krawatte, auch russisch галстук zeigt noch den Ursprung. Damit ging einher der Übergang vom praktischen zum dekorativen Zweck. Schmuck scheint eine mittlere Stelle zwischen Muster und Zeichen einzunehmen, aber die Krawatte hat wiederum exaptiv einen Zeichenwert angenommen. Ob jemand sie trägt oder wegläßt, ist ein Signal und wird auch so gedeutet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.02.2021 um 07.34 Uhr |
|
Zur Exaptation: Bewegliche Ohrmuscheln haben sich im Dienst des Richtungshörens entwickelt, sind bei Hunden und Katzen aber zusätzlich Ausdrucksorgan geworden. Der Schwanz diente dem Vortrieb bei der Fortbewegung und ist teils in den Dienst der Steuerung getreten, teils ebenfalls Ausdrucksorgan geworden. Zwischen Hunden und Katzen kann es bekanntlich zu Mißverständnissen kommen, weil die horizontale Bewegung des Schwanzes bei oberflächlicher Ähnlichkeit geradezu gegensätzliche Bedeutung hat. Die Tiere scheinen aber die "Fremdsprache" allmählich zu verstehen, wenn sie sie auch nicht selbst sprechen. So gibt es in vielen Familien Hunde und Katzen, die gut miteinander auskommen. Das sollte uns nicht wundern, denn sie lernen ja auch wenigstens rezeptiv die "Sprache" (die Bewegungen und Geräuschproduktion) der Menschen, die ihnen eigentlich skurril vorkommen muß. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.02.2021 um 10.17 Uhr |
|
Das menschliche Nervensystem verfügt über ein beeindruckendes Repertoire komplexer Fähigkeiten wie Wahrnehmen, Lernen und Erinnern, Planen, Entscheiden und Handeln... (Patricia S. Churchland in Metzinger, Hg.: Bewußtsein. 2. Aufl. Paderborn 1996:463) Das ist nicht nur der mereologische Trugschluß, der einem Teil zuschreibt, was nur dem Ganzen zugeschrieben werden kann (die Unruh zeigt nicht die Zeit an), sondern ein Kategorienfehler: Das Nervensystem plant nicht, entscheidet nicht, handelt nicht. Planen usw. sind alltagspsychologische Konstrukte, die nur Personen zugeschrieben werden können. Darauf hat schon Aristoteles hingewiesen. Mens sive cerebrum schreibt der Phänomenologe Bernhard Waldenfels, es ist aber kein Zitat. Geist und Hirn sind Begriffe mit völlig verschiedener Geschichte, und sie gehören, wie gerade gesagt, in völlig verschiedene Sprachtechniken. (Ich weiß allerdings nicht, wie Waldenfels es meint, weil ich Texte dieser Schule nicht verstehe.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.02.2021 um 15.17 Uhr |
|
Ich lese solche und ähnliche Sätze immer etwa so: Der Mensch verfügt vermittels seines Nervensystems über ein beeindruckendes Repertoire komplexer Fähigkeiten wie Wahrnehmen, Lernen und Erinnern, Planen, Entscheiden und Handeln. Daß der Originalsatz die von Ihnen genannten Fehler enthält, verstehe ich und sehe es auch so. Aber ist das nicht nur eine Frage ungeschickter Formulierung? Bedarf es zur Korrektur gleich einer anderen Theorie? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.02.2021 um 16.46 Uhr |
|
Die Churchlands sind bekannt für ihren "eliminativen Materialismus", die zitierte Formulierung enthält das ganze Programm: Der sogenannte Geist ist das Gehirn. Ich finde das von Grund auf falsch. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.02.2021 um 18.53 Uhr |
|
Dann will ich meine Frage anders formulieren: Planen usw. sind alltagspsychologische Konstrukte Ich finde, sei es nun so ein Konstrukt oder nicht, aber was man alltagspsychologisch unter "planen" versteht, das läßt sich doch sicher auch irgendwie wissenschaftlich exakt ausdrücken. Weshalb sollte es einem Menschen nicht möglich sein, im wissenschaftlichen Sinne zu "planen"? |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 17.02.2021 um 01.23 Uhr |
|
Nein, ich verstehe, es geht nicht um die Formulierung, sondern darum, daß planen zur gleichen mentalen Begriffsfamilie gehört.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.02.2021 um 07.50 Uhr |
|
Unter "Intentionalität und Sprache" habe ich versucht, es näher auszuführen, darauf komme ich immer wieder zurück. Beim Planen scheint man "über" etwas zu sprechen, was in der Zukunft liegt. Aus naturalistischer Sicht geht das natürlich nicht, wenn man es wörtlich versteht: Verhalten kann nicht von etwas gesteuert werden, was es noch gar nicht gibt und vielleicht nie geben wird. Das Zustandekommen solcher Panungsrede muß also anders erklärt werden. Skinner verwendet viel Mühe darauf, es zu erklären (Verbal Behavior – immer dieselbe Fundgrube). In der Philosophie kennt man das Problem: Wie kann ich über Odysseus reden, obwohl es ihn wahrscheinlich nie gegeben hat. (Hier schon verschiedentlich erörtert. In einer ohnehin nichtreferentiellen Zeichenauffasung kann so eine Frage gar nicht aufkommen.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.03.2021 um 05.47 Uhr |
|
[Menschen] haben gelernt, Y zu tun, wenn die Bedingung X vorliegt. Und es liege X vor. Also tun sie Y. Dieser Vorgang folgt offensichtlich einem "psychologischen Syllogismus". (Theo Herrmann: Allgemeine Sprachpsychologie. Grundlagen und Probleme. 2. Aufl. Weinheim 1995:58) Tauben haben gelernt, auf eine Scheibe zu picken, wenn ein Lämpchen aufleuchtet. Ein Lämpchen leuchte auf. Also picken sie auf die Scheibe. Dieser Vorgang folgt offensichtlich einem "psychologischen Syllogismus". Auch einem Thermostaten oder Fliehkraftregler kann man das gleiche logische Schließen unterstellen. Man sieht, daß das Ganze Unsinn ist. Herrmann schrieb es nachweislich wider besseres Wissen, was die Sache nicht besser macht. Die "Kognitive Linguistik", das Sprachproduktionsmodell Levelts usw. sind vom selben Schlag. Da die Logik eine sprachliche Gemeinschaftsangelegenheit ist, kann man überall den Homunkulus wiederfinden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.03.2021 um 05.48 Uhr |
|
Zu Jerry Fodor: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#32668 http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#25355 Wenn man sich den langen Wikipedia-Eintrag zum verstorbenen Fodor ansieht und den noch viel längeren in der englischen Fassung, wundert man sich, wie so etwas je ernst genommen werden konnte. Aber sogar in der Linguistik war das zu den Hochzeiten der Chomsky-Linguistik ein großer Name, keiner kam daran vorbei. Wie Normore (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#27504) zeigt, stand Fodor in der Tradition der Scholastik, ohne es zu wissen. Die Language-of-Thought-Theorie ist eine Spielart des Homunkulus-Fehlers und hat dessen unversiegliche Verführungskraft. Es entspricht strukturell dem Kreationismus. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.03.2021 um 04.36 Uhr |
|
Die Corona-Pandemie ist auch ein Lehrstück über Evolution und Anpassung. Wer sich dafür interessiert, kann jeden Tag etwas über Selektion, „Escape“ usw. erfahren, wobei die rasend schnelle Reproduktion der Viren zu Hilfe kommt. Wir haben das ursprüngliche Virus bei weitem nicht besiegt, da setzt sich schon die Mutante durch und verdrängt die „Wildform“, einfach durch einen Vorsprung an Übertragbarkeit, der in diesem Fall sogar verhältnismäßig groß ist, verglichen mit den Vorsprüngen in der Entwicklung größerer Lebewesen, die sich entsprechend langsamer fortpflanzen. Gutes Beispiel hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Eurasisches_Eichh%C3%B6rnchen#Konkurrenz_durch_Grauh%C3%B6rnchen. Wenn man die Schulkinder damit beschäftigt, lernen sie etwas, was vielleicht manche coronabedingte Lernlücke aufwiegt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.04.2021 um 04.22 Uhr |
|
Mein kompetenterer Mitstreiter in Sachen Behaviorismus Prof. Christoph Bördlein wird am Dienstag um 19.30 einen Online-Vortrag halten: https://zoom.us/j/92985550841 Darin geht es wie in meinem Skinner-Aufsatz um die Fehldeutung und ihre Richtigstellung. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 10.04.2021 um 20.15 Uhr |
|
Ich habe mir gerade dieses Skinner-Interview angesehen: https://www.youtube.com/watch?v=CYw9K9qtoiA Es geht um Vorteile positiver Verstärkung, also Belohnung statt Bestrafung. Es ist interessant, Skinner mal direkt zu sehen und reden zu hören. Bei seinen Beispielen dachte ich an eine amüsante Begebenheit mit meinen eigenen Enkeln. Die Kinder (5 und 6 Jahre) waren die Woche vor Ostern ein paar Tage bei uns zur Betreuung. Sehr gern mögen sie es, Märchentrickfilme (von Youtube) auf meinem Tablet zu sehen, was ich aber möglichst einzuschränken versuche. Vorlesen lassen sie sich auch sehr gern. Aus dem Kindergarten bringen sie ja so allerlei Späße mit, z. B. das unheimlich witzige Wort Kacka. Kacka hier, Kacka dort, dazu können sie sich halb totlachen, Opa hat Kacka am Bein, lauter Jubel über den gelungenen Witz. So geht das ständig. Endlich sann ich einen Vormittag auf Abhilfe und sagte, ihr dürft euch heute abend einen Märchenfilm aussuchen. Große Freude. Aber nur, wenn ihr nicht mehr Kacka sagt! Wenn ich es noch ein einziges Mal höre, gibt es keinen Film. Die Große (6) gleich: Du hast es gerade selbst gesagt! Ich, etwas verlegen, ja, aber nur damit ihr ganz genau wißt, was ich meine. Ab jetzt darf es niemand mehr sagen. Von da an war tatsächlich Ruhe, ich habe es den ganzen Tag nicht mehr gehört, bis wir beim Nachmittagstee saßen. Da sagte meine Frau beiläufig, sie würde nachher zum Essen Rührei machen. Sofort platzte die Kleine (5) voller Begeisterung schreiend heraus: "Rührei mit Ka-". Schlagartig, halb im Wort erstarrend, hielt sie sich mit beiden Händen den Mund zu und schielte aus den Pupillen nach rechts und links. Ich tat so, als hätte ich nichts gehört, und natürlich durften die beiden dann vorm Schlafengehen noch den Trickfilm "Die Schöne und das Biest" sehen. Unerwarteterweise hielt der positive Effekt sogar an den Folgetagen weiter an, auch ohne erneute ausdrückliche Filmversprechen. Skinner wäre sicher begeistert gewesen. |
Kommentar von , verfaßt am 14.04.2021 um 11.29 Uhr |
|
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.04.2021 um 07.51 Uhr |
|
„Delphine erkennen ihre Freunde“ (SZ Wissen) usw., samt kognitiven Voraussetzungen, alles sehr nett zu lesen. Es ist die übliche Vermenschlichung der Tiere statt der gebotenen Vertierlichung der Menschen. Natürlich erkennen höhere Tiere einander als „Individuen“. Der Familienhund zu Besuch läuft sofort zu mir und holt sich seine Streicheleinheiten. Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#37682. (Er weiß bis heute nicht, daß ich Hunde eigentlich nicht leiden kann.)
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.04.2021 um 05.28 Uhr |
|
Zu den Delphinen gibt es ja immer wieder schöne Geschichten, wenn es auch meistens sehr ähnliche sind. „Hallo, ich bin’s, Martin“: Bei einem Anruf melden wir uns mit unserem Namen, den wir in der Regel lebenslang lang tragen. Ähnlich ist das offenbar auch bei Delfinen, haben Forscher bei „Männerfreundschaften“ unter den Meeressäugern festgestellt. Verbündete Individuen entwickeln demnach nicht etwa gemeinsame Erkennungsrufe, sondern „melden“ sich bei Freunden durch einen individuellen Laut, den sie ihr Leben lang beibehalten. Es handelt sich demnach um eine Parallele zu den Namen beim Menschen, sagen die Forscher. (...) King hebt abschließend hervor: „Neben dem Menschen scheinen bisher nur Delfine ihre individuellen Namen zu behalten, wenn es um die Bildung von engen und langen kooperativen Beziehungen geht“. Erneut werden sie damit also ihrem Ruf als uns verwandte Intelligenzen gerecht. Der übliche Unsinn. Eigennamen funktionieren ganz anders, die Meldung am Telefon ist ein Spezialfall. Ein Pfeifton als Erkennungszeichen funktioniert eher wie ein Etikett oder ein Muttermal. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.05.2021 um 06.35 Uhr |
|
In der Zeitung lese ich, daß George W. Bush nach eigenem Bekenntnis mit der "Kleinen Raupe Nimmersatt" des gerade verstorbenen Eric Carle aufgewachsen ist. Bush war 23, als sie erschien. Nehmen wir eine Gedächtnistäuschung an. Das kommt oft vor. Zum Beispiel bilde ich mir gern ein und erzähle es euch bei jeder Gelegenheit, daß ich schon immer Behaviorist war. Aber das stimmt gar nicht. Ich sehe zur Zeit alle meine Aufzeichnungen durch, viele tausend Seiten seit meiner Schulzeit. Na ja, man wird älter und muß sich auch selbst verzeihen können. Wer immer strebend sich bemüht... und das wenigstens habe ich getan, wobei ich mir zugute halten darf, daß ich sozusagen wie Tarzan aus dem Urwald kam, während meine eigenen Töchter in der Grundschule wegen ihrer "Allgemeinbildung" gelobt wurden (was uns sehr amüsiert hat, denn so hatten wir die lieben Kleinen bisher nicht gesehen). Wer immer strebend sich bemüht... Neulich las ich irgendwo, daß Faust sich doch gar nicht immer strebend bemüht hat, folglich auch nicht erlöst werden kann, der Schlingel. Der "Schlingel" wiederum hat mich gerade synonymisch beschäftigt. So kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. (Und was bedeutet das nun wieder?) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.06.2021 um 16.30 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#42090 Dagegen geht es auf Wimmelbildern durchweg um konkrete Gegenstände wie Regenschirme, Mäuse usw. Auf langen Reisen unterhielten wir die Kinder mit „Ich sehe was...“, an langen Abenden im Zimmer dagegen mit Wimmelbüchern. „Wirrwarr auf Schloß Winterstein“ war viele Jahre am beliebtesten, weil es außerdem noch eine Handlung hatte. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.06.2021 um 05.59 Uhr |
|
Worte brechen keine Knochen, und doch kann ein „bewegtes Lüftchen“ Berge versetzen, Kriege auslösen...Das Unproportionale zwischen Zeichen und ihrer Wirkung ist durch ihre Geschichte zu erklären, bei natürlichen Zeichen durch die Phylogenese, bei kulturellen durch die Konditionierungsgeschichte. Ohne den Blick auf die Entstehung erscheint es wie ein Wunder (das „Wunder des Bedeutens“ nach Hans Lenk). Aus diesem Grund hat Aristoteles, der jene Unproportionalität bemerkte (De an. 403a20ff.), die Seele als den „Beweger“ identifiziert. Man kann dort sehen, mit welcher Schwierigkeit der „unhistorische“ („synchronische“) Blick auf die Erscheinungen der angepaßten Natur zu ringen hat. Biologie ohne Darwin, Psychologie ohne Skinner – damit kommt man nicht weit. Wie Bedeutung ein Surrogat für Geschichte ist, so auch die Seele. Man muß es bewundern, daß Aristoteles nicht der Homunkulus-Illusion erlegen ist. Man hat ihm ja auch einen verhältnismäßig behavioristischen Blick bescheinigt. Atheist war er sowieso, daher gegen jeden Kreationismus gefeit. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.07.2021 um 04.25 Uhr |
|
Hunde, Katzen und andere Tiere signalisieren eine feindselige oder aggressive Stimmung durch ein Verhalten, das sich evolutionär als Angriffsvorbereitung (also die erste Phase des Angriffs) herleiten läßt. Diese Phase ist ritualisiert und damit zeichenhaft geworden. Bei freundlichem Verhalten, Zärtlichkeitssignalen ist eine Herleitung nicht so einfach. Manches stammt aus der Brutpflege (das Belecken zum Beispiel), aber die ganze Körperhaltung ist nicht so erklärbar. Darwin kommt auf die geniale Idee, daß es seinen Sinn gerade dadurch erhält, daß es das genaue Gegenteil des Aggressionssignals ist. Ein Gedanke, der ausgeweitet werden kann.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.08.2021 um 12.13 Uhr |
|
Das Küssen wird ja stammesgeschichtlich auf die Mund-Mund-Fütterung zurückgeführt. Ob das in Goethes Hapaxlegomenon vom "gabeseligen Munde" mitschwingt? Immerhin wollen Männer "an der Brust" der Geliebten ruhen, warum nicht auch am Mund?
|
Kommentar von , verfaßt am 02.10.2021 um 05.18 Uhr |
|
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.11.2021 um 06.01 Uhr |
|
Zu Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#38404 Chinese medical doll (https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_medical_doll) ist weniger kritisch als der deutsche Eintrag zu Schmerzpuppe (https://de.wikipedia.org/wiki/Schmerzpuppe), der das Ganze weitgehend dem Bereich der westlichen Chinoiserien zuweist. Es ist erstaunlich, daß man darüber so wenig Genaues zu wissen scheint. (Seit meinem Eintrag dazu ist Literatur hinzugekommen.) Verblüffend ist die Verbindung zu Manets „Olympia“. (Einer der deutschen Links führt zum Nürnberger „Hurenforum“.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.11.2021 um 05.59 Uhr |
|
Der aufrechte Gang bringt gewisse Schwierigkeiten mit sich, für die sich noch keine perfekten Lösungen entwickeln konnten. Davon leben die Orthopäden. (Vgl. zum Beispiel https://www.uniklinikum-leipzig.de/presse/Seiten/Pressemitteilung_6252.aspx) Es gibt Vergleichbares: „Bis zu 80 % der Frauen im Alter von über 40 Jahren sind von der Rhizarthrose betroffen. Das liegt an einer Wachstumsstörung, die dazu führt, dass der Sattel des Sattelgelenks bei Frauen häufig schräg steht. Die Tatsache, dass die Rhizarthrose so häufig vorkommt, hängt damit zusammen, dass das betreffende Daumengelenk – gemessen an der Dauer der Entstehungsgeschichte des Menschen – relativ „jung“ ist, nämlich acht Millionen Jahre. Erst durch dieses spezielle Gelenk bekam der Mensch die Möglichkeit, Gegenstände richtig fest zu halten und beispielsweise Flöte zu spielen. Weil aber dieses Gelenk in der Entstehungsgeschichte des Menschen erst sehr spät entstand und deshalb relativ „jung“ ist, ist es noch nicht perfekt ausgebildet und nicht so belastbar, wie es wünschenswert wäre.“ (Wikipedia „Daumen“) Skinner führt die Häufigkeit von Sprachentwicklungsstörungen darauf zurück, daß Sprachverhalten noch relativ jung ist. Davon leben wiederum die Logopäden... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.11.2021 um 06.13 Uhr |
|
Was den Menschen, aber nicht die Tiere, zum Erlernen einer Sprache befähigt, muß angesichts der Vielfalt der Sprachen etwas sehr Allgemeines sein. Chomsky nannte es zeitweise „Universalgrammatik“. Diese UG hat im Laufe der Zeit viele Wandlungen durchgemacht und ist in der „minimalistischen“ Fassung der generativen Linguistik kaum wiederzuerkennen. Der Grundfehler besteht darin, dieses Allgemeine für sprachlich zu halten – und sei es die Formel „move α“. Man sollte im menschlichen Verhalten nach Spezifischem suchen, das eine gemeinsame Grundlage haben könnte. Dabei können mehrere Merkmale und Fähigkeiten zusammenwirken. Sprache ist ja vermutlich eine kulturelle, historisch überlieferte Erscheinung, die man nicht umstandslos biologisch verstehen sollte. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.11.2021 um 06.49 Uhr |
|
Es kann kein spezifisches Zentrum für Verben im Vorderlappen geben (u. a. gegen Calvin: Wie das Gehirn denkt S. 12). Es gibt sicher kein Zentrum für Satzzeichen, Werkzeuge, Kleidungsstücke... (bzw. deren Bezeichnungen), kulturelle Artefakte. „Wortarten sind grammatische Phänomene und als solche nicht universal, sondern sprachspezifisch.“ (Christian Lehmann) Dabei kann es durchaus sein, daß Verben (sofern eine Sprache sie hat) bestimmte Regionen der Gehirns besonders ansprechen, aber das kann keine spezifische Verbindung sein. Herauszufinden, worum es sich wirklich handelt, ist die Aufgabe der Naturalisierung. Eine biologische Grundlage könnte etwa die Unterscheidung von Ernst und Spiel haben (Verstellungsverhalten). Ich versuche nachzuweisen, daß diese Unterscheidung eine der Wurzeln von Sprachverhalten ist. Darauf baut dann die weitere Entwicklung auf, auch die selektive Akkumulation der kulturellen Überlieferung (Homo docens), die dann mancherorts (aber nicht überall) auch zu „Verben“ führen kann. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.11.2021 um 07.52 Uhr |
|
Unter dem Einfluß Chomskys wird oft angenommen, in der Phylogenese und Kulturgeschichte der Sprache sei der Einbruch der Syntax ein revolutionärer Einschnitt gewesen, vielleicht sogar die Erfindung eines einzelnen. Auch Dawkins erwägt es, legt sich aber nicht fest (The ancestor’s tale). Meiner Ansicht nach sind Grammatik und Syntax Epihänomene, die später – ein Fall von Exaptation – zu Trägern eigener Information funktionalisiert wurden. Die Reihenfolge der Elemente wurde durch Gewohnheit fest, die Kongruenz ist eine Folge von Trägheit (Perseveration und Antizipation). Die enorme Häufigkeit unbemerkt bleibender Kongruenzfehler deutet darauf hin, daß die Kongruenz immer noch keine große funktionale Last trägt; erst die Logisierung in Fachsprachen usw. verschiebt die Gewichte zugunsten des Kalkülhaften, das für die Chomsky-Schule irrigerweise als Kern der Sprache gilt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.11.2021 um 06.01 Uhr |
|
Aus Bauklötzen zwei „Säulen“ zu errichten und sie durch einen Querbalken zu verbinden scheint uns nicht schwer zu sein. Ich hatte auf die strukturelle Ähnlichkeit mit diskontinuierlichen Konstituenten in der Rede hingewiesen, überhaupt Aufschub und Umweghandeln. Kleine Kinder brauchen ihre Zeit, um so weit zu kommen, und bei Menschenaffen scheint es gar nicht aufzutreten. Möglicherweise kann man es ihnen beibringen, aber es „sagt ihnen nichts“, sie haben für ein solches Kunststück so wenig eine Verwendung wie der Bär für das Radfahren, das er im Zirkus vorführt, aber nicht zur eigenen Fortbewegung nutzt. Ich habe schon erwähnt, daß die Wahrnehmung einer geraden Linie physiologisch nicht so einfach ist, wie es aussieht (aber in gewisser Hinsicht noch einfacher, wenn man die „Efficient coding hypothesis“ hinzunimmt...). Eine gerade Linie zu zeichnen wäre für einen Schimpansen manuell nicht schwer, aber warum sollte er es tun? Er tut es einfach nicht, wie er denn auch jeden Anflug von gegenständlichem Malen vermissen läßt. Niemand weiß, warum. Wenn man über den Ursprung der Sprache nachdenkt, muß man sich zuerst klarmachen, daß die Sprache keine Lücke füllte. Jedes Tier ist in seiner Nische relativ vollkommen angepaßt. Das gilt auch für die Kommunikation. Von heutigen Menschenaffen wissen wir, daß sie über eine Körpersprache und zusätzliche Laute verfügen, die ihnen offenbar ein erfolgreiches Leben über Millionen Jahre ermöglicht haben. Es ist ein Hauptproblem der Versuche, Affen eine Sprache beizubringen, daß sie mit solchen erlernten Kunststücken nichts anfangen können. Jede Erweiterung ist zunächst allenfalls ein Luxus, der erst noch seine Verwendung sucht. Wenn auch nur zwei Elemente – vielleicht die Vorläufer von Subjekt und Prädikat oder Thema und Rhema – gewohnheitsmäßig nacheinander ausgesprochen werden, stellt sich automatisch eine feste Reihenfolge ein, die dann zum Träger von Information werden kann. Hinzu kommen Tonstärke und -höhe. Mit diesen Mitteln könnten dann Aussage (Erzählung), Frage und Aufforderung unterschieden werden. Grammatik wäre entstanden. Der entscheidende Punkt ist die Lösung vom angeborenen Repertoire, der Schritt zur kulturellen Weitergabe, sei es auch nur der Juxtaposition zweier Laute, die bisher jeder für sich ihre Funktion hatten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.11.2021 um 06.28 Uhr |
|
Psychologen verwenden für ihre Versuche gern Sprachmaterial, weil es leicht zu handhaben, überall zu reproduzieren und auf eine trügerische Weise standardisiert ist. Schon Ebbinghaus verwendete „Silben“, die zwar künstlich waren, aber doch in der Muttersprache der Probanden vorkommen könnten, so daß an ihrem silbischen Charakter kein Zweifel bestand, wie es etwa mit Silben aus dem Chinesischen oder Nama der Fall hätte sein können. Eine Pseudosilbe wie [wux ist für deutsche Beteiligte klar definiert und jederzeit wiederholbar. (Naheliegende Kritik an Ebbinghaus monierte, daß die sinnfreien Silben eben doch mehr oder weniger an sinnvolle erinnerten und daher ein systematischer Fehler in den Versuchen steckte; das hat aber die Gültigkeit der von Ebbinghaus ermittelten Vergessenskurven nicht wesentlich beeinträchtigt, weil die Menge der Versuche den Fehler sozusagen wegkürzte.) Neurolinguisten verwenden gern wirkliches Sprachmaterial und sind daher besonders versucht, ihre Versuche für linguistisch zu halten. So glauben sie, daß im Gehirn der Probanden eine lokalisierbare Entsprechung zu Wörtern, Wortarten, Wortfeldern usw. existiert, die sich über bildgebende Verfahren als Bereich stärkerer Durchblutung nachweisen läßt. Sprachmaterial ist aber nicht Sprache. Ein Graupapagei mag Laute formen, die an Wörter erinnern, weil man ihn mit solchen gefüttert hat; für den Papageien sind es aber keine Wörter (die es nur als Teile einer Sprache gibt), sondern Geräusche. Die Dressurleistung Irene Pepperbergs hat nichts mit Sprache zu tun. Der Hund Rico apportiert Gegenstände auf unterschiedliche Signale hin; keineswegs kennt er die Namen von Hunderten von Spielzeugen (die wiederum für ihn keine Spielzeuge sind, weil diese Kategorie in seinem Leben nicht vorkommt; aber das sei nur nebenbei erwähnt). Das Problem wird dadurch kompliziert, daß die „Wörter“ usw., mit denen der Psychologe und Neurologe experimentiert, zwar nur simuliert sind, aber eben doch nicht ganz unabhängig von der zugehörigen Sprache verarbeitet werden. Sprachsimulation ist schließlich auch ein natürlicher Bestandteil wirklicher Sprache: Bei verschiedenen Gelegenheiten kommen Sprachelemente auch im Modus des Zitierens oder Vorführens, also letzten Endes der Verstellung vor. Es kann sich um das Anführen fremder Rede, das Vormachen zu didaktischen Zwecken oder um einen anderen versteckten „ungeraden“ Gebrauch der Rede wie in Nebensätzen handeln. All dies gehört zum Hintergrund der Versuche. Es wäre daher wünschenswert, daß die eigentliche Natur dieser Versuche zuvor aufgeklärt würde. Sie müßten auch durch Versuche mit vollkommen nichtsprachlichen Stimuli ergänzt und gegebenenfalls korrigiert werden. Ich weiß nicht, ob der Unterschied zwischen dem Verwenden und dem Zitieren von Sprachmaterial (einschließlich der sehr verschiedenen Varianten von beidem) je psychologisch und neurologisch untersucht worden ist. Gibt es eine Neuropsychologie des Verstellungsspiels? Einem Hirnscan unter lebensechten Bedingungen des Ernstfalls stehen fast unüberwindliche technische Schwierigkeiten entgegen. Allenfalls die relativ groben Daten eines EEG sind leichter zu gewinnen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.12.2021 um 05.43 Uhr |
|
Ein Hund, dem sein Herr versehentlich auf die Pfote oder den Schwanz tritt, mag jaulen und sich sogar kurz zurückziehen, er wird aber daraus keine Feindschaft ableiten. Er muß weder Gedanken lesen können noch zur Perspektivübernahme oder einer Theory of mind fähig sein, um absichtliches von unabsichtlichem Verhalten zu unterscheiden. Die übrigen Umstände einschließlich der Konditionierungsgeschichte enthalten genügend Schlüssel, um Relevantes von Irrelevantem zu trennen und sich anschließend so zu verhalten, als sei nichts gewesen. Diese Fähigkeit wird auch sonst ständig geübt. Beim lehrenden Vormachen setzen wir besondere Mittel ein, um das Relevante zu konturieren und Überimitation zu verhindern. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.12.2021 um 05.47 Uhr |
|
„A good theory is one that needs to postulate little, in order to explain lots. (By this criterion, as I have often remarked elsewhere, Darwin’s theory of natural selection may be the best theory of all time.)“ (Richard Dawkins: The ancestor’s tale) Die strukturell gleiche behavioristische Verhaltensanalyse ist die beste Theorie auf dem Gebiet der sogenannten Psychologie. Sie hebt das intentionale, mentalistische Homunkulus-Denken auf wie jene das teleologisch-theistische („Kreationismus“). Die kognitivistische Wende ist eigentlich die Wiederkehr der rationalistischen Psychologie des Mittelalters und der frühen Neuzeit, wie auch Skinner bemerkt hat, der die Scholastiker als die Kognitivisten ihrer Zeit bezeichnete (Recent Issues in the Analysis of Behavior. Columbus, Ohio 1989:44). Chomsky, der aufgrund eines verwandten Mißverständnisses als Psychologe gilt, glaubt sich (wiederum irrig) auf den Spuren des Descartes - was immerhin die Genealogie dieser aus der Sprache herausgesponnenen Psychologie treffend darstellt. Die Abwendung von Verhaltensanalyse einerseits, Evolutionstheorie andererseits kann durch das technische Beiwerk, die quasi-mathematische Simulation von Sprache (Computermodell) als „modern“ erscheinen, aber es gibt immer mehr Kritiker, die den wahren Charakter dieses Ansatzes durchschauen. Die Biologen wehrten sich bald gegen den Nativismus, die Psychologen gegen die Fehldeutung des Behaviorismus, die Linguisten gegen die Nutzlosigkeit der Simulation von immergleichen Sätzchen und die Abwertung der empirischen Sprachforschung. Die absolute Unfruchtbarkeit dieser Richtung hat zuletzt eine umfassende Abwendung bewirkt, wie ja auch der Kreationismus zwar sehr betriebsam ist, aber in der Wissenschaft keine Beachtung findet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.12.2021 um 05.00 Uhr |
|
Chomsky interessierte sich in seiner Forschung – im Gegensatz zu den Behavioristen – für die im Gehirn ablaufenden Prozesse. (Wikipedia Jerry Fodor) Was kann ein Autor wie Chomsky, der der Neurologie so fern steht und einer rationalen Psychologie das Wort redet, zum Gehirn sagen? Er spricht nicht vom Gehirn, sondern vom Geist. Das ist etwas ganz anderes. Von Chomsky gibt es keinen Beitrag zur Hirnforschung. Aber manche gebrauchen „Gehirn“ und „Geist“ austauschbar, je nachdem, wo sie Fördermittel erwarten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.12.2021 um 06.05 Uhr |
|
Die archaischen Formen der Kommunikation (mit zugehöriger Gesellschaft) haben eher das Zeug zu einer „Sprache des Geistes“ als die späten, logisch disziplinierten Fachsprachen. Die Menschen haben ähnlich wie die Affen zunächst mit ihren Beziehungen zueinander zu tun gehabt. Sie waren mit Überleben und Selbstbehauptung ausgefüllt und nicht an der „propositionalen Repräsentation“ von Sachverhalten interessiert. Daß die logische Disziplinierung bis hin zu einer „Idealsprache“, nämlich einer quasi-mathematischen Fachsprache, erst in historischer Zeit unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen allmählich entwickelt worden und immer prekär geblieben ist, ist ein starkes Argument gegen die These von der angeborenen Sprache des Geistes. Es fehlt anscheinend in der bisherigen Kritik dieser These. Die perfekte Sprache (im Sinne einer rationalistischen Philosophie) an den Anfang zu stellen ist möglicherweise eine von der jüdischen Theologie beeinflußte Theorie. Es muß einen Grund haben, daß Chomsky zu den „durch ihren jüdischen Hintergrund geprägten Philosophen“ gestellt wird (Wikipedia Noam Chomsky). Am Anfang war nicht das Wort, sondern das Schreien, Grunzen, Singen, das Streicheln und dazu das Zeigen und Vormachen. Das war ziemlich wild, aber entwicklungsfähig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.01.2022 um 05.51 Uhr |
|
Kreationisten argumentieren gern: Die Erdgeschichte reiche nicht aus, um die Entwicklung all der Organismen zu erklären. Dagegen: Die Geschichte bietet viel zu viel Zeit, denn an den menschlichen Züchtungen sieht man, wie schnell es gehen könnte, wenn nicht in der Natur alle Neuerungen immer wieder ausgeglichen würden. Dawkins führt es näher aus. Man denke an die Hunderassen, vom Menschen in ein paar hundert Jahren gezüchtet: In der Natur hätte das Millionen Jahre gedauert. Natürlich hängt es auch vom Generationszyklus ab. Menschen zu züchten würde länger dauern (Zyklus von 20 bis 30 Jahren). Das Coronavirus braucht nur ein paar Tage. Die Gentechnik ermöglicht es erstmals, Organismen zu verändern, ohne die Mutation und Selektion abzuwarten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.01.2022 um 08.39 Uhr |
|
Die "Sprachen" von Hund und Katze sind gewissermaßen Fremdsprachen füreinander und eine Quelle von Mißverständnissen – man denke an die horizontale Bewegung des Schwanzes, wo es eine gewisse oberflächliche formale Ähnlichkeit gibt, aber entgegengesetzte Bedeutung. Aber wenn sie zusammen aufwachsen, können sie die Fremdsprache lernen, ohne sie selbst aktiv zu übernehmen. Wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, die Ohren aufstellt und sein Spielgesicht aufsetzt, ist seine felide Freundin gern bereit, freundschaftlich mit ihm zu balgen. So sollten wir es untereinander auch halten, ich meine natürlich mutatis mutandis. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.01.2022 um 06.23 Uhr |
|
Dem Linguistischen Relativitätsprinzip haben Universalienforscher wie Berlin und Kay die vermeintlich universalen Gesetzmäßigkeiten der Farbbezeichnung entgegengestellt. Damit haben sie bei empirisch orientierten Sprachforschern und -kennern viel Kritik hervorgerufen. Knapp und deutlich ist die Kritik Geoffrey Sampsons in seinem Buch „Schools of Linguistic“ (1977). Universell sind die Physiologie und Anatomie einerseits, das Spektrum des sichtbaren Lichts andererseits. Die Kenntnis dieser außersprachlichen Tatsachen ist der Grund, warum man den Sprachen überhaupt ein System von Farbbezeichnungen unterstellt. Das „Wortfeld Farbe“ ist also wieder einmal von außen an die Sprachen herangetragen. Das Interesse an den Farben hat viele Ursachen. Blau ist kaum interessant, es spielt in der Natur keine große Rolle, und Speisen sind praktisch nie blau. Die semantische Analyse darf weder die Morphologie noch die Herkunft (Entlehnung) berücksichtigen. Ob ein Wort einfach, abgeleitet oder zusammengesetzt ist, ob nativ oder entlehnt, geht den Semantiker nichts an. Es spielt auch keine Rolle, ob ein Farbwort ursprünglich vergleichend motiviert ist (orange von der Frucht oder ein polynesisches Wort für schwarz von der Ausscheidung eines Tintenfischs). Der Semantiker darf seinen Untersuchungsgegenstand nicht aufgrund solcher sprachgebrauchsfremden Kriterien vorab eingrenzen. (Das ist auch bei der „Wortfeld“-Forschung zu beachten, die meistens dagegen verstößt.) Ich würde keiner Behauptung über den Farbwortschatz verschiedener Völker glauben, wenn ich die Sprache nicht beherrschte und die Texte bzw. den mündlichen Verkehr nicht beobachtet hätte. Berlin und Kay haben 20 Sprachen untersucht, dazu über 70 aus zweiter Hand. Aber auch bei den bekannteren wie Altgriechisch ist vieles falsch dargestellt. Die Kritik, die etwa Franz Dornseiff an der Wortfeldtheorie geübt hat, entspricht der Kritik von Sampson und anderen an den Universalienforschern einschließlich Pinker und der Chomsky-Schule. Skinner hat mit seinen Bemerkungen zu „rot“ als abstrakter Reaktion einen völlig neuen Gesichtspunkt beigesteuert. (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#24148) Die reinen Farbwörter sind abstrakt, weil sie etwas zusammenbringen, was sonst keinen vital bedeutsamen Zusammenhang hat. Kein Tier sucht alles Grüne, scheut alles Rote. Das Aussprechen des Wortes rot ist die einzige Reaktion, die unter der Steuerung alles Roten konditioniert werden kann. Es ist eine gesellschaftlich späte Übung, die gemeinsame Farbe völlig disparater Gegenstände aufzufinden und zu bezeichnen. Erst die Sprache ermöglicht es, alles Beliebige aus der Welt herauszuanalysieren, also die Aufmerksamkeit auf alles Beliebige (auch: alles Runde, alles Dreieckige) zu richten. In den ethnischen Klassifikationssystemen spielt die Farbe keine Rolle: „alles Rote“ ist keine natürliche Kategorie. Normalerweise sind Farben an ein Substrat gebunden wie blond; oft gibt es noch weitere Gebrauchsbedingungen, z. B. bei beige. Solche zusätzlichen Bedingungen verschieben den Fokus der Farben (Chafes „tailoring“): rot, weiß, blau bedeuten bei Wein etwas anderes als bei Kohl usw. Dies in einem universalen System der Farbbezeichnungen unterzubringen dürfte schwierig sein; es ist noch nicht einmal versucht worden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.01.2022 um 08.04 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#47586 Zu den menschlichen Fähigkeiten, die bei Tieren nicht oder nur rudimentär vorkommen und als Voraussetzungen des Sprachvermögens in Betracht kommen, gehören: Lachen und Weinen Lächeln Zeigen (und Verstehen von Zeiggesten) Präzisionswerfen (Jagd) bildliches Darstellen (Zeichnen, Modellieren) Konstruktives Bauen, Justieren, Zentrieren Musik und Tanz Verstellungsspiel Lehren durch Vormachen (eine didaktische Form von Verstellungsspiel) Lernen durch Üben (Verstellung) Hochhalten von Gegenständen, um sie anderen zu zeigen usw. Hinführen zu anderen Orten, damit die Artgenossen etwas sehen können voll opponierbarer Daumen (? graduell mehr als die Altweltaffen, Präzisionsgriff) Selbstmord (wie Unterhalt des Feuers wohl erst mit Sprache möglich) Nur eine Anregung, man müßte zu jedem Punkt weiter ausholen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.01.2022 um 08.09 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#48109 In Afrika soll das Wildern der Elfenbeinschmuggler schon dazu geführt haben, daß die Elefanten überhaupt keine Stoßzähne mehr ausbilden und dadurch für die Killer nicht mehr attraktiv sind. Das ist nicht unmöglich. Die Varietät mit wenig oder gar keinen Stoßzähnen könnte sich in kurzer Zeit durchgesetzt haben, wenn die anderen gar nicht oder kaum noch das fortpflanzungsfähige Alter erreichen. Unter normalen Bedingungen vermischen sich die Varietäten immer wieder, weshalb die Evolution sehr langsam voranschreitet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.01.2022 um 06.15 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#41106 My reflection, when I first made myself master of the central idea of the ‘Origin’, was ‘How extremely stupid not to have thought of that!’ Auch Dawkins zitiert diese schöne Stelle aus Thomas Huxleys Buch oft, und ich denke immer: Solange man zu einer solchen Einsicht fähig ist, lebt man noch. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.02.2022 um 04.47 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#37642 Die Angaben über das Auftreten des ersten Lächelns schwanken stark. Bei meinen Töchtern und jetzt den Enkeln streut es um 4 Wochen herum. (Bin froh, seit fast 50 Jahren protokolliert zu haben!) Die Unsicherheit wird wohl auch darauf beruhen, daß das Lächeln wie alle Bewegungen der Säuglinge noch unsicher konturiert ist. Auch die Ärmchen werden ja halb ballistisch einem Gegenstand entgegengeschleudert, bis der Greifreflex der Hand sich daran festkrallt. Alle Bewegungen werden von Tag zu Tag genauer gesteuert, die Kontrolle durch den jeweiligen Antagonisten wird immer differenzierter. Ausdifferenzieren ist überhaupt der Kern des Lernens, nicht so sehr das Hinzufügen von Neuem. Man müßte mal allein die Bewegungen der Hand von Geburt an durch tägliche Detailaufnahmen dokumentieren, vom Greifreflex des Traglings, der sich im Fell der Mutter festhalten will, bis zum Einfädeln einer Nähnadel... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.02.2022 um 06.43 Uhr |
|
Nach Ansicht der Saltationisten wie Chomsky usw. muß sich die Sprachfähigkeit durch eine Großmutation eingestellt haben. Sprache sei entweder ganz oder gar nicht da. (Im Hintergrund steht das Dogma von der grundsätzlichen Gleichartigkeit und auch Gleichwertigkeit aller Sprachen, gemessen an der "Komplexität". Ich habe das samt locus classicus von Sapir schon zitiert.) Das ist ein antidarwinistischer Gedanke. Wie Dawkins und andere immer wieder gezeigt haben, macht die Evolution keine großen Sprünge, und zwar deshalb, weil große Mutationen immer schädlich sind. Das bekannte Beispiel ist die Boeing, die durch einen Wirbelsturm über dem Schrottplatz zufällig zusammengesetzt wird. Das gibt es eben nicht. Wirbelstürme richten immer Schaden an. Paleys Taschenuhr war als Argument gegen die Evolution gedacht, aber Darwin hat wieder und wieder gezeigt, wohin kleine Schrittchen führen können. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.02.2022 um 05.12 Uhr |
|
Platon bezog sich auf die zu seiner Zeit übliche Technik, Notizen in Form von Wachs- oder Tontäfelchen aufzubewahren. Er glaubte, dass sich in unseren Seelen etwas befinde, das wächserne Eigenschaften habe: "Was sich nun abdrückt, daran erinnern wir uns. Wurde es aber gelöscht oder konnte es auch gar nicht eingedrückt werden, so vergessen wir die Sache und wissen sie nicht." Die Analogie vom Eindrücken hat sich in der Sprachgeschichte etabliert. So sprechen wir im Deutschen von starken Eindrücken oder eindrucksvollen Erlebnissen, wenn wir uns an etwas besonders gut erinnern. Und auch das englische Wort "impressions" ist auf die alten Aufschreibsysteme Wachs- und Tontafel zurückzuführen. Noch klarer hat sich die Wachstafel mit einer lateinischen Wendung in der Geschichte der Gedächtnismodelle verankert: als "tabula rasa" (die abgeschabte Tafel). Von der Antike bis in die heutige Zeit wird der Begriff von Philosophen, Anthropologen und Psychologen verwendet, wenn es um die Frage geht, ob der Mensch mit gewissen Erinnerungen auf die Welt kommt oder ob sein Gedächtnis vollkommen leer ist: eben wie eine Tabula rasa. Letztere Auffassung vertritt zum Beispiel die bedeutende psychologische Schule des Behaviorismus. (Frank Wittig https://www.planet-wissen.de/natur/forschung/gedaechtnis/pwiegeschichtedergedaechtnismodelle100.html) Es ist also immer noch möglich, dem Behaviorismus das Tabula-rasa-Modell zu unterstellen, das Skinner ausdrücklich verwirft. Auch Platon „glaubt“ nicht an das Wachstafel-Modell, sondern diskutiert es. In einem besonders konfusen Eintrag zu „Eindruck“ heißt es bei Wikipedia: Nach Peter Köck und Hanns Ott bezeichnet der Eindruck das Ergebnis einer ganzheitlichen Wahrnehmung, deren kognitive und emotionale Anteile teils angeborene Auslesemechanismen sind, teils durch Lernprozesse zustande kommen. (Gemeint: Auslösemechanismen) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.04.2022 um 04.23 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=783#48780 Die Geschichte der Technik kann so erzählt werden, daß eins logisch aus dem anderen folgt. Man hätte an einem einzigen Tag vom Faustkeil zu Computer gelangen können. Stattdessen 500.000 Jahre Faustkeil.... („How extremely stupid...!“) Das ist erklärungsbedürftig, auch wenn man meine Übertreibung zusammenstreicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.04.2022 um 05.20 Uhr |
|
Ein Kind von etwa drei Monaten sieht einen Gegenstand, den es interessant findet, und möchte etwas damit tun. (Ich deute meine Beobachtung in Begriffen einer Wald-und-Wiesen-Psychologie.) Aber die Bewegung der Arme und Hände ist noch nicht hinreichend mit dem Auge koordiniert. Die Erregung führt nur zu einem aufgeregten Hampeln (mit den Armen) und vor allem Strampeln (mit den Beinen). Das Kind liegt auf dem Rücken, vor seinen Augen sind diverse bunte Objekte aufgehängt, nach denen es allmählich greifen lernt. Dieses Mikrolernen kann man beinahe stundenweise verfolgen und sieht dabei, wie operante Konditionierung funktioniert. Der nächste Schritt besteht darin, daß die Objekte in den Mund genommen werden. Das Kind erkundet Form, Gewicht, Geschmack, Geruch, Klangeigenschaften der Dinge mit Lippen und Zunge. Ein Ding – viele Eigenschaften; viele Dinge – eine Eigenschaft. Das ist das vorsprachliche Muster der Prädikation. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.04.2022 um 05.49 Uhr |
|
Alle Kinder, die ich bisher beobachten konnte, schreiben nach dem Lernen der ersten Buchstaben "boustrophedon", d. h. am Ende der Zeile geht es in umgekehrter Richtung weiter, wobei auch die Buchstabenform spiegelbildlich umgeklappt sein kann wie im Altgriechischen usw. (meistens aber nicht). Das ist bemerkenswert, weil die Kinder es nicht bei Erwachsenen gesehen haben können. Es entsteht spontan. Man bemerkt dann erst, wie künstlich unser Zeilensprung ist. Wir unterbrechen dabei den Zusammenhang der Wörter und abstrahieren vom Strom der Artikulation. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.04.2022 um 06.06 Uhr |
|
Ameisen, Bienen, Termiten sind jenem Fließbandarbeiter vergleichbar, der – horribile dictu – nicht weiß, was er erschafft mit seiner Hand („entfremdete Arbeit“). Die Insekten deponieren, von Duftstoffen und anderen einfachen Reizen gesteuert, ein Kügelchen aus Wachs oder Lehm neben dem anderen, und so entsteht ein „kunstvoller“ Bau, dessen Architektur in keinem Plan und keinem Hirn gespeichert ist. Diesen Bau bewohnen sie dann oder nutzen ihn für die Brutpflege usw. Was sie in ihrem kurzen Leben lernen können, darf auf keinen Fall ihr Verhalten in Frage stellen; dafür hat die Evolution gesorgt. Nur der Mensch lernt auch Dinge, die ihn und seine Art vernichten können. Auch höhere Tiere, zum Beispiel Menschenaffen, dürfen bei Strafe des Untergangs keine Sprache lernen. Die Affenforscher, die jahrzehntelang vergeblich versuchten, ihren Tieren so etwas wie eine Sprache beizubringen, haben das von Anfang an nicht bedacht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.04.2022 um 06.43 Uhr |
|
Je wehrhafter Tiere sind (Zähne, Krallen...), desto deutlicher ihre Spielsignale und Hemmungen. Darum sind Katzen auch so „zärtlich“ („Schmusekatzen“ – das ist kein Zufall: Schmus ist übrigens, wie man ahnen kann, jiddisch-hebräischen Ursprungs). (Ein entfernter Bekannter wollte einer Katze aus einem Stacheldrahtverhau heraushelfen. In ihrem Schmerz biß sie ihn in die Hand und verursachte eine Wunde, die nicht zu heilen war. Am Ende mußte ihm der Unterarm amputiert werden.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 23.04.2022 um 23.26 Uhr |
|
Da hier schon mehrfach Kindermund zitiert wurde, muß ich einfach dies noch anfügen. Unsere Enkelin Aurelia (5) erzählte, was sie alles im Urlaub erlebt haben. Meine Frau: "Na das ist ja toll, das möchte ich auch gern mal machen. Nimmst Du mich denn da nächstes Mal mit in den Urlaub?" Antwort: "Jaaa." Ihre Schwester Matilda (2 1/2) hatte das Gespräch am Tisch mit verfolgt und sagte prompt: "Und ich den Opa." Ach, ich hätte sie erdrücken können. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.05.2022 um 05.39 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#28690 Die behavioristische Psychologie oder Verhaltensanalyse hat natürlich nicht vor, „den Geist wissenschaftlich zu erforschen“ (Searle); sie würde diese Aufgabenstellung aus grundsätzlichen Erwägungen ablehnen. Man hat oft den Eindruck, als machten diese Meisterdenker geradezu ängstlich einen Bogen um behavioristische Hauptwerke wie Skinners „Verbal behavior“, als fürchteten sie, durch Kenntnisse aus eigener Lektüre in ihren grundlegenden Gewißheiten gestört zu werden. Werke der kognitivistischen Richtung haben Titel wie „ Consciousness Regained“ (Nicholas Humphrey), „ Consciousness recovered“ (George Mandler) oder – am bekanntesten – „The redicovery of the mind“ (John Searle). Der oft recht rabiate Ton, in dem die Kognitivisten gegen die Empiristen polemisieren („ridiculous“ – so Searle über seinen Popanz von Behaviorismus), als seien diese unehrlich oder nicht ganz bei Trost, veranlaßte Skinner zu der sarkastischen Anwort: „The battle cry of the cognitive revolution is ´Mind is back!´ A ´great new science of mind´ is born. Behaviorism nearly destroyed our concern for it, but behaviorism has been overthrown, and we can take up again where the philosophers and early psychologists left off.“ |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.06.2022 um 15.17 Uhr |
|
Katzen lernen die Namen von Artgenossen und Menschen, wie die SZ berichtet (20.6.22). Das stimmt natürlich nicht, weil Namen nur in einer Sprache vorkommen. (Außerdem ist die Studie so windig angelegt, daß man sie sowieso nicht diskutieren kann.) Das geht nun mehr oder weniger launig durch alle Medien. Dieselbe Forscherin, Saho Takagi, laut Zeitung eine Katzennärrin, hatte früher schon gezeigt, daß ihre Lieblinge „die Gesetze der Physik verstehen“, z. B. daß ein Gegenstand aus einer Kiste herausfallen kann (Schwerkraft!). Außerdem wissen sie – durch „mental mapping“ – immer, wo Frauchen sich gerade aufhält. Noch ein paar Jahre früher hat die gleiche Gruppe herausgefunden, „dass Katzen ein episodisches Gedächtnis besitzen und möglicherweise sogar Gefallen daran finden, sich aktiv an vergangene Erlebnisse zurückzuerinnern.“ Da kommt sicher noch mehr.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.06.2022 um 05.31 Uhr |
|
„Die leichte Taube, indem sie im freien Fluge die Luft teilt, deren Widerstand sie fühlt, könnte die Vorstellung fassen, daß es ihr im luftleeren Raum noch viel besser gelingen werde.“ (Kritik der reinen Vernunft, Einleitung) Das entspricht der Konstruktion des idealen Sprecher/Hörers, der keine Gedächtnisbeschränkungen, Aufmerksamkeitsstörungen usw. kennt. Warum sollte ein derart gottgleiches Wesen überhaupt zu sprechen anfangen? Chomsky bestritt ja auch, daß die Sprache überhaupt primär der Kommunikation diente – möglicherweise eine Folge seiner Herkunft aus der jüdischen philosophischen Tradition. (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1106#45757) Darin folgen ihm die wenigsten seiner Anhänger. Bei Idealisierungen wie dem idealen Sprecher/Hörer besteht die Gefahr, daß man aus Mangel an Einsicht und Übersicht gerade die wesentlichen Merkmale wegläßt. Kant hat das für die „reine Vernunft“ nachgewiesen, der Sprachwissenschaftler zeigt es auf seinem Gebiet. Skinners „Verbal Behavior“ hat eine ähnliche Funktion wie die „Kritik der reinen Vernunft“; daher der erbitterte Widerstand Chomskys, der gewissermaßen die alte Metaphysik vertritt. Chomskys Heftigkeit machte Skinner ratlos: „I have never been able to understand why Chomsky becomes almost pathologically angry when writing about me.“ (Zit. nach Julie T. Andresen: "Skinner and Chomsky Thirty Years Later". Historiographia Linguistica XVII, 1990:145-166, S. 162) Vielleicht erklärt der ideologische Hintergrund diesen Aspekt der Debatte. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.07.2022 um 06.30 Uhr |
|
Hat man schon mal Katzen zum Apportieren eines Gegenstandes abrichten können? Hunde tun das beinahe von selbst. Bei Katzen sind die Berichte uneinheitlich. Möglicherweise „bedeutet“ Apportieren für Katzen etwas anderes als für Hunde. https://einfachtierisch.de/katzen/katzenerziehung/katzentricks-so-lernt-ihre-samtpfote-das-apportieren-84185 Ich habe beobachtet, daß Katzen ihre Beute oft nicht an Ort und Stelle verzehren, sondern erst an einen anderen Ort schleppen. Unsere brachten die im Feld erbeuteten jungen Kaninchen gern in den Hausflur und verzehrten sie dort. Während der Kater fraß, saß seine Schwester daneben und sah zu, bis er fertig war und sie den Rest bekam. Das scheint bei Löwen ähnlich zu sein, nur daß sie im Rudel leben, die Frauen die Jagd erledigen und der Mann und Haremsbesitzer seinen Löwenanteil zuerst bekommt. Die Hauskatze geht offensichtlich auf einen einzelgängerisch lebenden Vorfahren zurück. Das macht einen großen Unterschied. Die sprichwörtliche Unterwürfigkeit der Hunde hängt sicher mit ihrem Sozialverhalten im Rudel zusammen. Aber „Rudel“ bedeutet bei Wölfen und bei Löwen ganz Verschiedenes. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.09.2022 um 05.17 Uhr |
|
Weitere Bemerkungen zu Thomas Nagels Fledermaus-Aufsatz: Nagel sucht keinen Anschluß an die Biologie. Weder die klassische Umwelt-Lehre Jakob von Uexkülls noch der neuere, ebenfalls schon klassisch zu nennende Aufsatz „What the frog’s eye tells the frog’s brain“ von Lettvin/Maturana/McCulloch/Pitts werden erwähnt. Beobachter sehen zwar in Nagels Fragestellung eine Neufassung von Uexkülls Problem: „A theoretical biologist named Jakob von Uexküll was wondering what it was like to be a tick.“ (https://manymindspod.medium.com/me-my-umwelt-and-i-13ca5959eaff) Aber so fragen Uexküll und die genannten Neurologen (die wiederum nicht auf Uexküll eingehen) gerade nicht. Sie überschreiten die Grenze ihrer Wissenschaft nicht so weit, daß sie der Frage eine von vornherein unlösbare philosophische Form geben. Die Wahrnehmung der Tiere wird streng auf ihre Reaktion bezogen, nicht auf unergründbare Erlebnisse. Uexküll unterscheidet die physiologische Perspektive, unter der eine Zecke eine Reflexmaschine ist, von der biologischen, die darin ein Subjekt mit einer Umwelt sieht. Er legt dem Biologen in den Mund: „Ein Reiz aber muß von einem Subjekt gemerkt werden und kommt bei Objekten überhaupt nicht vor.“ (Jakob von Uexküll/Georg Kriszat: Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Reinbek 1956:24) Uexkülls „Tiersubjekt“ hat nichts mit Erlebnissen zu tun, sondern bezieht sich auf die Integration von Merk- und Wirkwelt; das a. a. O. abgebildete Schema ist in kybernetischen Begriffen rekonstruierbar. Seine Frage, ob Zellen, Organe und Organismen Maschinen oder Maschinisten seien, wird heute kaum noch so gestellt. |
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 01.11.2022 um 10.10 Uhr |
|
https://www.derstandard.at/story/2000140378163/kueken-von-haushuehnern-verstehen-die-bedeutung-von-nichts?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3pi38YJO_UFcapk6D3sI-lX0XopD70ug3vu-QIxKCPpIwozvH8tFqCJeY#Echobox=1667137331
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.11.2022 um 05.54 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#42090 Das Spiel bringt das (Sprach-)Verhalten des Partners unter die Steuerung durch den Farbreiz (oder auch andere Reize). Die Willkürlichkeit oder Unnatürlichkeit dieser Abstraktion zeigt gerade, daß unsere Aufmerksamkeit unter Beliebiges gebracht werden kann, weitgehend unabhängig von vitalen Interessen. Die spielerische Freiheit fördert dieses Schweifen. Man kann auch auf alles zeigen. Die Universalität des Zeigens ist die Voraussetzung der Universalität der Sprache. Könnten Tiere zeigen, könnten sie alles Beliebige in ihre Kommunikation einbeziehen; das geschieht aber nicht. Bei Wikipedia wird vorsorglich angegeben: „Ein Kind darf sich einen Gegenstand im Raum aussuchen (und, falls die Ehrlichkeit in Zweifel steht, auf einen Zettel aufschreiben).“ Tatsächlich zeigt sich die Kriminalität nirgends so früh wie bei diesem Spiel: Wenn man erraten hat, was das Kind meint, tut es nachträglich gern so, als habe es etwas anderes gemeint, und scheint zu glauben, der Unterhaltungswert sei wichtiger als die Ehrlichkeit. Wie ich sehe, scheint das Spiel im Englischen „I spy with my little eye“ zu heißen. Wird es eigentlich genau so gespielt wie im Deutschen? Kennt jemand Entsprechungen in anderen Sprachen? In China sind bildliche Simultandarstellungen von „Hundert spielende Kinder“ ein beliebter Wandschmuck (ich habe auch einen in Seidenstickerei), aber es handelt sich naturgemäß um Freiluftspiele. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.11.2022 um 06.09 Uhr |
|
Zur Exaptation: „Auch Elemente des Sexualverhaltens haben bei einzelnen Tiergruppen kommunikative Funktionen bekommen: Bei vielen Altweltaffen wird mit männlichem Aufreiten oder phallischem Imponieren – auch im nicht sexuellen Kontext – Dominanz signalisiert. Der hochgestreckte Mittelfinger kann als funktionelles Äquivalent dafür gesehen werden. Die Geste verbindet aggressive Dominanz mit Ekel. Deutlich wird dies in der ukrainischen Briefmarke, auf der das Kriegsschiff Moskwa und der ukrainische Soldat mit erhobenem Mittelfinger abgebildet sind (die Marke ist im April 2022 erschienen).“ (Gerhard Medicus: Was uns Menschen verbindet. Neuauflage 2022:5) Die Marke ist leicht zu finden, zum Beispiel hier: https://www.derstandard.de/story/2000134950479/ukrainische-briefmarke-zeigt-dem-russischen-kriegsschiff-moskwa-den-mittelfinger |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.11.2022 um 06.56 Uhr |
|
„Zur biopsychosozialen Entwicklung der Blasen- und Darmkontrolle“ Die linkische Wortbildung deutet auf das Schiefe einer begrifflichen Trennung (Körper, Seele, Gesellschaft) hin, die nachträglich gekittet werden muß. Besser wäre eine Verhaltensforschung, die von vornherein den ganzen Organismus in seiner Umwelt ins Auge faßt: „The behavior of organisms“ (Skinners erstes Hauptwerk). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.11.2022 um 06.03 Uhr |
|
Viele Tiere sind schneller als der Mensch, aber kurzatmig. Wir Couch potatoes machen es uns selten klar, aber: „A human running after a horse, other things being equal, will eventually catch it.“ (Daniel Everett: How Language Began: The Story of Humanity’s Greatest Invention. Croydon 2018:39) Wenn die Löwinnen ihre Beute erlegt haben (oder auch nicht), brauchen sie erst mal eine Weile, um wieder zu Atem zu kommen, und können einem richtig leid tun. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.12.2022 um 04.42 Uhr |
|
Ich neige zu der Ansicht, daß es keine angeborene Sprachfähigkeit gibt (und natürlich keine angeborene Sprache), sondern daß es sich um das Zusammenspiel verschiedener elementarer Fähigkeiten wie Vormachen/Nachmachen, Zeiggestik, willkürliche Steuerung der „Artikulations“-Organe usw. handelt. Also eine vielgliedrige Exaptation zu einem neuen Zweck. Eine hirnphysiologische Suche nach entsprechenden „Zentren“ müßte demnach anders vorgehen (anderer Input, andere Deutungen).
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.12.2022 um 15.36 Uhr |
|
„Mit seinem fulminanten Buch ‚Geist und Kosmos‘ attackiert der Philosoph Thomas Nagel das Weltbild der Naturwissenschaften.“ (Thomas Assheuer in der ZEIT) Markus Gabriel pries das Buch erwartungsgemäß in der FAZ. Die Naturwissenschaften haben kein Weltbild. Über die Methoden sind sie sich allerdings weitgehend einig. Nagel vertritt die modernste und schickste Form der Religion: die atheistische. Das tun auch viele Theologen, die daher ebenso wie die Kreationisten begeistert waren, als Nagel sozusagen die Katze aus dem Sack ließ, in die er sie Jahrzehnte zuvor mit seinem Fledermausaufsatz gesteckt hatte. Es war uns nicht entgangen. Wikipedia über Thomas Nagel: He had no religious upbringing, but regards himself as a Jew. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.12.2022 um 17.01 Uhr |
|
Skinner bezweifelt in den Notebooks, daß die warnenden Aufdrucke auch Zigarettenschachteln ihnen Zweck erreichen. Er schlägt vor, ein positive Kampagne zu veranstalten: „Von dem Geld, das ich durch ein Jahr Nichtrauchen gespart habe, habe ich mir eine schöne Stereoanlage gekauft“ usw. Das entspricht seinem Grundsatz, nur mit Belohnung zu arbeiten, weil Bestrafung ineffektiv sei. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.01.2023 um 07.02 Uhr |
|
Dawkins meint, die Weitergabe religiöser Vorstellungen habe auch darin ihren Grund, daß Kinder alles glauben, was ihre Eltern und überhaupt die Erwachsenen ihnen sagen, und daß dies eine durch Selektion entstandene genetische Ursache habe: Es ist im allgemeinen vorteilhaft, nicht alle Erfahrungen selbst machen zu müssen, sondern die reiche Erfahrung der Älteren zu nutzen. Die Glaubensbereitschaft der Kinder muß aber nicht genetisch begründet sein, sondern kann Default-Lösung sein: Was bleibt ihnen anderes übrig? Sie haben keine Wahl. Dawkins überspringt auch die erste Stufe: daß Menschen überhaupt ihren Kindern etwas beibringen, also den Aspekt des „Homo docens“, die Voraussetzung der kulturellen Akkumulation einschließlich der Sprache. Man könnte also die genetische Ursache auch hier suchen: Es hat sich als vorteilhaft (überlebensdienlich) erwiesen, dem Nachwuchs etwas beizubringen. Und wenn man die pubertäre Aufmüpfigkeit für universal hält, kann man auch hierfür wieder eine genetische Ursache suchen: Überlieferungstreue ist zwar nützlich, Innovation aber auch usw. Übrigens beruhen darwinistische Erklärungen auf der Voraussetzung, daß die Spezies erfolgreich war oder ist. Für den Menschen scheint mir das noch nicht erwiesen zu sein. Wenn seine Kultur ihn in den Untergang führen sollte, erübrigt es sich, ihren Selektionswert herauszufinden. Dawkins selbst hält ja daran fest, daß Religion ein schädliches Virus sei, eine Entgleisung jener sonst durchaus nützlichen Überlieferungstreue. Aber die Kultur selbst kommt ihm förderlich vor, besonders die Naturwissenschaften, die dem Menschen seinen (möglicherweise fatalen) Fortpflanzungserfolg gebracht haben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.01.2023 um 16.01 Uhr |
|
Ich habe immer wieder mal daran erinnert, wie weit man ausholen müßte, um die Bedeutung von Wörtern wie Verlegenheit, Scham operational zu definieren. Das wäre dann der Input für eine sprachsimulierende Maschine, also einen Computer, der ja nicht in unserer Gesellschaft gelebt hat und daher die "Kontingenzen" nicht "erlebt" hat, die solche kulturspezifischen Ausdrücke steuern. Der gleiche Gedanke findet sich immer wieder mal bei Skinner, so in den Notebooks S. 62 zum Beispielwort wistfully: "It will be a long long time before a word like that is defined in terms of contingencies of reinforcement!" Skinner war sich also der Enormität der Aufgabe bewußt, die er sich für "Verbal behavior" vorgenommen hatte, und konnte nur skizzieren, wie der Weg zur Lösung aussehen könnte. Anna Wierzbicka hat es von einem ganz anderen Ansatz her unternommen und für einige hundert Wörter geleistet. Ich hatte immer mal vor, die beiden zu vergleichen. Die Anregung bleibt bestehen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.01.2023 um 07.18 Uhr |
|
Wenig beachtet, aber für die Geschichte des Radikalen Behaviorismus doch bedeutsam ist Skinners lebenslanges Interesse an Freud und der Psychoanalyse. Man sollte es nicht erwarten. In "Science and human behavior" ist Freud der meistzitierte Autor. Meistens kritisiert er ihn, versucht aber zugleich, die Freudschen Begriffe in die Sprache der Verhaltensanalyse zu übersetzen. (Skinner: „Kritik psychoanalytischer Begriffe und Theorien.“ In Ernst Topitsch, Hg.: Logik der Sozialwissenschaften. Köln 1993: 400-409) Skinner konnte zwar das ganze Ausmaß von Freuds Schummelei noch nicht kennen, aber in den "Notebooks" äußert er schon mal seine Verwunderung darüber, was aus der offiziellen Biographie zu entnehmen ist: daß hinter der vermeintlichen "klinischen Erfahrung" eine winzige, zeitweise auf eine einzige Person geschrumpfte Population von Privatpatienten steht. In den Notebooks kommt Skinner auch immer wieder in ganz persönlichen Beobachtungen darauf zu sprechen, wie Erinnerungen ausgelöst werden können. Diese Notizen wirken wie psychonanalytische Protokolle. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.01.2023 um 05.46 Uhr |
|
Eine ganze Generation von Linguisten (Hurford, Lightfoot usw.) stellt Sprache stets in Chomskyscher Notation dar, mit Spuren, Klammern, Transformationsregeln usw. (nach dem jeweils neuesten Modell des Meisters), niemals als Verhalten. Dann wird nach evolutionären Hintergründen dieses Kunstprodukts gefragt – kein Wunder, daß man nicht weiterkommt. Skinner fragt gelegentlich (Notebooks 328), unter welchem Selektionsdruck musikalische, künstlerische, mathematische Fähigkeiten sich entwickelt haben könnten. Das scheint bei so jungen Neuerungen abwegig, aber warum sollte es mit der Sprache anders sein? Die Überlegung deutet darauf hin, daß andere, elementarere, wirklich überlebensrelevante Verhaltensweisen (und Organe) die eigentlichen Gegenstände der Evolution waren und erst nachträglich für das Sprachverhalten exaptiert und zusammengeführt wurden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.01.2023 um 04.58 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#32089 Die Herleitung der Silbengliederung aus der Kaubewegung (MacNeilage mit Hinweis auf das Broca-Zentrum) halte ich für unwahrscheinlich. Kinder erzeugen Lautketten wie nga-nga-nga... schon, bevor sie feste Nahrung zu sich nehmen, und das Kauen sieht auch anders aus. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.01.2023 um 04.42 Uhr |
|
Volker Sommer hält den Behaviorismus Skinner für etwas aus der Mode gekommen und spricht wegwerfend von „simplen Konditionierungen“, ohne dieses Attribut näher zu begründen. Sein Programm, die Tiere nicht zu anthropomorphisieren, sondern die Menschen zu zoomorphisieren, ist eigentlich das behavioristische, wird aber nicht deutlich als solches gekennzeichnet. Dazu würde gehören, das Reden vom Gedankenlesen, von „Theorie des Geistes“, vom „Mentalen“ überhaupt zu unterlassen, aber so weit geht Sommer nicht. („Geistlose Affen oder äffische Geisteswesen? Eine Exkursion durch die mentale Welt unserer Mitprimaten“. In: Gene, Meme und Gehirne. Geist und Gesellschaft als Natur. Eine Debatte. Hg. von Alexander Becker u. a. Frankfurt 2003:112-136, S. 130)
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.02.2023 um 04.52 Uhr |
|
Die Theoretiker der „Theorie des Geistes“ (theory of mind) argumentieren: Der Beobachter erschließt aus dem Verhalten eines anderen, was sich in dessen Geist abspielt, und reagiert auf diese „mentalen Vorgänge“. So wird es z. B. bei Thomas Suddendorf wieder und wieder dargestellt. Der False-belief-Test wird als Beweis angesehen („heiliger Gral“ der Theorie des Geistes). Daß sowohl das „Gedankenlesen“ als auch die „Persepktivübernahme“, das „Hineinversetzen“ und die „Theorie des Geistes“, die ein Säugling und vermutlich ein Menschaffen ausbilden soll, nur Metaphern sind, die der Einlösung bedürfen, wird weithin nicht einmal gesehen, geschweige denn aufgeklärt. Der logische Fehler liegt auf der Hand: Da das Mentale nur erschlossen (ich würde sagen: nach bestimmten kulturellen, sprachlichen Konventionen konstruiert) ist, kann der Beobachter nicht darauf reagieren. Vielmehr sind alle Daten, die er für seine Reaktion benötigt, bereits im primär beobachteten Verhalten gegeben. Es bedarf des Umwegs in ein nichtwahrnehmbares Reich des Geistes überhaupt nicht. Suddendorf erwähnt gelegentlich, daß man nach sparsameren Lösungen sucht, kann sich aber nicht dazu durchringen, den perhorreszierten behavioristischen Standpunkt einzunehmen. Die referierten Diskussionen zwischen verschiedenen Schulen (etwa Povinelli gegen Tomasello) spielen sich innerhalb des kognitivstischen Paradigmas ab und gehen nicht an den Kern des Problems. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.02.2023 um 05.02 Uhr |
|
Zum vorigen: Daß ich den Standpunkt Suddendorfs korrekt referiert habe, sieht man an dieser Stelle: „Wenn sogar Schimpansen auf den geistigen Zustand eines anderen reagieren, warum ignorieren dann Wissenschaftler – insbesondere die noch verbliebenen überzeugten Behavioristen – in ihren Verhaltenstheorien völlig den Geist?“ Hier ist alles beisammen: die unmögliche Reaktion auf einen geistigen Zustand und der Erledigungstopos gegen den Behaviorismus. Im umfangreichen Werk Tomasellos ist das noch viel ausführlicher dargestellt. Man wird beim Lesen immer ungeduldiger: Warum zum Teufel kommt auf Schritt und Tritt der "Geist", das "Mentale" dazwischen, das der Verhaltensforscher doch gar nicht kennen dürfte? |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 09.02.2023 um 12.49 Uhr |
|
Im Grunde sehe ich das alles, die Widersprüche in den Äußerungen einiger Mentalisten, genau wie Sie. Auch wenn ich sicher öfters nicht selbst darauf gekommen wäre oder es nicht selbst entdeckt hätte, aber Ihre Erläuterungen leuchten mir jedenfalls ein. Diese Vertreter des Mentalismus tun ihrer Theorie mit der ungenauen Begrifflichkeit keinen Gefallen. Aber Sie möchten doch eigentlich nicht einzelne Theoretiker, sondern die Theorie, den Mentalismus an sich, widerlegen. Müßte man sich dazu nicht auf einen, wie soll ich sagen, vielleicht gönnerhaften, großmütigen Standpunkt stellen, also z. B. sagen, nun gut, was du schreibst, ist zwar formal Unsinn, aber eigentlich meinst du es ja gar nicht so, sondern wenn Du statt dessen dies und das sagen würdest, dann wären zumindest die ganz offenbaren, äußerlichen Widersprüche Deiner Theorie beseitigt, und wir könnten uns mit dem Kern der Theorie, z. B. des Mentalismus beschäftigen? Diesen Kern zu widerlegen, hielte ich für viel lohnender, als die zweifellos ebenfalls berechtigte, aber m. E. untergeordnete formale Kritik. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 09.02.2023 um 12.56 Uhr |
|
Ergänzend: Ich habe halt immer den Eindruck, das, was Sie an mentalistischen Äußerungen kritisieren, ist ja zumindest alles mit größerer begrifflicher Sorgfalt reparierbar. Es widerlegt also noch nicht die Theorie an sich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.02.2023 um 04.10 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#50390 Volker Sommer wiederholte seine geringschätzige Bemerkung über den Behaviorismus wörtlich in Darwinisch denken. 2. Aufl. Stuttgart 2008:22. Zum Erledigungstopos gehört es, die behavioristische Verhaltensanalyse als "simpel" mehr zu beschimpfen als zu bezeichnen. Das Attribut stellt sich zum Stichwort "Konditionierung" fast automatisch ein. In „Verbal behavior“ zeigt Skinner, daß die Konditionierung nicht „simpel“ sein muß und daß man auf dieser Grundlage so subtile Beobachtungen zu Sprache, Spracherwerb, Literatur anstellen kann, wie sie kaum ein Psycholinguist bisher geliefert hat. Dazu müßte man das Werk freilich lesen, und dazu kann sich, wie in meinem Aufsatz gezeigt, dank Chomsky niemand aufraffen. Wie simpel andererseits der Mentalismus ist, wird nicht erkannt, weil er so vertraut ist. Man versetzt sich in einen anderen hinein, übernimmt seine Perspektive, liest seine Gedanken – ganz einfach! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.02.2023 um 05.23 Uhr |
|
Chris Knight rejects the common assumption that human culture was a modified extension of primate behavior and argues instead that it was the product of an immense social, sexual, and political revolution initiated by women. Warum nicht? Alles ist möglich. Dazu sein Buch „Blood relations: menstruation and the origin of culture“. – Bücher dieser Art machen aus einem mehr oder weniger interessanten Einfall eine allumfassende Theorie. Lesenswert sind sie oft trotzdem, weil der einseitige Sammeleifer den Blick auf sonst unbeachtete Tatsachen lenkt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.02.2023 um 15.17 Uhr |
|
„Skinner suggested that language was a simple behavior, a notion Chomsky dismissed as absurd.“ (Christine Kenneally: The First Word – The Search for the Origins of Language. New York 2007:28) Skinner sagt nirgendwo, daß Sprache ein einfaches Verhalten ist, sonst hätte er nicht 500 Seiten schreiben müssen, um eine Verhaltensanalyse der Sprache wenigstens zu skizzieren. Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#50189. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.02.2023 um 04.01 Uhr |
|
In dem genannten Buch wird gezeigt, wie Chomsky nicht nur zum bedeutendsten Linguisten des Jahrhunderts, sondern zum weltgrößten Intellektuellen wurde. Die Welt ist ein Irrenhaus.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.03.2023 um 06.48 Uhr |
|
Warum zeigen Schimpansen keinen Ansatz bildlicher Darstellung, obwohl sie motorisch dazu fähig wären? Warum malen Kinder nicht, was sie sehen, sondern was sie wissen? (Kein Hin-und-her-Blicken zwischen Vorlage und Bild.) Ist die Möglichkeit bildlicher Darstellung (mimetischer Kunst) einmal entdeckt und dann weitergegeben worden, oder ist sie überall neu entdeckt worden und kann jederzeit wiederentdeckt werden? Die gleiche Frage stellt sich bei der Sprache. Warum zeigen die Höhlenmalereien naturalistisch und elegant gezeichnete Tiere, aber nur hoch abstrakte Menschen und keine Gesichter – die für den Menschen interessantesten Objekte überhaupt? Ornamente hat man auf einen Horror vacui zurückgeführt, die Angst vor leeren Flächen. Gibt es auch eine Angst vor Bildern? Die Abbildung eines Auges hat überall eine apotropäische Wirkung; um Spiegel rankt sich viele Aberglaube. Wir wissen zu wenig vom „archaischen“ Weltbild, aber das war der Hintergrund, vor dem auch die Entstehung und Entwicklung der Sprache größtenteils stattfand. Immerhin: Wie Hermann Paul sagt, haben die einstigen Triebräfte nicht einfach aufgehört zu wirken, sondern machen sich auch heute noch jederzeit bemerkbar – wenn man sich nicht auf die glatte Oberfläche der Schriftsprache beschränkt, sondern wie Paul, Skinner und andere Empiriker (Nichtstrukturalisten) den ganzen Sprachverkehr in seinem Lebenszusammenhang im Blick behält. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.03.2023 um 06.07 Uhr |
|
Kees Versteegh ist eigentlich eine Autorität auf dem Gebiet der Arabistik, darum war ich vor einigen Jahren überrascht, daß er einen der einsichtsvollsten Beiträge über Skinner, Chonmsky usw. verfaßt hat: The illusion of concepts: From Skinner to Dennett. (Er ist anscheinend nur im Internet greifbar.) Ich habe nur ein paar kleinere Einwände. Daß Skinner auch die Physiologie hätte berücksichtigen sollen, geht an einem wichtigen Punkt vorbei, und das beweist u. a. die Erwähnung der "Spiegelneuronen", um die es ja wieder still geworden ist. Das Physiologische in der modischen Kognitionsforschung ist fast ganz spekulativ und wertlos. Skinner hat gerade deshalb seine Richtung "Radikalen Behaviorismus" genannt, weil er sich auf die Verhaltensanalyse beschränkt und das Physiologische ausklammert, aber natürlich nicht ausschließt. Ein anderer kleiner Punkt hat damit zu tun, daß Versteegh sich fast ganz auf Skinners "About behaviorism" stützt und nicht auf "Verbal behavior" und daher zu einer diskutablen Gesamteinschätzung kommt. Aber das nur nebenbei, der Text ist im übrigen sehr klar und gut und sei wärmstens empfohlen. Gegen Ende wird auch die "Speicher"-Metaphorik erwähnt, was Herrn Riemer besonders interessieren dürfte. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 05.04.2023 um 23.01 Uhr |
|
Versteegh schreibt (ich beziehe mich hier vor allem auf die Seiten 6, 19 und 20 von "The illusion of concepts") über die Speicherung des Gelernten als eine Metapher, als ob es sich tatsächlich nicht um wirkliche Speicherung handelte. Er unterstellt Theorien mit einem Speicherkonzept, sie würden z. B. in bezug auf Sprache irgendwelche kodierten Kopien von Wörtern und Bedeutungen an einem Speicherort des Gehirns in Form eines mentalen Lexikons voraussetzen. Im Organismus sei aber nichts fest kodiert, sondern Speicherung sei eine bleibende Verhaltensänderung. Gut, er benutzt die behavioristische Terminologie. Im Grunde hätte ich daran auch gar nichts auszusetzen. Mir kommt es nicht darauf an, wie der menschliche Wissensspeicher genau funktioniert, das kann im Moment sowieso noch niemand sagen. Möge er sich eben im Verhalten widerspiegeln. Mir kommt es nur darauf an, daß es überhaupt diesen Speicher gibt. Allerdings finde ich trotzdem eine Speicherung im Verhalten sehr merkwürdig, zumindest begrifflich sehr ungünstig. Vielleicht trägt die Begrifflichkeit viel dazu bei, daß der Behaviorismus so wenig akzeptiert wird. "Verhalten" ist ja ein Abstraktum, wie soll darin etwas gespeichert sein? Zur Informationsspeicherung bedarf es nun mal eines konkreten materiellen Mediums, zum Beispiel des Gehirns. Wissen ist für mich kein Konstrukt. Wissen ist schon rein wörtlich das Gesehene, d. h. das sinnlich Erfahrene, mit behavioristischen Worten das Gelernte, oder, ganz allgemein gesagt, die im lebenden Organismus gespeicherte und sein Verhalten bestimmende Information. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.04.2023 um 05.04 Uhr |
|
Wenn man nur wüßte, was gemeint ist! Es scheint sich zum guten Teil um Terminologiefragen zu handeln. Wenn, wie Sie sagen, "im Moment" niemand sagen kann, wie die Speicherung aussieht, wäre es doch naheliegend, diesen Begriff erst einmal nicht zu verwenden und die physische Grundlage der dauerhaften Verhaltensänderung auf sich beruhen zu lassen. Man braucht sie ja auch so wenig wie die Unterstellung von "Wissen", wenn man z. B. eine so intelligente Maschine wie den Thermostaten untersucht oder den raffinierten Fliehkraftregler. Was die Akzeptanz des Behavioristen angeht, so sollte man sich nicht die Lippenbekenntnisse der Psychologen ansehen, sondern ihre Praxis: sie ist ganz und gar behavioristisch. Tierversuche laufen praktisch immer auf operante Konditionierung hinaus. Beim Menschen kommt die Sprache hinzu und macht alles komplizierter, aber – das ist unsere Position – nicht wesentlich anders. Letzteres zu beweisen oder zumindest als möglich darzustellen ist der Inhalt von "Verbal behavior" (und meines bescheidenen Versuchs "Wirkliche Zeichen"). |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 07.04.2023 um 17.26 Uhr |
|
Das "Wissen" von Thermostat und Fliehkraftregler ist zu trivial, sie reagieren ja nur auf zwei Zustände, bei denen sie einen Schalter an- oder abstellen. Das ist so wenig, daß uns das Wort "Wissen" dafür zu schade ist, zu hochtrabend vorkommt, aber prinzipiell handelt es sich m. E. dabei genau wie im menschlichen Gehirn um gespeicherte Information. Stellt man eine Verhaltensänderung einfach so dahin, dann hängt m. E. etwas in der Luft. Es klingt mystisch, wie sich ein Organismus plötzlich dauerhaft anders verhalten kann. Deshalb halte ich es für essentiell, in der Theorie auch darauf hinzuweisen, daß die Verhaltensänderung auf einer Veränderung der physischen Grundlagen, mithin auf einer Speicherung beruht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.04.2023 um 07.58 Uhr |
|
Ich erinnere noch einmal an das Bachbett und den Schlüssel, deren Form man natürlich auch als "Information" auffassen kann. Und man könnte Ihren Satz einfach umdrehen: Genau wie wir beim Fliehkraftregler den Informationsbegriff nicht brauchen, können wir auch bei den Veränderungen des Gehirns darauf verzichten und uns an die Zustandsbeschreibung halten. Ich bin aus Gründen der begrifflichen Sparsamkeit dafür, nur im Zusammenhang mit Nachrichten, also Zeichen, von Information zu sprechen, womit ich natürlich nicht in die mathematische Informationstheorie reinreden will, die hier gar nicht betroffen ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.05.2023 um 14.26 Uhr |
|
Aus meinen Aufzeichnungen zum Spracherwerb zweier Kinder will ich mal einiges herausziehen, was mit "Besitz" zusammenhängt: Johanna 1;4: habm (zweisilbig; bedeutet Geben und Nehmen) 1;6: Bedankt sich mit dang, wenn sie etwas bekommt. 1;7: danke mama, danke papa, danke mo:me (große Schwester Monika) 1;10: papa ba:t (Bart), mama ba:t nein, hanna ba:t auch nein (zeigt jeweils darauf) 2;1: kleine Ball - Papa schenkt - Hanna schenkt (will sagen, daß ich ihr den Gymnastikball, der kleiner ist als der meiner Frau, geschenkt habe) 2;5: Die Milch hat der Mann deschenkt, weil die ein bißchen säuerlich war. (Sie meint eine kostenlose Ersatzlieferung des Naturkostlieferanten, weil die andere Milch sauer war.) 3;5: Wer nichts abgibt, dem wird was gestohlen. Dorothee 1;0: Sie hält einen Stein im Mund. Mutter fragt: Was hast du denn im Mund? Sie holt ihn heraus, zeigt ihn und steckt ihn wieder hinein. Mutter: Gib mir den Stein! - Sie holt ihn heraus und übergibt ihn. 1;1: Wenn sie etwas bekommt, sagt sie dada (= danke). 1;7: Sie bedankt sich für jede Kleinigkeit (da:ke) bu - hana (Buch von Johanna, richtige Zuordnung) Mutter: "Wem gehört denn der Pulli?" - Hanna! (richtige Antwort) 1;9: Während sie das Fläschchen trinkt, faßt sie plötzlich ihren Arm an und sagt meiner! meina dojcha (mein Tuch) 2;2: (Sie gibt der Mama ein Stück Apfel:) Von dir, da, von dir (= für dich; dies wird monatelang beibehalten) Hast du auch Ananas? Magst du nein meine Ananas aufessen? (Sie sieht, daß ich einen eigenen Teller voll Ananas habe, während ich sie aus einem kleineren Teller füttere.) 2;3: (Ich zu Johanna: Du kriegst ein Geschenk von mir, ein Buch zum Selberlesen. Dorothee zu mir:) Ich will auch ein Geschenk von dir. 2;4: Ist das meiners? Ich will mal kucken, ob das meiners is(t). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.05.2023 um 05.50 Uhr |
|
Zum vorigen vgl. auch http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1370#26063 Nirad Chaudhuri geht in seinem Bericht "A passage to England" (Reise im Auftrag der BBC) auf das Verhältnis von Indern und Engländern zu Besitz und Geld ein. In indischen Familien wird man fast immer einen Winkel finden, der der Verehrung der Göttin des Reichtums Lakshmi oder auch dem elefantenköpfigen Ganesha geweiht ist, der eine ähnliche Funktion hat und von Studenten vor Prüfungen als "Beseitiger der Hindernisse" angerufen wird. Das kann ich bestätigen: Auch in aufgeklärten Familien von Akademikern habe ich es so vorgefunden. Chaudhuri meint, daß in Indien über das Geldverdienen offener gesprochen, das Erworbene dann aber zusammengehalten werde, während man in England nicht über den Erwerb spricht, aber seine Freude am Shoppen offen zeigt, auch am Erwerb von unnötigen Dingen. (Vor dem Betreten eines Geschäftes in Bond Street sollte man sich fein machen, um nicht von den Angestellten gesnubbed zu werden. Den nichtsahnenden Chaudhuri schützte seine bräunliche Haut, die ihn als sowieso nicht-zugehörig entschuldigte.) Ich habe vielleicht schon erwähnt, daß bei einer Hochzeit nach vedischem Ritus, die ich erleben durfte, das Brautpaar ganz archaisch um das heilige Feuer schritt, das Gewand des Bräutigams jedoch über und über mit angehefteten Rupie-Banknoten bedeckt war – in unseren Augen eine unfaßbare Geschmacklosigkeit. (Die Rupie war damals 25 Pfennige wert, heute fast gar nichts mehr; das nur nebenbei.) Das erwähnte Buch enthält viele feine Beobachtungen, die sich teilweise auf Deutschland übertragen lassen, so wie auch umgekehrt der Indienreisende etwas daraus lernen kann. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.05.2023 um 15.49 Uhr |
|
Die Englischdidaktikerin Rosemarie Tracy, hat alle Wendungen Chomskys getreulich mitgemacht. Sie folgte seinerzeit der „Annahme, daß ein Kind den Syntaxerwerb mit einer grundlegenden Strukturerwartung beginnt ...“ – nämlich der Universalgrammatik von Kopf, Komplement und Spezifikator. „So müssen Kinder herausfinden, ob sie im Begriff sind, eine Sprache mit starker oder mit schwacher Flexion zu erwerben ...“ – um dann ihren Parameter zu setzen. Die Vorstellung, Kinder könnten über das angeborene Wissen verfügen, daß es starke und schwache Flexion gibt, ist so abenteuerlich, daß man glaubt, sich verhört zu haben. Wie soll denn so etwas stammesgeschichtlich in unsere Köpfe gekommen sein? Gibt es auch die angeborene Kenntnis von Buchstaben-, Silben- und Morphemschriften? Polyphoner und plagaler Musik? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.05.2023 um 03.40 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#43979 Ein „Schema für zulässige Grammatiken“ und ein „System von kognitiven Prozeduren zur Entwicklung und Überprüfung von Hypothesen“ sind leere Worte, ebenso wie „Spracherwerbsmechanismus“ (language acquisiton device). Obwohl niemand damit eine konkrete Bedeutung verbinden konnte, wurde es jahrzehntelang als große Entdeckung gefeiert und war Prüfungsstoff für Tausende von Absolventen. Das Niveau ist das gleiche wie bei okkultistischer Medizin oder Astrologie. Bleibt die Frage: Wie war das möglich? (Und ist es wiederholbar, wiederholt sich vielleicht schon, ohne daß wir es bemerken?) McNeill, von dem die verstiegensten Beiträge der Chomsky-Schule zum Spracherwerb und zur Psycholinguistik stammen, nahm an, daß die Einwortäußerungen kleiner Kinder in Wirklichkeit auf komplette Sätze zurückgehen, die das Kind gewissermaßen im Geist hat, aber wegen bestimmter Beschränkungen nicht äußern kann. Man kann das nur verstehen, wenn man den transformationsgrammatischen Hintergrund bedenkt: die absolute Fixierung dieser Richtung auf den „Satz“, zusammen mit der These von der Angeborenheit einer „Grammatiktheorie“, ohne die das Kind angeblich nicht in der Lage sein könnte, die vermeintliche „Grammatik“ seiner Sprache zu erwerben oder vielmehr zu konstruieren. Robin Campbell hat sich die Mühe gemacht, diese abenteuerliche These zu widerlegen. (Robin N. Campbell: „Propositions and early utterances“. In: Gaberell Drachman, Hg.: Akten des 1. Salzburger Kolloquiums über Kindersprache. Tübingen 1976:247-259) Ich glaube nicht, daß es sich lohnt, auf solchen Unsinn einzugehen. Bemerkenswert ist er nur deshalb, weil in etwas versteckter Form auch heute noch ähnliche Gedanken vorgetragen werden. Was tat McNeill eigentlich? Er untersuchte, welche Bedeutung und welche Funktion die kindlichen Äußerungen haben, und dadurch gelangt er zu einer erwachsenensprachlichen Paraphrase. Diese Paraphrase projizierte er dann an den Anfang des Prozesses der Sprachproduktion und leitete die tatsächliche Äußerung daraus ab. Noch heute wird in neuesten und sehr ausgearbeiteten Modellen der Sprachproduktion an den Anfang der Aktualgenese eine voll elaborierte Version des Inhalts und der Funktion der erst noch zu produzierenden Äußerung gesetzt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.05.2023 um 03.55 Uhr |
|
Das Kind ist nicht mit dem Dekodieren eingehender Daten oder dem Knacken eines unbekannten Codes beschäftigt. Es betätigt sich in seiner Umwelt unter Steuerung durch Gegenstände und Mitmenschen. Es schließt offene Türen und öffnet geschlossene, steigt Stufen hinauf und hinunter, stapelt Klötze usw. Von Aufforderungen, Verboten und Kommentaren der Erwachsenen versteht es zunächst nur die hervorgehobenen Teile, die einen erkennbaren Bezug zu Dingen und Handlungen haben; später werden die übrigen Elemente genauer beachtet, weil sie sich als verhaltensrelevant erweisen. Die „kasustheoretische“ Frage „Wer wen/wem?“ ist schon vor der Beherrschung der grammatischen Formen beantwortet – durch die Logik der Situation, wie man sagen könnte. Der Stein soll in die ausgestreckte offene Hand gelegt werden, der Stift soll der Oma gebracht werden und das Pferdchen in den Stall gebracht – das sind die einzigen Operationen, die nach Wahrnehmung der prominenten Substantive in Betracht kommen. In jedem Fall ist die Sprache etwas Hinzukommendes und könnte nicht handlungssteuernd wirken, wenn sie nicht auf einen bereits beherrschten Verhaltensduktus stieße, ein mehr oder weniger fortgeschrittenes Repertoire von Fertigkeiten und Orientierungen. Darum sagt man auch, das Verstehen gehe dem Sprechen voraus. Daß es sich so verhält, kann man ohne spekulative Interpretation buchstäblich sehen – wenn man hinschaut. (Daß selbst dies nicht genügt, habe ich vor Jahren an einem deutschen Spracherwerbsforscher gezeigt: Er hatte seinen transformationsgrammatischen Spekulationen einen Band mit Protokollen beigefügt, der seine Thesen strikt widerlegte – ohne es zu bemerken.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.05.2023 um 04.13 Uhr |
|
Und weil es sich so verhält, ist es falsch, den Spracherwerb des Kindes mit dem ersten Wort beginnen zu lassen, das das Kind ausspricht. Gerade das erste Jahr, in dem das Kind noch gar nicht spricht, ist das entscheidende. Man lese mit realistischem Blick die "Standardwerke" (Wikipedia) von einst, die heute verramscht oder entsorgt werden, etwa (ebenfalls nach Wikipedia): Gisbert Fanselow/Sascha W. Felix: Sprachtheorie. Grundlagen und Zielsetzungen. Tübingen 1987. Günther Grewendorf, Fritz Hamm/Wolfgang Sternefeld: Sprachliches Wissen. Eine Einführung in moderne Theorien der grammatischen Beschreibung. Frankfurt 1987. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.05.2023 um 08.10 Uhr |
|
Ein Mädchen (5;1) erklärt wenige Wochen nach dem Umzug von Berlin nach München, sie sage jetzt "Gummibärle" und habe "Gummibärchen" vergessen, das sei auch viel schwerer. Wie soll sie das auch anders ausdrücken? Die Beobachtung ist ja richtig.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.05.2023 um 05.19 Uhr |
|
„Bräuche sind Ausdruck der Tradition. Sie dienen ihrer Erhaltung und Weitergabe sowie dem inneren Zusammenhalt der Gruppe (Gruppenkohäsion).“ (Wikipedia Brauch) Bräuche hätten also die Aufgabe, die Weitergabe (der Bräuche) weiterzugeben? Die Hilflosigkeit der Memtheorie kündigt sich an. Man glaubt etwas gesagt zu haben und hat doch nur das zu Erklärende mit anderen Worten noch einmal gesagt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.06.2023 um 11.12 Uhr |
|
Weiter mit dem Mikrolernen: Nichts ist leichter, als Topfblumen zu gießen, sollte man meinen. Das kleine Mädchen (1;5) macht es nach. Sie greift die Plastikgießkanne so, daß ein Teil des Wassers aus der Einfüllöffnung herausfließt. Sie ist es nicht gewohnt, daß ein solches Gefäß gewissermaßen hängt und nicht wie eine Schüssel auf den Händen ruht. Allmählich lernt sie es, mit der Hand an der richtigen Stelle die Kanne einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Beim Gießen ist aber die Gewichtsverteilung so ungewohnt, der Strahl weitgehend am Blumentopf vorbeigeht. Es dauert wieder einige Minuten, bis sie den Fehler korrigiert. Mir wird bei der Beobachtung erst bewußt, wie ungewohnt so eine Gießkanne oder vielmehr ihr Henkel in der Hand liegt. Nachgeahmt wurde nur die allgemeine Handlung "Blumengießen", der Rest folgte unter Sachsteuerung (Versuch und Irrtum). So geht das den ganzen Tag. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.06.2023 um 04.39 Uhr |
|
Die These von der unvergleichlichen Schnelligkeit des Spracherwerbs ist keine rhetorische Verzierung nach Art jener Appelle an die Staunensfähigkeit des Lesers, wie man sie in Sachbüchern oft findet, sondern ein wesentlicher Teil der nativistischen Theorie: „... the general class of parameter-setting models remains attractive because parameters address a fundamental aspect of the acquisition process — that children rapidly acquire their native language despite differences between languages. The general answer given by parameter-setting models — that children are born with the settings and thus need only learn which setting their language is—would greatly simplify the language-learning process for children. Any model that can explain how children do so much so quickly deserves to be taken seriously.“ (David W. Carroll: Psychology of Language. 3. Aufl. Pacific Grove 1999:326; Hervorhebung von mir) Über den hohen Preis, den diese Vereinfachung verlangt (Hypothesenbildung durch den Säugling, angeborene Kenntnis der Sprachtypologie usw.), setzen sich die Autoren dieser Schule hinweg. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.06.2023 um 04.12 Uhr |
|
Einerseits ähneln sich die Kinderzeichnungen aller Völker und Zeiten – sobald man sie anleitet, gegenständlich zu malen. Aber würden sie von sich aus darauf kommen? Ich glaube nicht. Die Natur nimmt also ihren Lauf, wenn die Kultur sie dazu angestoßen hat. Mit der Sprache dürfte es ähnlich sein. Anders gesagt: Die Übernahme und „Entfaltung“ kulturellen Verhaltens folgt naturgesetzlichen Mustern. Die Nativisten folgern daraus irrigerweise, das kulturelle Verhalten sei angeboren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.06.2023 um 14.29 Uhr |
|
Essen Sie doch mal Kirschen! Beobachten Sie, wie Sie mit Zunge und Zähnen, ruckzuck, den Stein aus dem Fruchtfleisch herauslösen! Das ist um so erstaunlicher, als wir sonst mit Haltehand und Arbeitshand zu arbeiten pflegen. Hier schiebt die Zunge das Werkstück unter die Stanze und schafft es, sich rechtzeitig wieder aus dem Arbeitsbereich zurückzuziehen, denn die Folgen eines Bisses (bis 50 kg pro Quadratzentimeter) wären sehr unangenehm. Diese Organe waren schon sehr geschickt, bevor wir angefangen haben, sie für das Sprechen zu exaptieren. Als Kinder waren wir sehr erschrocken, wenn wir einen Kirschkern verschluckt hatten. Wir wurden dann beruhigt: „Der kommt hinten wieder raus!“ Das ist ja der Lebenszweck der Kirschen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.07.2023 um 05.01 Uhr |
|
Auch ein Behaviorist kann über einen Witz nach dem Muster "Was ist der Unterschied...?" schmunzeln: A magician can pull a rabbit out of a hat – but an experimental psychologist can pull a habit out of a rat. Hab ich bei Roger N. Shepard gefunden, dem Meister der optischen Täuschungen (und ihrer Erklärung). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.09.2023 um 02.28 Uhr |
|
Obwohl schon immer in Skinners Werk gegenwärtig, hat das Gesamtbild erst in einem postum erschienenen Aufsatz seine zusammenfassende Darstellung gefunden: „Two established sciences, each with a clearly defined subject matter, have a bearing on human behavior. One is the physiology of the body-cum-brain – a matter of organs, tissues, and cells, and the electrical and chemical changes that occur within them. The other is a group of three sciences concerned with the variation and selection that determine the condition of that body-cum-brain at any moment: the natural selection of the behavior of species (ethology), the operant conditioning of the behavior of the individual (behavior analysis), and the evolution of the social environments that prime operant behavior and greatly expand its range (a part of anthropology). The three could be said to be related in this way: Physiology studies the product of which the sciences of variation and selection study the production. The body works as it does because of the laws of physics and chemistry; it does what it does because of its exposure to contingencies of variation and selection. Physiology tells us how the body works; the sciences of variation and selection tell us why it is a body that works that way.“ („Can psychology be a science of mind?“ American Psychologist Nov. 1990, S. 1206-1210, S.1208) Hinzuzufügen wäre, daß die Physiologie, die hier den drei Variations- und Selektionswissenschaften gegenübergestellt wird, bei einigen Autoren das Schema auch noch auf die Aktualgenese des einzelnen Sprechaktes („competitive queuing“) anwendet. Variation und Selektion wäre dann das Muster in allen vier zeitlichen Dimensionen: Evolution, Kulturgeschichte, Lerngeschichte, Aktualgenese. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.09.2023 um 15.30 Uhr |
|
Kompostierung von Leichen: Experte bezeichnet „Beerdigung“ als „komplett irren Vorgang“ Bisher können sich in Schleswig-Holstein Verstorbene in einem Pilotprojekt zu Humus umwandeln lassen. Nun plant Kiel eine Legalisierung des Verfahrens. (Tagesspiegel 22.9.23) Wir werden alle zu Humus, und so soll es laut Bibel auch sein („Aus Humus bist du gemacht, und zu Humus sollst du wieder werden“). Die Bestattung ist ein Gegenstand von Bestimmungsleistungen im Sinne Hofstätters: Mit den Toten muß irgend etwas geschehen, es steht aber nicht fest, was. Viele Möglichkeiten scheinen gleichwertig. Folglich entwickelt jede Menschengruppe ihre eigenen Bräuche und hält die Bräuche anderer Gruppen für absonderlich, pervers oder gottlos. Die Parsen wollen das heilige Feuer nicht durch Leichenverbrennung schänden und legen ihre Toten lieber den Geiern zum Fraß aus – was wiederum die Hindus greulich finden usw. Bestattungsbräuche sind neben Tisch- und Bekleidungssitten die besten Beispiele für diese Art von Kulturerscheinungen, und so sind sie auch seit je untersucht und verglichen worden; mit dem Mem-Begriff ist nichts gewonnen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.09.2023 um 17.09 Uhr |
|
Derek Bickerton stellte sich die Entstehung der Sprache so vor: First came words—symbolic units with a definite reference, different in kind from animal calls. Then came a pidgin-like stringing together of words. Then came Merge, and once Merge was established, it was simply a question of exploiting to the full an iterative process that could be carried on without limit. The degree to which this capacity was exercised became a matter for language or individual choice. Bickerton (2018 verstorben) ist sehr stark rezipiert worden, seine "Protolanguage" samt Kreolisierungstheorie war ein beherrschendes Thema. Ich halte das Ganze natürlich für einen großen Unsinn. Es kann keine Wörter ohne Sätze geben. Die Urgesellschaft kann nicht nur Wörter gehabt haben. Das wären holophrastische Einheiten und keine Wörter gewesen. Pidgins sind Behelfssprachen unter Menschen, die Vollsprachen haben, das ist eine ganz andere Situation als die der Urmenschen. Usw. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.09.2023 um 03.20 Uhr |
|
Wenn Hunde in der oberflächlichsten Weise etwas Laub und Blätter über ihren Kot fegen (meistens weit daneben), fragt man sich, wie ein so ineffektives Verhalten unter Selektionsdruck geraten konnte. Es kann ja nicht sein, daß dieses lächerliche Getue die Vermehrung und damit seine eigene Ausbreitung gefördert hat. Also muß es früher einmal besser gewesen sein. War das vor der Domestizierung? Wie machen es die Wölfe? Ich beobachte einen Kater, der sich in unserem Vorgarten ein Loch gräbt, hineinkackt und das Loch wieder zumacht. Immerhin. Kein Hund macht das auch nur annähernd so gut. Der Handlungsablauf wirkt so planmäßig, daß es sicher sehr lange gedauert hat, ihn auszubilden, und dabei muß der Vorteil deutlich genug gewesen sein, auch wenn wir uns kaum vorstellen können, daß z. B. der Jagderfolg davon abhing. Eine alternative Erklärung wäre, daß das Verstecken der Hinterlassenschaft sehr viel weiter zurückreicht in eine Zeit, als es wirklich noch überlebensdienlich war.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.10.2023 um 05.51 Uhr |
|
Es gibt unendlich viele Aufbereitungen des imaginierten Behaviorismus für Studenten, die genau das Gegenteil der Wahrheit verbreiten, z. B. https://www.studocu.com/de/document/schule-deutschland/deutsch-leistungskurs/spracherwerbstheorien/12079309 Das müssen wir uns dann als Prüfer bei Staatsexamina usw. anhören, obwohl wir in unseren Lehrveranstaltungen jahrelang versucht haben, die schlichten Tatsachen darzustellen. Es hat nicht die geringste Wirkung. Die Studenten scheinen gar nicht zugehört zu haben, sie reproduzieren, was sie in den Handreichungen zur Prüfungsvorbereitung finden, die alle voneinander abschreiben bzw. auf dem beschriebenen Weg des Gerüchts in Stafettenkontinuität weitergegeben werden. Dazu paßt, daß linguistische Einführungsbücher für Studienanfänger auch zur Examensvorbereitung empfohlen werden. Die Verlagswerbung erklärt also ausdrücklich, daß es vollkommen ausreicht, wenn die Studenten nach dem letzten Semester ebensoviel wissen wie am Anfang des ersten. Es genügt, ein paar Jahre älter geworden zu sein, weil man ja 18jährige nicht gut als Lehrer einstellen kann. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.10.2023 um 06.28 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#51786 Die Befürworter und Betreiber einer Kompostierung Verstorbener (Bericht in der heutigen SZ) haben erkannt, daß der "Aufruhr der Bestattungsbranche" und überhaupt die zurückhaltende Reaktion der Öffentlichkeit auch etwas mit Sprache zu tun haben. "Kompostieren" gehört sozusagen zur falschen Branche. Man spricht deshalb jetzt von "Reerdigung", was allerdings wegen der Wortspielerei etwas frivol klingt und wohl keine Zukunft haben dürfte. "Humifizierung"? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.10.2023 um 05.37 Uhr |
|
Mit anderthalb stellt die Enkelin Schuhe richtig zu Paaren zusammen, faßt sie mit einer Hand in der Mitte, wie die Erwachsenen es tun, und trägt sie an ihren Ort in der Garderobe. Wenn man bedenkt, daß seit ihrer Geburt erst 500 Tage vergangen sind, kann man es kaum fassen. Und doch ist jeder kleine Schritt von Tag zu Tag ganz natürlich ohne „Wunder“ (Nativismus) verlaufen. Später hört man den Teenager nebenan Rachmaninoff spielen. Das könnte man auch für eine übernatürliche Fingerfertigkeit halten, wenn man nicht die Klavierstunde von Anfang an mitgehört hätte. Aus dem Geräuschwirrwarr höre ich heraus und kann zugleich den Herkunftsort bestimmen: Kinderstimmen auf dem Garagenhof, dahinter eine elektrische Heckenschere, von der anderen Seite das Ausklopfen von Bettzeug, weit dahinter eine Eisenbahn aus dem Regnitztal, über dem Wald sehr leise ein Sportflieger. Allgemeiner Hintergrund ein Rauschen, das teils von der Stadt Erlangen (5 km) kommt, teils von der Staatsstraße, an der auch eine Großbaustelle liegt, mit gelegentlichen Tönen von Baukränen usw. Übrigens insgesamt eine sehr stille Wohngegend. Körperbau und Verhalten einer Kellerassel sind ein Wunder – bis man die Evolution verstanden hat. Sehr bewundernswert ist auch das Corona-Virus, das auf der chemischen Ebene vorführt, was alles möglich ist, wenn man den Dingen Zeit läßt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.10.2023 um 05.30 Uhr |
|
Wenn man das beobachtbare Verhalten zu erklären versucht, indem man ihm ein nicht beobachtbares, im übrigen aber gleichartiges „mentales Probehandeln“ zugrunde legt, gerät man in einen unendlichen Regreß, denn das innere Handeln müßte ja ebenfalls erklärt werden. „Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Schimpanse die Fähigkeit besitzt, Handlungsentwürfe in der Phantasie auszuprobieren.“ (Norbert Bischof: „Zur Stammesgeschichte der menschlichen Kognition“. Schweiz. Zeitschrift f. Psychologie 46/1987:77-90, S. 82) Das wird sehr wohl bezweifelt, und man sieht nicht einmal, was es bedeuten könnte – selbst bei uns Menschen, für die wir das transgressive Konstrukt vom mentalen Probehandeln erfunden haben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.10.2023 um 13.17 Uhr |
|
Ich kann mir vorstellen (was immer das sein mag), wie ein Gegenstand aussehen und sich anfühlen würde, wenn er gedreht oder gespiegelt würde. „Mentale Rotation“ ist ein Modell, nach dem es funktionieren könnte, auch wenn niemand die leiseste Ahnung hat, wie so etwas physiologisch vor sich gehen könnte. Es kann aber auch sein, daß an keiner Stelle und zu keiner Zeit im Kopf irgend etwas gedreht würde. Statt die einzelnen Teile oder Punkte entsprechend wandern zu lassen, kann man auch unanschaulich berechnen, wo sie zu liegen kommen würden (etwa nach dem Muster der analytischen Geometrie, die auch keine graphische Realisierung mehr braucht). Aber vor allem haben wir eine überaus reiche Erfahrung mit dem Drehen von Gegenständen. Die Heuristik kann sozusagen in den Bewegungsspielräumen enthalten sein, die wir eingeübt haben. Ich muß keine Kreisformel kennen, um mich im Kreis zu drehen. Ich kann eine Sprechsilbe ohne Nachdenken „spiegeln“, d. h. von hinten nach vorn aussprechen. Bei größeren Lautketten geht das nicht. Bei mehrsilbigen Wörtern fällt es mir leichter, die Silben zu vertauschen. Ebenso symmetrische Bewegungen beider Hände; die scheinen sogar ursprünglicher zu sein als die isolierte Bewegung eines einzelnen der Gegenstücke. Solche Fragen sind ungelöst, und ich sehe auch nicht, daß die Psychologen sich damit beschäftigen. Sie untersuchen lieber, ob introvertierte Menschen empathischer sind u. dgl., und niemand weiß genau, wovon sie eigentlich reden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.10.2023 um 10.46 Uhr |
|
Chomsky hat entdeckt, daß wir zwei Ausdrücke durch die Operation "Zusammenfügen" (merge) zusammenfügen. Während Angela Friederici naturgemäß begeistert war, kommentiert Daniel Everett beide mit angemessenem Spott (How language began).
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.11.2023 um 04.23 Uhr |
|
Die Enkelin (1;10) steigt allein die Treppe hoch. Mit der einen Hand hält sie sich an den Geländerstäben fest, mit der anderen faßt sie ihren eigenen Jackenkragen, wo die Erwachsenen sie sonst ein wenig zu halten pflegen. Wie ein kleiner Münchhausen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.11.2023 um 04.59 Uhr |
|
Gibt es Fortschritt? Bei kulturellen Neuerungen ist der adaptive Wert oft nicht zu erkennen. Man könnte hier unterscheiden: Handwerke und Wissenschaften unterliegen einer Selektion durch die Umwelt, an die sie sich immer besser anpassen: „There is a sense in which modern science is actually better than ancient science. Not only does our understanding of the universe change as the centuries go by: it improves.“ (Richard Dawkins: The selfish gene. 2. Aufl. Oxford 2016:247; ähnlich in „Der blinde Uhrmacher“ S. 318ff.) Das gleiche gilt für die Technik. Der Faustkeil ist objektiv besser als ein Feldstein, der Pflug besser als ein Grabstock usw. Die Benutzer und Nutznießer wären die letzten, die daran zweifeln und sich die früheren Geräte und Methoden zurückwünschen würden. Objektiver Maßstab ist der Fortpflanzungserfolg. Bei den schönen Künsten, bei der Mode, bei Religionen und anderen Ideologien gibt es dagegen keinen solchen Fortschritt: "The saints of today are not necessarily more saintly than those of a thousand years ago; our artists are not necessarily greater than those of early Greece; they are more likely to be inferior; and of course, our men of science are not necessarily more intelligent than those of old; yet one thing is certain, their knowledge is at once more extensive and more accurate. The acquisition and systematization of positive knowledge is the only human activity which is truly cumulative and progressive. Our civilization is essentially different from earlier ones, because our knowledge of the world and of ourselves is deeper, more precise, and more certain, because we have gradually learned to disentangle the forces of nature, and because we have contrived, by strict obedience to their laws, to capture them and to divert them to the gratification of our needs." (George Sarton: Introduction to the history of science. Baltimore 1927:3f.) Bei der Sprache ist es umstritten. Darum schränkt Dawkins die Analogie auch ein: „It is true that cultural evolution is orders of magnitude faster than genetic evolution. But I would have been jumping the gun if I had implied that natural selection of memes should take all credit for cultural evolution. It might, but that would have been a bolder claim than I set out to make. The evolution of language, for example, clearly owes more to drift (memetic drift) than to anything resembling selection.“ |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.11.2023 um 04.18 Uhr |
|
Skinner hatte Bedenken, psychologische Einführungskurse zu geben, die im amerikanischen Undergraduate-Lehrbetrieb anscheinend schon früh standardisiert und auf jeweils ein bestimmtes zu vereinbarendes Lehrbuch gegründet waren, das kapitelweise durchgenommen und dann abgefragt wurde. Dieser Typ von Buch (oft mit schon formulierten Testfragen nach jedem Kapitel oder im Anhang) kommt bei uns auch mehr und mehr in Gebrauch. Vor- und Nachteil ist eine landesweite (wegen der Dominanz des amerikanischen Stils in einigen Disziplinen dann auch weltweite) Vereinheitlichung, damit natürlich auch die Verbreitung konventioneller Lehren und Irrlehren. Der Europarat hatte, wie berichtet, ähnliche Ziele. Er hatte fast nichts davon gelesen und hat auch später weitgehend darauf verzichtet, zumal er durch seine behavioristische Haltung kaum verstand, wovon darin die Rede war. In der Autobiographie (2. Band) übertreibt er wohl seine Unwissenheit. Er sei den Studenten nur immer wenig voraus gewesen, was die gescheiteren auch gemerkt hätten. Dafür war er mit seinen umfangreichen Experimenten für „The behavior of organisms“ schon sehr weit gekommen und bereitete mehr als jeder andere die behavioristische Revolution vor. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.11.2023 um 07.41 Uhr |
|
Sydney Lamb, ein amerikanischer Linguist und Spezialist für Indianersprachen, hat sich im Alter einer spekulativen Neurologie der Sprache zugewandt. Er trennt das „System“ der Sprache vom konkreten Sprachverhalten, als wenn es zwei unabhängige Gegenstände wären: „Based on readily observable facts about people, take it as beyond question that a linguistic system, whatever form it has, has to be usable for speaking and understanding and must be able to be acquired and modified.“ (Sidney Lamb: „Being realistic, being scientific“, LACUS Forum 2006:283f., korrigiert) Natürlich beherrscht jedes Tier sein Verhalten. Die Frage, wie Sprache beschaffen sein müsse, damit sie vom Menschen gelernt und beherrscht werden kann, hat keinen rechten Sinn. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.11.2023 um 17.41 Uhr |
|
Though I did not try to impose an operant analysis on the group, I once demonstrated its effectiveness. A guest for the day, Erich Fromm, proved to have something to say about almost everything, but with little enlightenment. When he began to argue that people were not pigeons, I decided that something had to be done. On a scrap of paper I wrote "Watch Fromm’s left hand. I am going to shape a chopping motion" and passed it down the table to Halleck. Fromm was sitting directly across the table and speaking mainly to me. I turned my chair slightly so that I could see him out of the corner of my eye. He gesticulated a great deal as he talked, and whenever his left hand came up, I looked straight at him. If he brought the hand down, I nodded and smiled. Within five minutes he was chopping the air so vigorously that his wristwatch kept slipping out over his hand. William Lederer had seen my note, and he whispered to Halleck. The note came back with an addendum: "Let´s see you extinguish it." I stopped looking directly across the table, but the chopping went on for a long time. It was an unfair trick, but Fromm had angered me—first with his unsupported generalizations about human behavior and then with the implication that nothing better could be done if "people were to be regarded as pigeons." (B. F. Skinner: A matter of consequences. New York 1983 :150f.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.11.2023 um 06.03 Uhr |
|
Was dem radikalen Behaviorismus als „Enthumanisierung“ (dehumanizing) vorgeworfen wurde, nennt Skinner die „Enthomunkulisierung“ (dehomunculizing) (A matter of consequences. New York 1983:268). „Konditionierung“ wird vorwurfsvoll im Sinne einer inhumanen Dressur verwendet. Skinner zeigt, daß das Verhalten immer und unausweichlich von den Kontingenzen der Umgebung geformt wird; die Frage ist nur, ob man dies den Zufälligkeiten des Gegebenen überläßt oder nach bestem Wissen im Sinne einer Verbesserung steuert. Letzteres ist das Ziel jeder Erziehung und Bildung, die in der Sache nicht von „Dressur“ verschieden ist. Skinner hat sich in den Jahren nach „Verbal behavior“ und besonders nach der Frühpensionierung mehr und mehr der praktischen Nutzung seiner Einsichten für Erziehung und Gesellschaft gewidmet. Schon die beiden „Skandalbücher“ „Walden II“ und „Beyond freedom and dignity“ zeigen sein letzten Endes auf die Verbesserung der Welt gerichtetes Interesse. Er erwog auch, einen weiteren utopischen Roman zu schreiben, aber dazu fehlte die Zeit. Die wirtschaftlich erfolglosen Versuche, die „Air crib“ zu verbreiten, und die Arbeit an Lehrmaschinen zum programmierten Unterricht beschäftigten ihn viele Jahre. Dabei machten ihm die anscheinend unausrottbaren Vorurteile (s. o.) und damit zusammenhängend die Trägheit des Bildungswesens den meisten Kummer. Wer sich mit unserem Schulwesen beschäftigt, wird seinen Unwillen wg. dessen Ineffizienz nicht ganz abwegig finden; die Klagen sind geblieben, geändert hat sich wenig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.12.2023 um 08.27 Uhr |
|
Zum „Radikalen Behaviorismus“: Skinner war natürlich nicht gegen Neurophysiologie, kritisierte aber Konstruktionen wie das „conceptual nervous system“ bei Sherrington und bestand darauf, zunächst operationalisierbare Verhaltensbeschreibungen zu gewinnen, denen dann physiologische Korrelate zugeordnet werden könnten. Mit mentalistischen Konstrukten ist das begrifflich unmöglich. (A matter of consequences. New York 1983:367) Diese Mahnung ist heute weitgehend vergessen oder nie angekommen. Die bildgebenden Verfahren haben eine fatale Anziehungskraft, weil man für alles beliebige eine Region stärkerer „Aktivierung“ (meist Durchblutung) findet, also auch für Religiosität, Eigennamen, Selbstbewußtsein, Musikalität, Algebra, mentale Rotation usw. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.12.2023 um 18.14 Uhr |
|
„Auch die Arbeiten Chomskys, einem weiteren Wegbereiter der Kognitionswissenschaft, haben dazu beigetragen, dass der Mensch nicht mehr als bloß reagierendes Wesen betrachtet wird. In seiner Kritik an der behavioristischen Spracherwerbstheorie Skinners stellte er heraus, dass eine Sprache wie das Englische mit den Verfahren, die Behavioristen in ihren Lerntheorien spezifiziert haben, nicht gelernt werden kann (Chomsky, „Review of Skinner Verbal behavior“). Ein kompetenter Sprecher des Englischen kann etwa 10hoch30 korrekte englische Sätze verstehen und im Prinzip auch äußern. Da die englische Sprache nicht angeboren ist, sondern in der Kleinkindphase erlernt werden muss, ist es ausgeschlossen, dass diese Kompetenz durch Verstärkungen bestimmter Reaktionen auf bestimmte Reize gelernt wird. Nach Chomsky kann der Spracherwerb daher keine bloße Dressur sein, vielmehr lernt das Kind den Wortschatz und die Regeln, mit deren Hilfe die Sätze der jeweiligen Muttersprache hervorgebracht, generiert werden können. Auch der Spracherwerb geschieht nicht in erleidender Weise, in dem Erwerb von Dispositionen, vielmehr gibt es nach Chomsky ein angeborenes Spracherwerbsverfahren, kurz LAD für language acquisition device genannt, das es dem Kind ermöglicht, sogar Hypothesen über die Grammatik der Sprache seiner Bezugspersonen aufzustellen. Die Initiative geht also von dem Kind aus, das die Äußerungen seiner Eltern und Betreuer als Anregung versteht, die richtige Grammatik zu entwerfen. (Dieter Münch: „Kognitivismus in anthropologischer Perspektive“. In: Peter Gold, G. Engel, Hg.: Der Mensch in der Perspektive der Kognitionswisssenschaft. Frankfurt 1998:17-48) Ein Text zum Fremdschämen (aber in verschiedenen Variationen oft anzutreffen, auch vom selben Verfasser). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.12.2023 um 05.02 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#51329 Wie geschickt Zunge und Lippen sind, bevor sie als Sprachorgane exaptiert wurden, sieht man nicht nur an den Affen, sondern darauf deutet auch ihre raumfüllende Repräsentation in den bekannten "Rindenmännchen" (Homunkuli) beiderseits der Zentralfurche hin. Erinnern Sie sich noch an Ihr Biologiebuch? Man muß bloß die "Zungenfertigkeit" ebenso wie die Geschicklichkeit der Hand richtig interpretieren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.12.2023 um 07.35 Uhr |
|
In letzter Zeit habe ich mich öfter über die organischen Voraussetzungen der Sprache geäußert, insbesondere über die bereits gegebene „Zungenfertigkeit“, die dann per Exaptation in den Dienst der Sprache gestellt werden konnte. Wie es der Zufall will, bringt die SZ zu Silvester einen aus „Science“ übersetzten Beitrag zur Evolution der Zunge bei den Wirbeltieren. Die hirnphysiologischen Teile (Interpretation von Hirnscans) sind immer noch sehr spekulativ, Zunge und Hand gemeinsam steuernde Regionen der Großhirnrinde sind nur grob lokalisiert, aber immerhin ein Schritt auf dem richtigen Weg. Besonders Kinder bewegen gern sichtbar die Zunge bei feinmotorischen Aktivitäten der Hand, auch beim Schreiben; Erwachsene tun das gleiche mit geschlossenem Mund. Das ist schon lange bekannt, aber wenn man nun etwas ähnliches bei Mäusen beobachtet, sollte doch die ungeheure stammesgeschichtliche Entfernung beachtet werden (was übrigens auch für andere Parallelen aus dem Tierreich gilt: man darf unsere nächsten Verwandten nicht überspringen). Die Neurowissenschaftler freuen sich mit Recht, wenn sie eine „oromanuelle Region“ im Gehirn entdecken oder die Funktion einer Region, die immerhin die vergleichsweise riesige Ausdehnung einer Zwei-Cent-Münze hat, oder wenn sie andere herkömmliche Vorstellungen „kippen“. Aber eigentlich sind solche Fortschritte ein Desaster, zeigen sie doch, wie grob unzulänglich die ganze Forschung immer noch ist. Man stelle sich vor, im Starnberger See würde ein bisher unbekannte, von Neandertalern bewohnte Insel entdeckt... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.01.2024 um 18.28 Uhr |
|
Weiter zum Anthropologischen (sich über Alltägliches zu wundern ist der Anfang der Weisheit): (auch zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#48266) Zu den Universalien, die den Menschen kategorisch oder graduell von anderen Tieren unterscheiden: Fast alle Menschen tragen Kleidung, und ebenso verbreitet ist die vorübergehende oder dauerhafte Veränderung des Körpers durch Bemalung, Depilation und Epilation, Beschneidung usw. Die AOK macht sich Gedanken über die Funktion der Schambehaarung: „Forscher glauben, dass Schamhaare hauptsächlich dazu da sind, um diese drei Funktionen zu erfüllen: Sie reduzieren die Reibung beim Laufen oder beim Sex. Das ist ein Vorteil, da die Haut im Genitalbereich sehr empfindlich ist. Sie verhindern, dass Bakterien und andere Keime über die Geschlechtsteile in den Körper gelangen. Keime können in den Schamhaaren abgefangen werden. Es wird zudem vermutet, dass Schamhaare das Risiko für sexuell übertragbare Krankheiten verringern können. Sie halten die Temperatur der Geschlechtsorgane im optimalen Bereich, verhindern Überwärmung oder Unterkühlung bei Nacktheit. Eine weitere Theorie über die Funktion der Schamhaare ist, dass an ihnen menschliche Duftstoffe, sogenannte Pheromone, gut haften bleiben, was möglicherweise für das Sexualverhalten vorteilhaft ist. Außerdem ist das Wachsen der Schamhaare in der Pubertät ein optisches Zeichen, dass ein Mensch nun geschlechtsreif ist.“ Ich finde die nachgetragenen Funktionen plausibler als die drei zuerst genannten. Daß ohne Schamhaare beim Geschlechtsverkehr Reibungsschäden der Haut entstehen könnten, kommt mir ausgedacht vor. Irritationen der Haut scheinen eher mit der Enthaarung verbunden zu sein. Der Primat des Geruchssinns leuchtet heute weniger ein, aber das ist ein sehr rezentes Phänomen. Der visuelle Signalwert des Schamhaars wird auch dadurch wahrscheinlicher, daß es meist dunkler ist als das Kopfhaar. Anthropologische Begründungen scheitern an der Tatsache, daß große Teile der Menschheit die Schamhaare (und die Achselhaare) nicht entfernen, soweit sie noch nicht unter neuzeitlichen amerikanisch-europäischen Einfluß geraten sind. Wenn wir schon bei Just-so-stories sind: Die Entferung von Haaren könnte im Sinne eines Opfers (wie die Beschneidung) aufgekommen sein. Darauf deutet die Tonsur hin. (Vgl. Cranachs bekannte Bildnisse Luther mit Tonsur und dann als Junker Jörg mit Haaren.) Indische Asketen wiederum verzichten gerade auf das Schneiden des Haars. „Viele Frauen geben an, sich ohne Schambehaarung femininer und attraktiver zu fühlen. Auch ursprünglich mit erheblicher Körperbehaarung bekannte Männer wie Burt Reynolds oder David Hasselhoff wendeten sich einem haarlosen Stil zu, der früher eher mit der Schwulenszene assoziiert wurde.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperhaarentfernung) Die Begründung mit dem „Schönheitsempfinden“ (ebd.) ist leer, weil dieses ja auch erklärt werden müßte, das Problem also nur verschoben wird. Hygienische Begründungen (Filzläuse kommen in Betracht) erregen immer den Verdacht, moderne Rationalisierungen zu sein. Sie sind auch unplausibel angesichts der sonstigen Zustände bei unseren Vorfahren. Es ist auch nicht zu erkennen, daß behaarte Menschen eher krank wären. „Es gibt keine hygienische Notwendigkeit für eine Entfernung der Schambehaarung.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Schamhaarentfernung) Könnte die Entfernung der Körperbehaarung fortsetzen, was die Evolution mit dem Menschen als dem „nackten Affen“ angestellt hat? „Der Verlust von Fell in der menschlichen Evolution ermöglichte dem Menschen in seinen damaligen warmen Lebensräumen die Körpertemperatur besser zu regulieren (Schwitzen). Dies erhöhte seine Ausdauer zur Nahrungsbeschaffung bei der Hetzjagd. Mit der Erfindung der Kleidung wurde der damit auch verbundene Nachteil wieder kompensiert. Die Möglichkeit, unterschiedlich stark wärmedämmende Kleidung verwenden zu können, erhöht die menschliche Flexibilität, sich in sehr unterschiedlichen Klimazonen aufhalten zu können.“ (Wikipedia Kleidung) Alternativ könnte man daran denken, daß Nacktheit den Hautkontakt der hypersozialen Gattung Mensch erleichtert. Babyhaut bei Erwachsenen zapft das Zärtlichkeitsreservoire der Brutpflege an. Zur Hetzjagd: Es ist wahr, daß der trainierte Mensch, besonders der Mann, ein ausdauernder Läufer ist, der jede Gazelle durch bloßes Hinterherlaufen erbeuten kann. Das ist in der Kalahari zweifellos ein schweißtreibendes Unterfangen. Aber wie verbreitet ist oder war diese Jagdmethode eigentlich? Die Höhlenmalerei zeigt bewaffnete Jäger, keine Läufer bei der Hetzjagd. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.01.2024 um 06.15 Uhr |
|
Die Stammesgeschichte der Sprache ist umstritten wie wenige andere Gebiete. Nicht nur die Datierungsversuche schwanken um den Faktor 10.000, es ist auch unklar, ob Sprache nur einmal oder an vielen Orten parallel entstanden ist, ob sie sich über lange Zeiträume herausgebildet oder nach einer einmaligen „Fulguration“ sehr schnell in ein vollgültiges, relativ unabhängiges Verständigungsmittel nach Art der uns heute bekannten Sprachen verwandelt hat. Manche Forscher nehmen an, daß eine einzige Mutation die Sprachentwicklung auf den Weg gebracht hat. So könnte die Entdeckung der Syntax, einer praktisch unendlich produktiven Kombinatorik, sozusagen im Handumdrehen die Kreativität ausgelöst haben, die man heute als wesentliches Merkmal der menschlichen Sprache ansieht. Andere neigen dazu, die Sprachfertigkeit auf das Zusammenspiel mehrerer, für sich genommen unspezifischer Fähigkeiten zurückzuführen. Auf diesem Weg muß man sich nach Verhaltensweisen umsehen, die entweder ausschließlich oder doch in besonderem Maße dem Menschen eigentümlich sind, also anthropologischen „Universalien“ (nicht zu verwechseln mit den bekannten Katalogen sprachlicher Universalien von Greenberg u. a.). In Betracht kommen (Neufassung meiner früheren Liste): Zeigen (und Verstehen von Zeiggesten) Hochhalten von Gegenständen, um sie anderen zu zeigen usw. Hinführen anderer zu Gegenständen Überreichen und Anbieten von Gegenständen („geben“) Präzisionswerfen Lachen und Weinen Lächeln bildliches Darstellen (Zeichnen, Modellieren) Konstruktives Bauen, Justieren, Zentrieren Musik und Tanz Nachahmung (graduell) Verstellungsspiel Lehren durch Vormachen (< Verstellung) Lernen durch Üben (< Verstellung) voll opponierbarer Daumen (Präzisionsgriff, graduell gegenüber Affen) Kleidung und Kosmetik einschl. Epilation, Depilation, Beschneidung usw. (graduell, s. vorigen Eintrag) Anderes wie Selbstmord und Unterhalt des Feuers ist wohl erst mit Sprache möglich. Dieser Katalog, der sich zweifellos verlängern ließe, wirft Fragen auf: Sind die Merkmal elementar oder, wie teilweise vermerkt, auf einander oder auf anderes zurückführbar? Hängen sie untereinander zusammen – und wie? Welche Merkmale kommen als Grundlage der Sprache in Frage? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.01.2024 um 03.53 Uhr |
|
In einem Interview mit der SZ spricht Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard über Schönheit im Tierreich – das Thema eines oft gehaltenen Vortrags und eines Teils ihrer populärwissenschaftlichen Bücher. (2.1.24) In Wirklichkeit geht es um die Entstehung von Zeichen und Kommunikation durch empfängerseitige Semantisierung. Das ist phylogenetisch von Ethologen, ontogenetisch von Skinner viel klarer dargestellt wurden. Sie spricht von „ästhetischer Selektion“, weil Muster durch einen anderen Organismus wahrgenommen werden müssen, um zu Zeichen zu werden. „Ästhetisch“ ist hier also im ursprünglichen Sinn gebraucht und hat nichts mit Schönheit zu tun. Nüsslein-Volhard fügt hinzu, daß Wahrnehmung allein nicht genügt, der Empfänger muß auch reagieren, damit das Zeichen ausgebildet wird. Der Ausdruck „ästhetische Selektion“ ist also irreführend. Auch wird Schönheit unterderhand mit Attraktivität gleichgesetzt. So kommt sie unnötigerweise zu der Ansicht, daß Zebrafische einander schön finden, während biologisch nur festgestellt werden kann, daß die Färbung der Erkennung, Schwarmbildung und Paarung dient. Diese Funktion und damit auch die sexuelle Attraktivität kann objektiv gemessen werden, „Schönheit“ dagegen nicht. Mimikry, Warn- und Tarnfarben sind die augenfälligsten Beispiele von empfänigerseitig semantisierten Mustern, also Zeichen. Die populäre Darstellung führt auch zu Unklarheiten und Fehlern. Die Wespe täuscht mit ihrer Warnfärbung nicht Gefährlichkeit vor, sie ist gefährlich. Das Vortäuschen (die Signalfälschung) findet man erst bei harmlosen Fliegen, die sich wie Wespen färben. Auch sind beim Pfau nicht die Schwanzfedern zum Rad ausgebildet. Der Schwanz ist ein unauffälliger Bürzel. Zu den anthropologischen Grundlagen von Schmuck und Kosmetik müsse psychologisch mehr geforscht werden, meint sie am Ende; allerdings gibt es dazu eine reichhaltige Literatur, die sie vielleicht als Biochemikerin nicht kennt. Den Anfang macht der Vorsokratiker Xenophanes: „Wenn Kühe, Pferde oder Löwen Hände hätten und damit malen und Werke wie die Menschen schaffen könnten, dann würden die Pferde pferde-, die Kühe kuhähnliche Götterbilder malen und solche Gestalten schaffen, wie sie selber haben.“ „Die Neger behaupten, ihre Götter seien stumpfnasig und schwarz, die Thraker, blauäugig und blond.“ |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.01.2024 um 06.28 Uhr |
|
Die traditionelle mentalistische Psychologie geht von den Vorgaben der Alltagspsychologie aus und versucht deren Begriffe (Vorstellung, Denken, Wille...) zu präzisieren und zu wissenschaftlichen Begriffen zu machen. Dazu sind sie jedoch nicht geeignet, so gut sie auch bei der Koordination des gesellschaftlichen Lebens funktionieren. (Daß sie dies tun, versteht sich von selbst, dann dafür wurden sie entwickelt.) Ihre Eigenart als transgressive Konstrukte verbietet jedoch eine Präzisierung. Es hat daher keinen Sinn zu fragen, was das Denken, die Vorstellung, der Wille usw. „wirklich“ ist. Das liefe wieder auf die „Wahrheit über Rotkäppchen“ hinaus. Man muß sich auf die Analyse des Gebrauchs solcher Ausdrücke und des Wandels durch die Zeiten, der Funktion und der interkulturellen Unterschiede usw. beschränken, die folkpsychologische Redeweise also von außen betrachten, ohne sie selbst zu benutzen. Hätte die Psychologie mit der Erforschung der Tiere begonnen, wäre sie nie auf eine solche mentalistische Begrifflichkeit verfallen. Der Behaviorismus holt diesen sozusagen versäumten Neuanfang nach. Die Alltagspsychologie ist keine allenfalls durch Forschungen zu überholende Theorie, wie die antike Auffassung über Sonne, Mond und Sterne eine Theorie war, die nach und nach von Astronomen korrgiert wurde und zur Zeit weiter korrigiert wird (Dunkle Materie usw.). Eher ist sie mit der Astrologie und Mythologie zu vergleichen, die keine solche Fortsetzung und Verbesserung finden konnten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.02.2024 um 06.58 Uhr |
|
Auch die willkürliche Lenkung der Aufmerksamkeit hat ihre Ursachen in der Vergangenheit. Man kann Tauben dazu bringen, „auf etwas zu achten“ – wenn es für das folgende Verhalten relevant ist. So lernen auch Kinder zuzuhören, wenn es sich lohnt. Vertreter des „freien Willens“ können nicht erklären, woher der Wille kommt. Statt des unerklärlichen Agens im Kopf des Handelnden greift die Verhaltensanalyse auf die Konditionierungsgeschichte zurück. In der therapeutischen oder pädagogischen Praxis arrangiert man Umgebungen, die das erwünschte Verhalten verstärken. Wenn man darauf verzichtet, fördert man nicht „Freiheit und Würde“ (freedom and dignity) des Menschen, sondern überläßt ihn der zufälligen und potentiell schädlichen Steuerung durch die Umstände. Konditioniert („sozialisiert“) wird er so oder so. In seinem umstrittensten (und am meisten mißverstandenen) Werk „Beyond freedom and dignity“ (ein provozierender, aber wohlberechneter Titel) zeigt Skinner, daß die Folgen der angeblichen „Freiheit“ unerfreulich genug sind, um sich etwas anderes zu überlegen. Wenn wir schon unausweichlich von unserer Umgebung konditioniert werden, dann sollte man diese Umgebung nach und nach so gestalten, daß unser Verhalten bessere Ergebnisse bringt. Dies geschieht am besten durch Belohnung, also eine Prämie auf erwünschtes Verhalten. Diesen durchweg positiven Charakter seiner auch als Utopie („Walden Two) ausgearbeiteten Sozialtechnologie drückt der Begriff „non-punitive society“ aus. Im Grunde wird das ja auch überall praktiziert (Schule, Verhaltenstherapie), nur ohne Gesamtkonzept und unzureichend. (Das Gesamtkonzept, die Einwände namhafter Kritiker und Skinners Antwort findet man in Harvey Wheeler, Hg.: Beyond the punitive society. San Francisco 1973.) Skinner gibt eine behavioristische Definition der „Frage“, die man Tieren stellen kann. Die Fragestellung liegt in der Versuchsanordnung. Im gleichen metaphorischen Sinn, wie man „Fragen an die Natur“ stellt, nämlich im Experiment, kann man durch eine geschickte Versuchsanordnung auch Tiere „fragen“, ob sie einen Reiz wahrnehmen usw. Um eine Metapher handelt es sich, weil solche Befragungen nicht zeichenhaft vermittelt sind. Physikalische „Fragen an die Natur“ im Sinne Galileis sind harmlos; erst bei „Fragen“ an Tiere muß man sich hüten, den Versuch nicht als sprachlich fehlzudeuten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.02.2024 um 05.39 Uhr |
|
„Enculturated apes Kanzi, Washoe, Sarah and a few others who underwent extensive language training programs (with the use of gestures and other visual forms of communications) successfully learned to answer quite complex questions and requests (including question words ‘who’, ‘what’, ‘where’), although so far they have failed to learn how to ask questions themselves. For example, David and Anne Premack wrote: ‘Though she [Sarah] understood the question, she did not herself ask any questions — unlike the child who asks interminable questions, such as What that? Who making noise? When Daddy come home? Me go Granny’s house? Where puppy? Sarah never delayed the departure of her trainer after her lessons by asking where the trainer was going, when she was returning, or anything else’. The ability to ask questions is often assessed in relation to comprehension of syntactic structures. It is widely accepted that the first questions are asked by humans during their early infancy, at the pre-syntactic, one word stage of language development, with the use of question intonation.“ (Nach Wikipedia „Question“) Die „Fragen“ an einen Affen sind nicht von anderen Aufforderungen zu unterscheiden. Daß die Affen selbst keine Fragen stellen, deutet darauf hin, daß ihnen die reale Voraussetzung, das Informationsbedürfnis, so fremd ist wie die Sprache. Sie „wissen“ daher nicht, was der Fragende von ihnen will, sondern tun, wozu sie konditioniert sind. Der äußere Ablauf ähnelt einem Frage-und-Antwort-Spiel, aber in Wirklichkeit ist es nicht möglich, Affen nach etwas zu fragen. Fragen haben in ihrem Leben keinen Platz. „A pigeon, for example, can be induced to behave in ways which, if the subject were human, would be said to report its sensations or perceptions. Special techniques make it possible to ‘ask a pigeon whether or not it sees a faint spot of light,’ and, with them, the spectral sensitivity of the pigeon has been determined with almost as much precision as that of man.“ (B. F. Skinner in Harvey Wheeler, Hg.: Beyond the punitive society. San Francisco 1973:259) Man kann leicht eine Versuchsanordnung entwerfen, die erkennen läßt, ob ein Tier einen Unterschied in seiner Umgebung (z. B. Farben) wahrnimmt oder nicht. Das hat mit Sprache nichts zu tun, weshalb Skinner die „Frage“ in Anführungszeichen setzt. Der Wikipedia-Artikel setzt außerdem einen naiven Begriff von Sprache voraus, wenn er kleinen Kindern ein „vorsyntaktisches“ Stadium zuschreibt, als äußerten sie sich in ungegliederten Lauten wie Tiere. In Wirklichkeit ist das „holistische“ Sprechen des Kindes von Anfang an etwas anderes – eingebettet in Interaktionen, die sich im Laufe des ersten Lebensjahres ganz anders entwickelt haben als die eines Affen. Das sogenannte Ein-Wort-Stadium ist weder mit dem Knurren eines Hundes noch mit den Lauten eines Papageien zu vergleichen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.02.2024 um 05.49 Uhr |
|
Es scheint eine ausgemachte Sache zu sein, daß die Sprachfähigkeit ein biologischer Zug des Menschen ist und sich als Ergebnis der Evolution untersuchen läßt. Eine von 100.000 Stimmen: “Language has apparently evolved only in us (...). It is surprisingly hard to think of ‘good ideas’ that have evolved only once.” (nach Richard Dawkins: The ancestor’s tale. London 2004:592) Aber das täuscht vielleicht. Wenn die Sprache eine Exaptation oder einfach die Zusammenführung von anderen, nicht so singulären Entwicklungen ist, dann kann man nicht sagen, daß die Sprache überhaupt sich phylogenetisch entwickelt hat. Sie hat auch vielleicht zunächst keinen Vorteil gebracht, sondern wie ein überschießendes Spiel gewirkt, dessen Möglichkeiten erst im Laufe sehr langer Zeiträume „entdeckt“ wurden. Es würde dann ausschließlich um Kulturgeschichte gehen und nicht um Biologie. Das gilt natürlich erst recht für den „Geist“, den die Leute sprachverführt annehmen und dann ebenfalls für ein biologisches Merkmal halten (Chomsky, Searle...). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.02.2024 um 05.48 Uhr |
|
Die Evolutionsfähigkeit selbst hat sich entwickelt (Dawkins: evolution of evolvability). Dadurch wird an bestimmten Punkten (watershed events) eine diskontinuierliche Beschleunigung in Gang gesetzt. Dieser Gedanke hat immer weitere Anwendung gefunden, vgl. John Maynard Smith/Eörs Szathmáry: The major transitions in evolution. New York 1995. Kurze Übersicht in Dawkins: The ancestor’s tale. London 2004:499ff. Ein Beispiel wäre die „Entdeckung“ der Modularität, wovon Segmentation ein Beispiel ist: Gliederfüßler, Würmer usw., die schlagartig mehr Module der gleichen Art ansetzten. Allmählich geht das gar nicht, nur in ganzen Schritten. Auch Zellen sind Module. (Ancestor 605ff., down 499ff. über evolvability). Es muß ein Gen geben, das gewissermaßen den Befehl gibt, ein ganzes Segment auszubilden (oder eine zusätzliche Extremität, ein weiteres Auge usw.) Dawkins vergleicht das gern mit der Verlängerung eines Flugzeugs: Es ist leichter, den Passagierraum um einige Segmente zu verlängern, als ein völlig neues, größeres Flugzeug zu entwickeln. Gibt es in der Kulturgeschichte Vergleichbares? Gesellschaftliche Umbrüche, die Explosion der Kultur in der athenischen Demokratie, die Galileische Revolution der Naturwissenschaft? Könnten in der historischen Entwicklung der Sprache solche Punkte eine Rolle spielen? Entdeckung der Prosa, der Logik? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.02.2024 um 18.30 Uhr |
|
„...few scholars have argued that the behaviourists’ ‘general learning mechanisms’—Skinners ‘tacts’ and ‘mands’—are up to the task.“ (Tecumseh Fitch in Maggie Tallerman and Kathleen R. Gibson, Hg.: The Oxford Handbook of Language Evolution. Oxford 2012:144) Was haben die Lernmechanismen mit Tacts und Mands zu tun? Und wo spricht Skinner eigentlich von einem „general learning mechanism“? Ich erinnere mich nur an Zuschreibungen durch seine Kritiker. Was er allerdings nachgewiesen hat, sind sehr ähnliche Lernkurven und -gesetzmäßigkeiten quer durch die Arten. Diese Ergebnisse sind leicht replizierbar und bisher auch nicht angefochten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.02.2024 um 16.54 Uhr |
|
Ein Mädchen (5;5) fragt beim Ankleiden: "Wie ist es nun richtig? Kommt das Baby aus dem Popo oder aus dem Bauch?" So richtig vorstellen kann man sich ja beides nicht. Es aber bestimmt am besten, man beantwortet die Fragen, wenn sie gestellt werden und die Kinder auch die richtigen Worte dafür haben, statt es ihnen vorzeitig aufzudrängen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.02.2024 um 05.39 Uhr |
|
Wenn ein Teenager Beethoven spielt, kommt es uns ganz unwahrscheinlich vor, daß solche Fingerfertigkeit möglich ist. Aber wir haben ja die zehn Jahre täglicher Übung noch in Erinnerung, und da war der ständige Fortschritt ganz natürlich. Bei alltäglichen Beschäftigungen wird dieses Mikrolernen weniger beachtet und ist auch kaum untersucht. Am ehesten noch die Sprachentwickung, die man ja auch als zunehmende Geschicklichkeit beschreiben kann und nicht nur in grammatischen Begriffen. Eine vollständige Darstellung wäre bestimmt aufschlußreich. Die Vierjährige zeigt mir, daß sie einen Ball zu Boden fallen lassen und mit einer Hand wiederauffangen kann. – Man müßte eine Tabelle machen, die Tausende solcher Beobachtungen auf einem Zeitstrang ordnet. Die Nativisten argumentieren angesichts der vollendeten Geschicklichkeit: Das kann nicht gelernt, das muß angeboren sein! Der Empirist sagt: Das kann nicht angeboren, das muß gelernt sein! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.02.2024 um 08.38 Uhr |
|
Vor vielen Jahren hörte ich in einem Berliner Kindergarten, wie eine Frau aus dem Volk ihr Kind belehrte: "Es heißt nicht kleen, es heißt klein." Dies und noch weiteres in breitestem Berlinerisch. Wir haben als Kinder gelernt, daß es heißt "normal", aber "anomal", wo das r aus unerklärlichen Gründen wegfällt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.03.2024 um 08.31 Uhr |
|
Die ältesten Steinwerkzeuge werden auf 2,5 Mill. Jahre geschätzt, und wir wissen nicht, was davor lag. Es gibt keinen Grund, diese Hominiden für sprachlos zu halten. Vielleicht könnte man zeigen, daß die Werkzeugherstellung ein ähnliches Grundverhalten wie die Sprache voraussetzt und kombiniert. Ich denke an Vor- und Nachmachen, Rückkoppelung durch die „Sachsteuerung“ usw. Ich vermute, daß auch die primitivste menschliche Werkzeugherstellung sich von den bekannten Tätigkeiten mancher Menschenaffen (Zurechtbeißen eines Zweigs zum Termitenangeln) grundsätzlich unterscheidet, etwa durch Maßnehmen an einem Muster oder eben durch „Lehren“. (Tiere lehren nicht.) Die bekannteren Schätzungen zum Alter der Sprache schwanken also um 1:100, der Größenordnung nach. Die Untersuchung müßte von mentalistischen Metaphern freigehalten werden. Solange man „kognitiven“ Fähigkeiten nachspürt, kommt man nicht weiter. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.03.2024 um 12.12 Uhr |
|
Es gibt ja die experimentelle Archäologie, auch wenn sie noch in den Kinderschuhen steckt. Ich weiß aber nicht, ob die Forscher sich der ganzen Problematik bewußt sind. Wenn sie wochenlang üben, Faustkeile und Steinklingen herzustellen, werden sie der technischen Schwierigkeiten gewahr. Aber sie gehen ihre Aufgabe gewissermaßen „von oben her“ an. Sie wissen ganz genau, worauf sie hinauswollen, und haben das z. B. in ihren Drittmittelanträgen formuliert. Unsere Vorfahren hatten keine solchen Vorstellungen, sondern mußten allmählich Wege finden, ihre technischen Fortschritte weiterzugeben und auf diese Weise zu akkumulieren. Das dauerte. Ich habe schon mehrmals erwähnt, daß Faustkeile mindestens 500.000 Jahre unverändert hergestellt wurden, und auf die Möglichkeit hingewiesen, daß diese Kulturtechnik (ebenso wie die Unterhaltung des Feuers) durch strengste Tabus vor jeder (stets prekären) Neuerung bewahrt wurde. Nur der ethnologisch-vergleichende Blick kann uns zeigen, wie auch die einfachste Kulturtechnik weitergegeben wird. Erfände heute jemand den Faustkeil, würde schon im kommenden Jahr ein verbessertes Modell erscheinen... (Absurder Gedanke, denn die Lage ist nicht vergleichbar.) Immerhin scheint die Kulturtechnik der Steinbearbeitung nie wieder verlorengegangen zu sein, auch nicht die des Feuerunterhaltens und später des Feuermachens, und natürlich die der Sprache. Man stellt sich ja gern vor, daß die Sprache – wenn die „kognitiven Voraussetzungen“ einmal gegeben sind – jederzeit wieder „erfunden“ werden konnte. Mag sein, aber sicher ist es nicht. Statt der „kognitiven Voraussetzungen“ (was immer das ist) der technischen Fertigkeiten sollte man die gesellschaftlichen Voraussetzungen einer Kulturleistung und -weitergabe untersuchen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.03.2024 um 08.45 Uhr |
|
Problemlösen ist ein wichtiges Kapitel der traditionellen Psychologie. Man behandelt es entweder durch logische Rekonstruktion oder durch Anwendung des Handlungsschemas. Damit macht man das Problemlösen zwar vertraut, erklärt es aber nicht. Denn sowohl die logische Analyse als auch der Beratungsdialog, aus dem die Problemlösung hervorgeht, sind erklärungsbedürftiges Verhalten. Erst Skinner geht andere Wege („An operant analysis of problem solving“. Behavioral and Brain Sciences 7/1984:583-591, als eine der „kanonischen Schriften“ mehrmals abgedruckt, dt. in: Die Funktion der Verstärkung in der Verhaltenswissenschaft. München 1974). Wenn man ein Problem und seine Lösung nur logisch rekonstruiert, stellt man die Psychologie in die Tradition der Phänomenologie und damit der Scholastik, wie es noch im Buchtitel Christian Wolffs zum Ausdruck kommt: „Psychologia rationalis sive logica“ (1728). Diese sprachgeleitete, vermeintlich „introspektive“ Psychologie wurde bis ins 20. Jahrhundert von philosophischen Lehrstühlen mitvertreten. Es war eine Psychologie ohne Forschung (in unserem Sinn). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.03.2024 um 07.32 Uhr |
|
Frans de Waal ist gestorben (14.3.24). Tina Baier, die in der SZ jahrelang seine anthropomorphisierende Interpretation des Verhaltens von Tieren, hauptsächlich Menschenaffen, weitergegeben hat, tut das auch im Nachruf, erwähnt aber immerhin auch die Kritiker. Ihnen hält sie entgegen, daß TIME ihn 2007 zu einem der 100 einflußreichsten Menschen der Welt (!) gekürt habe. Ich habe hier schon öfter die Willkür in seinen deutenden Verhaltensbeschreibungen hervorgehoben, die nicht mehr erkennen lassen, was wirklich geschah.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.03.2024 um 12.46 Uhr |
|
Zu Frans de Waal: Ein Äffchen soll einen „Wutanfall“ gezeigt haben, weil es für das gleiche Kunststück einen geringeren Lohn (Gurke statt Weintraube) erhalten hat als sein Artgenosse im Nachbarkäfig. Frans de Waal sieht darin einen Vorläufer des Gerechtigkeitssinnes. Solche anekdotischen Berichte zusammen mit anthropomorphisierenden Deutungen füllen die Seiten populärwissenschaftlicher Bücher und Zeitungen und gefallen einem großen Publikum. Methodisch ist einzuwenden, daß es sich nicht um halbwegs replizierbare Versuche handelt und Angaben darüber fehlen, wie oft solches Verhalten beobachtet worden ist. Vor allem aber: Unser moderner Begriff von Verteilungsgerechtigkeit – gleicher Lohn für gleiche Leistung – beherrscht nicht einmal alle menschlichen Gemeinschaften, und zwar nicht nur faktisch, wodurch sich die aktuellen Kämpfe gerade unter diesem Schlagwort erklären, sondern er gilt auch nicht in vormodernen Kulturen. Die Verteilung oder besser Zuteilung nach anderen Kriterien, z. B. dem Rang, erscheint dort als natürlich und „gerecht“, soweit davon überhaupt geredet werden kann. Bei Platon wird erörtert, wie gerechte Verteilung aussehen könnte – nämlich sehr verschieden (allen das gleiche – jedem nach seinem Bedürfnis – jedem nach Verdienst...). Unter kleineren Affen, die den ganzen Tag hauptsächlich damit beschäftigt sind, ihre Rangordnung zu verteidigen, wäre „gleicher Lohn für gleiche Leistung“ erst recht absurd. Bei de Waal könnte der benachteiligte Affe „wütend“ geworden sein, weil er nicht den begehrten Leckerbissen bekommen hat, völlig unabhängig von der Leistung. Affen werden oft „wütend“, wenn sie ein Problem nicht lösen können. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.03.2024 um 04.19 Uhr |
|
(Den folgenden Text hatte ich anderswo eingetragen, bringe ihn aber hier, leicht verändert, an der richtigen Stelle noch einmal:) Bei vielen Tierarten ist es so, daß jeder dem anderen einen Leckerbissen wegzuschnappen versucht. So etwa bei den Möwen. Von Kooperation keine Spur; wir Menschen sehen es mit Kopfschütteln, weil wir uns denken, anders wäre es besser, aber das ist natürlich naiv und unbiologisch gedacht. Anders dagegen bei Katzen, denen ich oft zugesehen habe: Wenn der Kater etwa ein Jungkaninchen erbeutet hatte, verzehrte er es im Hausflur, während seine gleichaltrige Schwester danebensaß und zuschaute, allerdings nicht sehr gierig, sondern halb schläfrig. Wenn er fertig war, ging er davon, und sie machte sich über die Reste her. (Man könnte sagen: Sie wußte, daß sie ihren Anteil bekommen würde, aber das ist überflüssig und ändert nichts. Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#49379) Kein rangniedriger Affe wird versuchen, einem höheren etwas wegzunehmen, es sei denn mit List. Dieses Spiel beschäftigt die Affen den ganzen Tag. Oft artet es auch in lautstarke Massenschlägerei aus, wie von Musil beschrieben. Man muß diese Unterschiede beachten, wenn man über Verteilung zwischen Tieren berichtet. Die Unterbringung zweier Äffchen in getrennten Plexiglaskäfigen, wo sie einander sehen, aber nicht interagieren können, ist völlig unnatürlich und schneidet das angeborene Verhalten bis zur Unkenntlichkeit ab. Frans de Waal hat jahrzehntelang naive und irreführende Ansichten über Tiere und Menschen popularisiert, u. a. in nicht weniger als 16 Büchern dieser Art. Gut fürs Feuilleton, schlecht für die Wissenschaft. Das müssen nicht nur Behavioristen so sehen, sondern auch Evolutionsbiologen wie Dawkins und klassische Ethologen der Tinbergen/Lorenz-Schule. Volker Sommer fordert mit Recht, nicht nur Tiere zu entanthropomorphisieren, sondern den Menschen zu zoomorphisieren (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#50390) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.03.2024 um 17.12 Uhr |
|
Das wütende Äffchen in seinem Plexiglaskäfig war bestimmt FDP-Mitglied („Leistung muß sich wieder lohnen“). Aber wie gesagt, der nicht gerade natürliche Begriff der Gerechtigkeit kann ganz verschieden mit Inhalt gefüllt werden: 1. Der Mächtige kriegt das meiste (Recht des Stärkeren, Sozialdarwinismus, Kallikles-Moral), 2. Verteilung nach Leistung (FDP, Grille und Ameise), 3. Verteilung nach Leistungserwartung (Bienenkönigin, Studienstiftler), 4. Verteilung nach individuellem Bedarf, 5. Nachteilsausgleich (vermögenswirksame Leistungen), 6. Alle kriegen gleich viel (Kindergeld). Bei Jägern und Sammlern teilt der Stammesälteste zu, was jedem gebührt, basta! Die Betroffenen kennen nichts anderes, keine abstrakte „Gerechtigkeit“. Später, bei Hofe, gibt es „Gunst“, auch Eifersucht, aber keine Gerechtigkeit. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 20.03.2024 um 23.02 Uhr |
|
Daß die Äffchen Weintrauben lieber mögen als Gurken, zeugt ja wenigstens von etwas Geschmack. Auch wenn man sieht, wie Bären sich für für ein bißchen Honig zerstechen lassen, oder wie sie sich an Lachsen laben, das muß doch schon etwas mit Geschmack zu tun haben. Aber im allgemeinen stellen mich Tiere vor ein Rätsel. Wenn eine Schlange ihren Kiefer ausrenkt, um ein ganzes Ei mit Schale zu verschlingen, das erst in ihrem Leib zerbricht, wenn ein Vogel einen ganzen zappelnden Fisch verschlingt, wenn große Tiere kleinere im wahrsten Sinne des Wortes mit Haut und Haar hinunterwürgen, oft sogar im ganzen, wo bleibt da der Geschmack? Vom Dreck und Schlamm, der dabei mit verdrückt oder gesoffen wird, ganz zu schweigen. Geschmack scheint doch eine recht unwesentliche Zutat im Tierreich zu sein, Hauptsache der Magen ist voll. Vor allem, so kommt es mir vor, wurde der Geschmack zum Vergnügen des Menschen geschaffen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.03.2024 um 04.49 Uhr |
|
O nein! Der Geschmack – also im wesentlichen der Geruch – ist etwas ganz Elementares und für die meisten Tiere das A und O. Dieser chemische Sinn dient der Orientierung, der Fortpflanzung und der Ernährung und beruht auf einem stark ausgebauten Teil des Nervensystems. Wir Menschen können auch ohne Geruchssinn auskommen; ich habe, wie ich jetzt erkenne, nie nachgeschlagen, ob Tiere (und welche?) in freier Wildbahn ohne Geruchssinn überleben. Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1103#30098 In der Qualia-Diskussion grübeln Philosophen darüber, ob du einen Geruch ebenso erlebst wie ich. Im allgemeinen wird aber die Sinnlosigkeit der Frage anerkannt. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 21.03.2024 um 10.15 Uhr |
|
Der Geruch ist natürlich noch mal etwas ganz anderes. Ich meinte hier wirklich nur den Geschmack, also das, was ein Tier beim Fressen im direkten Kontakt mit der Nahrung wahrnimmt. Wie mag wohl ein im ganzen verschlungenes Ei, Fisch, Maus usw. schmecken? Kann es überhaupt nach etwas schmecken?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.07.2024 um 06.24 Uhr |
|
Vor 40.000 Jahren soll es einen Sprung in der Entwicklung der menschlichen Kultur gegeben haben. Das liest man aus Veränderungen der Werkzeugherstellung, Siedlungsformen, Bestattungssitten und Kunst heraus. „This revolution is frequently attributed either to the onset, or to the sudden acceleration, of a new and distinctive human cognitive capacity.“ (Paul L. Harris: The work of the imagination. Malden u. a. 2000:7f.) Die Rede von „kognitiven Fähigkeiten“ fügt nichts hinzu, sondern umschreibt nur die Tatsache, daß sich die Artefakte veränderten. Es folgen Spekulationen über die Größe und Organisation des Gehirns, die sich nicht verifizieren lassen, schon weil es selbst bei lebenden Organismen nicht möglich ist, hirnanatomische Befunde mit „geistigen Fähigkeiten“ zu korrelieren. Es wird nicht erwogen, daß Veränderungen der menschlichen Kultur, die im Rückblick als überraschend schnell erscheinen, auf gesellschaftlichen Entwicklungen beruhen könnten. In einer Gesellschaft, die Neuerungen belohnt statt bestraft, kann der Fortschritt sich exponentiell beschleunigen. Man denke an die wissenschaftlich-technische Entwicklung in den letzten Jahrzehnten: vom Pferdefuhrwerk zur Weltraumstation hat es nur gut hundert Jahre gedauert, und noch heute leben auf der Erde Menschen mit steinzeitlicher Technik, deren Gehirne sich anatomisch nicht von denen hochzivilisierter Zeitgenossen unterscheiden. Es gibt zwar keinen Grund, die kulturelle Entwicklung des Neandertalers auf Nachahmung des zeitgenössischen Homo sapiens zurückzuführen (ebd.). Aber selbst wenn es zu Kulturkontakten gekommen ist, wäre dies ein normales gesellschaftliches Ereignis und kein Sprung in den „kognitiven“ Fähigkeiten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.07.2024 um 04.38 Uhr |
|
Paul L. Harris nimmt „mental state of pretending“ und „mental state of believing“ wörtlich und fragt, wann Kinder solche Tatsachen erkennen – wann sie also eine „Theory of mind“ haben. (The work of the imagination. Malden u. a. 2000:191) Er versucht nicht, Verstellung in Verhaltensbegriffen zu definieren, so daß auch die gelegentliche Korrelierung mit Hirnbefunden ins Leere geht. Mit bildgebenden Verfahren wird man trotzdem herausfinden, wo der geistige Zustand des Glaubens lokalisiert ist. Das spricht aber nicht für solche Zustände, sondern dagegen. Die alten begrifflichen Einwände gegen "geistige Zustände" bleiben davon unberührt.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.07.2024 um 05.34 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#48265 Man kann Probanden aus aller Welt eine Farbenkarte vorlegen und dann aufzeichnen, wie die Farben benannt werden und wie schnell ein Farbwort zugeordnet wird. Es folgt die exakte statistische Auswertung. Das ist vollkommen objektiv – und praktisch wertlos. Es fehlt an „ökologischer Angemessenheit“. Die Menschen stehen nie vor dem Problem, Farben kontextfrei zu benennen, und es ist kein Zufall, daß Gegenstände nirgendwo auf der Welt primär nach der Farbe kategorisiert werden. Aber es gibt solche Arbeiten in großer Zahl, Aufsätze, denen manchmal aufwendige Farbenkarten beigelegt sind usw. Die Versuche sind so schön einfach durchzuführen, bestens geeignet für studentische Qualifikationsarbeiten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.08.2024 um 07.20 Uhr |
|
Den Neandertalern wird „symbolisches Denken“ nachgesagt (https://de.wikipedia.org/wiki/Neandertaler). Das hat wenig Sinn, weil wir nicht wissen, was das ist – jenseits der konventionellen Redeweise. Uns selbst schreiben wir schmeichelhafterweise Denken und symbolisches Denken zu und fragen dann, ob Tiere, Kinder, Frühmenschen „auch schon“ so etwas haben. Bei Wikipedia wird über Zungenbein und FOXP2 bei Neandertalern geredet, als ob das für deren Sprachvermögen von Bedeutung wäre. Sie haben ihre Toten bestattet, das Feuer unterhalten, Kleidung und Schmuck hergestellt; das ist viel aussagekräftiger als die Anatomie. Der Drang, „hinter“ dem Verhalten etwas „Mentales“ oder „Kognitives“ zu vermuten, ist nicht totzukriegen. Im Grunde das Homunkulusdenken, das auch dem Kreationismus zugrunde liegt: Angepaßtheit muß auf Planung beruhen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.09.2024 um 05.17 Uhr |
|
Warum sollte man die Sprachen der Frühmenschen „Protosprachen“ nennen? Heutige Naturvölker haben wenig „ausgebaute“ Sprachen: keine Fachsprachen, keine Formalisierung wie in der Mathematik, keine akademischen Kommunikationsformen usw. Wir nennen sie aber nicht mehr Primitive und ihre Sprachen nicht Protosprachen, weil wir uns keine Herablassung gegenüber Naturvölkern erlauben. In der Sache ändert sich durch dieses Zugeständnis an den Zeitgeist nichts. Zwischen dem Leben solcher Völker und einer modernen technischen Zivilisation besteht eine enorme Kluft, die fast an verschiedene Spezies glauben lassen könnte, wenn man es nicht besser wüßte. Wenn die Sprachfähigkeit eine kulturelle und keine biologische Eigenschaft ist, hat es wenig Sinn, nach ihrer Evolution zu fragen. Auch anatomische und genetische Befunde haben dann keine Aussagekraft. Evolviert haben elementarere Fähigkeiten, auf deren Zusammenführung die Sprache beruht: Lachen und Weinen Lächeln Zeigen (und Verstehen von Zeiggesten) Hochhalten von Gegenständen, um sie anderen zu zeigen (sehen lassen). Hinführen von Artgenossen zu anderen Orten Überreichen und Anbieten von Gegenständen Präzisionswerfen (Jagd) bildliches Darstellen (Zeichnen, Modellieren) Konstruktives Bauen, Justieren, Zentrieren (Stapeln) Musik und Tanz Synchronisation gemeinsamer Anstrengungen Verstellungsspiel Lehren durch Vormachen (Verstellung) Lernen durch Üben (Verstellung) voll opponierbarer Daumen (? graduell mehr als die Altweltaffen, Präzisionsgriff) Selbstmord (wie Unterhalt des Feuers und Kult wohl erst mit Sprache möglich) (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#48266) Anscheinend ist noch nie gefragt worden, welche anatomischen und genetischen Grundlagen jede einzelne dieser (von Fall zu Fall diskutablen) Fähigkeiten hat. Das wäre aber erforderlich, wenn man nach der Biologie der Sprachfertigkeit sucht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.10.2024 um 08.49 Uhr |
|
In den Wissenschaften wird manchmal ein ziemlich verzerrtes Bild ihrer eigenen Geschichte gepflegt. In diesem Sinne sollten Sprachwissenschaftler nicht nur endlich die große Bedeutung der frisch entdeckten indischen Nationalgrammatik zu Beginn des 19. Jahrhunderts zur Kenntnis nehmen, sondern aus neuerer Zeit auch dies: „Through Jespersen (1921) and Bloomfield (1933/1961), we can also posit at least an indirect influence of Paul’s (1886/1889) work on Skinner’s (1957) Verbal Behavior. Both Bloomfield’s Language and, particularly, Jespersen’s Language referred to Paul with approval and offered a detailed description of important parts of his work. However, the possibility of a direct influence by Paul on Skinner’s ideas would be worth investigating. First, during the period (1922 to 1926) in which Skinner (1976) received his major in English literature (Hamilton College, New York), Paul’s Prinzipien was perhaps the most influential book in the field of linguistics. Its translation and adaptation to English, as well as the public commendations it received, indicate its impact on Anglo-American scholarship. Second, key aspects, as well as a few specific formulations, of Paul’s and Skinner’s approaches follow each other closely, as is outlined below.“ (Maria Amelia Matos/Maria de Lourdes Passos: „Emergent verbal behavior and analogy: Skinnerian and linguistic approaches“. The behavior analyst 33/2010:65–81) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.12.2024 um 06.36 Uhr |
|
Der Vokabelspurt des Kleinkindes erinnert an das „one-trial learning“, worin die Menschen besonders gut sind. Das Kind hört ein Wort und merkt es sich fürs ganze Leben. Die Enkelin (2;11) erklärt, ein fernes Motorengeräusch komme von einer „Flex“; die Oma kennt das Wort nicht, glaubt zuerst an ein Phantasiewort. Sie hört Lärm, hebt den Finger und sagt: „Ich höre die Baustelle“ (was zutrifft: Straßenbauarbeiten, denen sie einige Tage zuvor zugesehen hat). Ihr Vater habe den Adventskalender aufgehängt „mit einer Bohrmaschine“, es gebe auch noch eine „Akkubohrmaschine“. Auf dem Bauernhof zeigt sie auf den „Hofhund“. Zur Adventskerze berichtet sie: „Ich habe sie kräftig ausgepustet.“ Zweifellos hat ihre Mama gesagt: „Kräftig pusten!“ Das übernimmt sie in den Bericht; bemerkenswert ist die Selbstverständlichkeit der Konjugation. Die Aussprache ist korrekt und vollständig erworben. Wenn sie zwischen uns geht, wirkt sie noch sehr klein; um so erstaunlicher die verständigen Kommentare aus ihrem Mund. Übrigens haben wir den Eindruck, daß die Benennung der ungeheuerlichen Maschinen (Bagger, Walze, Bohrmaschinen) und Tiere (Pferde, Rindvieh) eine Art Bewältigung und Angstreduktion bedeutet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.12.2024 um 04.23 Uhr |
|
Bei Durchsicht meiner Aufzeichnungen stelle ich fest, daß ich noch im Sommer notiert hatte, die Artikulation der Enkelin (2;8) sei noch sehr unvollkommen (Dosch statt Frosch usw.). Kaum drei Monate später beobachte ich, daß die Aussprache nichts mehr zu wünschen übrig läßt. In dieser Hinsicht würde sie mit 2;11 den Schulreifetest bestehen. Gestern sagte sie beim Passieren einer Pferdekoppel: "Eine Koppel." Und in der Nähe des Bauernhofs: "Kühe sind Wiederkäuer." Dann erwähnt sie noch Ziegen und Schafe. Das kann auf die Sendung "Anna und die Tiere" zurückgehen, die sie mit den Eltern sehen darf. Ein offener Bauernhof in der Nähe wird auch oft besucht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.12.2024 um 04.39 Uhr |
|
Die Enkelin (2;11) fragt: „Wo stellt ihr eigentlich den Christbaum hin?“ Die Oma zeigt ihr den Platz neben dem Kamin, wo eine Zimmerpalme steht. Sie: „Dann kann ja die Palme auf die Terrasse.“ Die Oma erklärt ihr, daß die Palme aus einem warmen Land kommt und draußen erfrieren würde. Sie: „Dann könnt ihr doch den Christbaum auf die Terrasse stellen!“ Soviel zur Behauptung, die Fähigkeiten eines Schimpansen, eines Delfins, eines Graupapageien seien mit denen eines dreijährigen Kindes vergleichbar. (Ich habe zwar die Protokolle aus der Kindheit meiner drei Töchter zur Hand, aber damals kannte ich noch nicht die verstiegenen Thesen der Philo- und Neurosophen, darum nutze ich jetzt die Möglichkeit, bei den Enkelkindern noch einmal genauer hinzusehen. Hier kann jeder etwas beitragen.) Ich will noch hinzufügen, daß die Äußerungen des kleinen Mädchens keineswegs altklug wirken, sondern absolut natürlich und zum übrigen Verhalten passend, das man als geschäftig und stets wohl überlegt bezeichnen könnte. Außerdem fällt uns auf, daß sie auch die Unterhaltungen der Erwachsenen genau verfolgt und ihre Erkenntnisse alsbald in ihre eigenen Äußerungen einbaut. So scheint uns auch ihr "innenarchitektonisches" Interesse (wo etwas hingestellt werden könnte usw.) auf solche Gespräche zurückführbar, aber wir haben natürlich längst die Übersicht verloren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.12.2024 um 19.41 Uhr |
|
Dasselbe Mädchen (2;11) betrachtet ihre Kindergabel und erklärt, was ein Gabelstapler ist. Einen solchen hat sie am Vortag beobachtet. Sie sagt "Mama, sei mal leise, ich muß meine Schwiegereltern anrufen!" (Als Handy benutzt sie einen abgelegten Taschenrechner.) Sie hört mit, daß ihr Vater einen neuen Dienstwagen bekommt, und macht sich Gedanken, wie das Auto zu ihrem Haus kommt und wo das alte bleibt. Der Vater erklärt ihr, daß er mit dem alten zur Dienststelle fährt und dort das neue auf ihn wartet. Das versteht sie und ist zufrieden. Mir fällt in den letzten Tagen ein deutlicher Sprung in der Entwicklung des Satzbaus auf. Haupt- und Nebensätze werden komplett durchkonstruiert, und ihre Erzählungen sind zusammenhängend und durchweg verständlich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.12.2024 um 06.55 Uhr |
|
Gelegentlich ist bemerkt worden, Lebewesen wie etwa die Nacktmulle hätten sich über sehr lange Zeiträume nicht verändert, weil ihre Umwelt immer gleich geblieben sei (Johnnie Hughes). Dabei fehlt, daß auch der „Selektionsdruck“ durch Freßfeinde und Nahrungskonkurrenten ein Grund für immer neue Anpassungen sein kann. Grundlage ist die Knappheit der Ressourcen innerhalb derselben Nische. Diesen Gesichtspunkt hatte Darwin von Malthus übernommen. Indem Tiere sich ihre eigene Umgebung bauen, reduzieren sie die Kosten von deren Exploration. In der selbstgebauten Wohnanlage kennt sich der Biber bestens aus. (Paradebeispiel in Dawkins’ „The extended phenotype“.) Man kann das auf den Menschen übertragen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.01.2025 um 05.29 Uhr |
|
Auch wenn Vergleichsmaßstäbe fehlen, kann man sagen, daß ein Kind seine Muttersprache früh und bis in phonetische Feinheiten exakt erwirbt. Zu den Faktoren, die es erklären, gehört auf jeden Fall die Tatsache, daß das Kind mit jedem kleinen Erfolg seine elementaren Bedürfnisse befriedigt, anders gesagt: die Verstärkung (reinforcement) im Sinne der Konditionierung hat eine später nie wieder erreichte Intensität. Der schulische Fremdsprachenunterricht ist das genau Gegenteil: eine Art Trockenschwimmen ohne vitale Bedeutung. Das Erzielen einer guten Note ist so weit von primärer Verstärkung entfernt wie nur möglich, es fördert allenfalls die Bereitschaft, seine Hausaufgaben zu machen, aber nicht die Sprachfertigkeit selbst.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.01.2025 um 06.31 Uhr |
|
Die Lernvorgänge, die provisorisch mit Begriffen wie „Selbstverstärkung“ erfaßt werden, lassen sich ohne mentalistische Begriffe untersuchen. Die logischen Schwierigkeiten, die alle Ausdrücke mit „selbst-“ mit sich bringen, lassen sich überwinden (vgl. die Erörterung bei A. Charles Catania: „The myth of self reinforcement“. Behaviorism 3/1975:192-199). Dazu bedarf es einer anderen Terminologie, die das Element „selbst-“ und damit den Schein der „Reflexivität“ meidet. Andernfalls verstrickt man sich in Wortklaubereien, vgl. Catanias Diskussion mit Bandura (in derselben Zeitschrift). Tiermodelle erleichtern den Zugang zu einer nichtmentalistischen Analyse, weil dabei Begriffe mit „Selbst-“ ferner liegen. Bei Tieren bietet es sich auch weniger an, ihnen einen „privaten“ Innenraum zuzuschreiben, in dem sie „mentales Probehandeln“ veranstalten. So kann man dann auch menschliches Verhalten untersuchen, also ohne den Probanden in ihre Folk psychology zu folgen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.01.2025 um 18.26 Uhr |
|
Hund und Hündin pinkeln bekanntlich auf sehr verschiedene Weise, während sie beim Kacken die gleiche Haltung einnehmen. Woher wissen sie, was sie zu tun haben? Oder ist die Frage falsch gestellt? Sie tun es eben, und der Grund liegt in der Stammesgeschichte, aber sie "wissen" nichts davon, weil man diesen Begriff auf Tiere nicht anwenden kann. Die naturalistische Psychologie (Verhaltensanalyse) strebt an, auch dem Menschen kein Wissen zuzuschreiben, sondern solche Zuschreibungen selbst historisch zu erklären.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.01.2025 um 08.27 Uhr |
|
Valentin Braitenberg schließt die neurologische Ebene mit der kulturellen kurz, sucht nach neuronalen Entsprechungen für „Begriffe“ und „Aussagen“ usw., während das Gehirn in Wirklichkeit Muskelbewegungen steuert, von denen ein Teil durch Lernen zu kulturellen, gesellschaftlichen Leistungen gebündelt ist. Das kann eine bestimmte Sprache sein, es kann aber auch Klavierspielen sein. Es ist nicht sinnvoll, schon auf der Ebene des Nervensystems dafür jeweils spezifische Regionen anzunehmen. Das Gehirn „weiß“ sozusagen nichts von den kulturell geprägten Umgebungen, in denen der Mensch lebt. Vergleichbar ist der Universalcomputer, der nichts von den Texten, Bildern oder Musikstücken weiß, die er verarbeitet und speichert. Er reduziert alles auf „Bits und Bytes“. Unabhängig davon könnten in der Stammesgeschichte einige Regionen des Gehirns eine besondere Eignung für bestimmte lebenswichtige Verhaltensweisen erworben haben. Es ist eine ungelöste Frage, wie spezifisch solche Spezialisierungen sind. Für das Schreiben oder Klavierspielen kann es keine spezifischen Zentren geben, weil diese Fertigkeiten stammesgeschichtlich zu jung sind. Im Sprechen werden möglicherweise viele ganz verschiedene Fähigkeiten (Verstellung, Zeigen, Musik) integriert, so daß die Suche nach Sprachzentren ebenfalls vergeblich wäre. Es hat sich ja immer wieder herausgestellt, daß zum Beispiel das Broca-Zentrum nicht nur für Grammatik zuständig ist, die Grammatik nicht nur durch das Broca-Zentrum gesteuert wird. Und so bei vielen anderen Funktionen, etwa den „Spiegelneuronen“ und auf einer ganz anderen Ebene bei den Genen (FOXP2 usw.). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.02.2025 um 04.24 Uhr |
|
„[Imitation im Spracherwerb] darf nicht überbewertet werden, wie wir das zum Beispiel bei Skinner (...) sehen.“ (Els Oksaar in Anton Peisl/Armin Mohler, Hg.: Der Mensch und seine Sprache. Frankfurt 1979:157) Dazu gibt die namhafte Spracherwerbsforscherin ausdrücklich Skinners „Verbal behavior“ als Quelle an, allerdings keine Seitenzahlen. Dieser Verfall der wissenschaftlichen Standards setzte in der Sprachwissenschaft meinem Eindruck nach erst in der zweiten Jahrhunderthälfte ein. Zuvor wurde im allgemeinen erwartet, daß man zitierte Werke auch gelesen hatte.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.02.2025 um 16.31 Uhr |
|
„Das Sprachverhalten wird von außen (‚exogenistisch‘) über Stimulus-Reaktions-Schemata mit Hilfe von speziellen Konditionierungsmechanismen aufgebaut, ist nicht eigentlich eine (aktive) Tätigkeit, sondern lediglich eine Reaktion des Organismus auf die Umwelt.“ (Gerhard Helbig über Skinner in Ders.: Entwicklung der Sprachwissenschaft seit 1970. Leipzig 1988:193f.) Das ist Wort für Wort Unsinn, aber man kann heute noch so schreiben, ohne gerüffelt zu werden. (In dem Buch werden übrigens noch ständig Marx, Engels, Lenin und sowjetische Autoritäten angeführt, von denen ein Jahr später niemand mehr etwas wissen wollte.) Wenn man liest, Sprache sei nach Skinner keine „(aktive) Tätigkeit“ (gibt es auch passive?), fällt einem der erste Satz von „Verbal behavior“ ein: „Men act upon the world...“. Leben ist Verhalten, und Verhalten ist weder aktiv noch passiv, sondern geschieht eben. Es wird durch die Rückwirkung seiner Folgen modifiziert – ist das so schwer zu verstehen? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.02.2025 um 17.04 Uhr |
|
„Every one of us must learn the meanings of tens of thousands of words, an intricate phonological system by which these words are kept distinct from one another, and a complex syntax by which the words can be joined together into larger constructions. We learn all this from the community in which we grow up, but we would learn none of it if we did not come to the task with the inherited capacity to learn the words, the pronunciation, and the grammar of whatever language happens to envelop us.“ (Robbins Burling: „Words came first: adaptations for word‐learning“. In Maggie Tallerman/Kathleen R. Gibson, Hg.: The Oxford Handbook of Language Evolution. Oxford 2012:406-416, S. 406) = Wir könnten die Sprache nicht lernen, wenn wir nicht die Fähigkeit dazu hätten = wenn wir sie nicht lernen könnten. Das ist der Stand der Wissenschaft nach einem halben Jahrhundert Chomsky. Übrigens beginnt der Text mit der These: „Language (…) is an enormously complex instrument.“ Das geht zwar auf Platon zurück, ist aber zumindest irreführend. Sprache ist kein Werkzeug, sonst wäre Gehen auch ein Werkzeug, um von a nach b zu kommen, ebenso Schreiben, Tanzen... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.02.2025 um 04.35 Uhr |
|
„Für den radikalen Verhaltensforscher ist der Psychologe nur ein ‚registrierendes Instrument‘, und den beobachteten Menschen betrachtet er nur als reagierenden Apparat, dessen Verhalten er registriert. Diese dürftige Verhaltenslehre (‚strenger Behaviorismus‘) verdient nicht den Namen ‚Psychologie‘; alles Menschliche geht dabei verloren, weil das Psychische von Anfang an ausgeschaltet wird.“ (Hubert Rohracher: Kleine Charakterkunde. 10. Aufl. Wien, Innsbruck 1963:197) Gegen diese Karikatur des Behaviorismus beruft sich Rohracher immer wieder auf das „Menschliche“, das „wirkliche Leben“ und die Erlebnisperspektive, d. h. auf folk psychology, Sprachgebrauch und gesunden Menschenverstand. Vgl. „Wenn ein Mensch sagt: ‚Ich habe Durst, ich möchte ein Glas Wasser trinken‘, so ist dies für jeden anderen Menschen verständlich (...) – soll es ausgerechnet dem Psychologen unverständlich bleiben?‘ (Hubert Rohracher: Einführung in die Psychologie. 10. Aufl. Wien 1971:82) Gleichzeitig versteht er sich als empirisch orientierten, experimentell arbeitenden Naturwissenschaftler. Das ist das Zwiespältige und Überholte an seiner vielbenutzten „Einführung“. Wikipedia berichtet ebenso zwiespältig über seine Lehre. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.02.2025 um 17.39 Uhr |
|
Einer der Gründe, warum die Verhaltensanalyse der Sprache so quer steht zur traditionellen Linguistik, liegt in folgendem: Eine grammatische Analyse ist keine Verhaltensanalyse, und die unter sehr speziellen Voraussetzungen gewonnenen grammatischen Elemente wie Satz, Wort, Morphem usw. sind keine Verhaltenseinheiten. Verhaltensabschnitte sind funktional definiert, es sind konditionierte Reaktionen. Sie können größer oder kleiner sein als die grammatischen Einheiten oder überhaupt auf einer anderen Ebene liegen als diese, also aus der segmentalen Analyse herausfallen. Der Verhaltensforscher darf keinesfalls die grammatischen Einheiten zugrunde legen, als wären sie naturgegeben, und dann fragen, wie sie erworben werden. Ein Teil der wirklichen Verhaltenseinheiten wird von den Sprachteilnehmern selbst als „Satz“, „Wort“ usw. interpretiert. (Vergleichbar und verwandt ist die logische Analyse des Dialogverhaltens.) Aus diesem Grund zögert Skinner, überhaupt von „Sprache“ zu reden, und zieht „Sprachverhalten“ vor, ebenso sind „Satz“, „Wort“ usw. keine theoretischen Begriffe der Analyse, auch wenn er sie im nichttechnischen Sinn selbst benutzt. Ein Autor in seiner Nachfolge, der diese Probleme sehr gut dargestellt und teilweise gelöst hat, ist David C. Palmer. (Etwa hier: https://www.researchgate.net/publication/369609731_Toward_a_Behavioral_Interpretation_of_English_Grammar) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.03.2025 um 16.13 Uhr |
|
David C. Palmer, der bedeutendste Erforscher des „autoklitischen“ Sprachverhaltens, schreibt 2024 in einer ebenso witzigen wie hintergründigen Fußnote: „The term autoclitic was first mentioned in the sixth of ten weekly lectures [gemeint sind Skinners ‚William James Lectures‘] in the fall of 1947, so it is possible that I was being born on the day the term was introduced to the world. That suggests that my interest in Skinner’s Verbal Behavior has deep mystical roots. Do not sneer, skeptic: I was born under the sign of the scorpion, visible only in the black of night.“ (Palmer spielt hier auf die zuvor referierte, von Skinner im Epilog zu „Verbal behavior“ erzählte Anekdote an: „Whitehead challenged Skinner to explain his behavior as he intoned, ‘No black scorpion is falling upon this table.’“ Das soll bei einem Abendessen der „Senior fellows“ gewesen sein, und Skinner setzte sich am nächsten Morgen hin und begann mit der Arbeit an „Verbal behavior“, das 23 Jahre später erscheinen sollte – ein Jahrhundertwerk! Whitehead hatte sich einen Satz ausgedacht, der so unwahrscheinlich wie nur möglich sein sollte, um es dem behavioristischen Feuerkopf so schwer wie möglich zu machen. Skinner zeigt nun viele Jahre später, daß nichts leichter ist als die scheinbar zufällige Aussage zu erklären, lustig zu lesen und natürlich nicht ganz ernst gemeint.) Mich beschäftigt das Thema auch schon einige Jahrzehnte, und ich weiß immer noch nicht recht, wie ich es anpacken soll. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.03.2025 um 04.14 Uhr |
|
Wikipedia über Arnold Gehlen: Den Handlungskreis beschreibt er an folgendem Beispiel: Wenn man versucht, eine klemmende Tür mit einem Schlüssel aufzumachen, dann muss man den Schlüssel hin- und herbewegen. Dabei merkt man, ob es in der einen Richtung besser funktioniert oder in der anderen. Man erfährt bei diesen Versuchen also Erfolg oder Misserfolg, man bekommt Rückmeldungen. Wenn man auf diese Rückmeldungen eingeht und sein Handeln ändert, erfährt man den beabsichtigten Erfolg: das Schloss geht auf. Diesen Vorgang beschreibt Gehlen als zirkulär. Der Kreisprozess spricht psychische Zwischenglieder, die Wahrnehmungen, an, läuft weiter über die physischen Teile, danach über die Eigenbewegungen und dann in die Sachebene und wieder zurück. Resultierend sieht Gehlen die Handlung nicht nur als Dualismus: Der ablaufende Prozess könne nicht in Leibliches und Seelisches geteilt werden. Alle Teile seien voneinander untrennbar und arbeiteten ständig in dem gleichen Vorgang zusammen. Er beschreibt seinen Handlungsbegriff in folgenden Worten: „Das Handeln selber ist – würde ich sagen – eine komplexe Kreisbewegung, die über die Außenweltsachen geschaltet ist, und je nach der Rückmeldung ändert sich das Verhalten.“ Das erinnert stark an Konditionierung (Lernen am Erfolg), aber die Darstellung ist nicht naturalistisch-behavioristisch. Auch Tiere lernen auf die gleiche Weise, so daß dieser Handlungsbegriff entgegen Gehlens Absicht nichts spezifisch Menschliches auszeichnet. Ich habe darum vorgeschlagen, das Handlungsschema auf (sprachliche) Ankündigung + möglichen Einspruch/Zuspruch zu gründen. Das ist etwas Gesellschaftliches und liegt auf einer „höheren Ebene“ als das allgemein-tierische Lernen am Erfolg. – Arnold Gehlens Schriften zur „Anthropologie“ sind in einem reichen bildungssprachlichen Jargon abgefaßt, den jeder Gebildete leicht nachvollziehen kann, was die große Popularität erklärt (ebenso die seines Gegenspielers Adorno), aber wissenschaftlich kann man das heute nicht mehr ernst nehmen. Ich bemerke an mir selbst, daß ich Gehlen vor 50 Jahren noch mit Gewinn zu lesen glaubte, aber wenn ich ihn heute noch einmal aus dem Regal hole, werde ich nach wenigen Seiten ungeduldig. Heute weiß ich auch, daß die "philosophische Anthropologie" schon zur Zeit ihrer Entstehung überholt war. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.03.2025 um 04.39 Uhr |
|
Zur Erläuterung der Betonung als Autoklitikum gibt Palmer das Beispiel: “I live in a greenhouse” vs. “I live in a green house“. Das ist jedoch nicht ganz richtig. „Greenhouse“ ist weitgehend lexikalisiert (‚Gewächshaus‘), und sein Anfangsakzent ist der gewöhnliche lexikalische der Determinativkomposita. „Green house“ kann u. U. ebenso betont werden, dann ist der Akzent Kontrastakzent (= not in a red house) und gehört zur aktuellen Rede – als impliziter Kommentar der Wortwahl. Daß die Lexikalisierung noch nicht abgeschlossen ist, erkennt man an der noch vorhandenen Koordinierbarkeit: "Wohn- und Gewächshäuser" (besonders in der Bauwirtschaft und Stadtplanung, wo es um größere Anlagen geht). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.03.2025 um 05.05 Uhr |
|
Das Hervorbringen und Verstehen der Rede wirft theoretische Fragen auf, die unabhängig von den physiologischen Einzelheiten diskutiert werden. Auch Lashleys „Problem of serial order in behavior“ gehört dazu, obwohl Lashley als Hirnforscher berühmt geworden ist. (Nur deshalb konnte es Ausgangspunkt von Chomskys physiologiefernem Ansatz werden.) Aus der unüberschaubaren Literatur greife ich einen repräsentativen Beitrag heraus und diskutiere nur wenige Punkte: Morten H. Christiansen/Nick Chater: „The Now-or-Never bottleneck: A fundamental constraint on language“. Behavioral and brain sciences 39/2016:1-72 [mit Kommentaren ab S.18]. Die Verfasser formulieren das Ausgangsproblem so: „Language is fleeting. As we hear a sentence unfold, we rapidly lose our memory for preceding material. Speakers, too, soon lose track of the details of what they have just said.“ (S. 1) Ich sehe hier einen unscheinbar auftretenden Gundfehler, der die Erörterung von Anfang an auf ein falsches Gleis schiebt, das auch im Verlauf der Diskussion nicht mehr verlassen wird: das „erschlichene Wir“, wie ich es nenne und auch der Phänomenologie ankreide. Es geht nicht um die Person („we“), sondern der Organismus wird verändert und reagiert entsprechend. Mit „we“ usw. kann man kein naturalistisches Modell der Aktualgenese aufbauen, sondern bleibt in der Handlungsbegrifflichkeit, letztlich im Homunkulusmodell der traditionellen „Philosophie des Geistes“. Daher der sprachnahe, logizistische Charakter des Ganzen. Der zweite Fehler ist das Flaschenhals-Bild. Die Verfasser fahren fort: „Language processing is therefore “Now-or-Never”: If linguistic information is not processed rapidly, that information is lost for good. Importantly, though, while fundamentally shaping language, the Now-or-Never bottleneck is not specific to language but instead arises from general principles of perceptuo-motor processing and memory.“ Die Formel „now or never“ („jetzt oder nie“) scheint nicht recht zu passen, besser wäre „over and done with“ („aus und vorbeit“). Das würde auch den Fehler noch deutlicher erkennen lassen: Das Wahrgenommene ist nicht sofort weg, und „schnell“ ist nicht „augenblicklich“, sondern es gibt zeitliche Gestalten oder Muster, die als ganze verarbeitet werden. Wie werden sie zu Mustern integriert? Wahrnehmung selbst ist auch nicht augenblicklich und punktuell, wie es die Metapher vom Flaschenhals suggeriert. Beispiel Kuckucksruf. Den nimmt auch der Kuckuck als Muster wahr, und der Specht trommelt im gleichen Sinn seine eintönige Melodie. Nach dem Flaschenhalsmodell müßte der zweite Ton des Kuckucks auf einen Apparat stoßen, der den ersten schon wieder vergessen hat, ebenso beim Trommeln der Spechte, so schnell die Töne auch aufeinander folgen. In Wirklichkeit stößt der zweite Ton auf einen Apparat, der durch den ersten verändert ist, so daß beide tatsächlich zusammenkommen. Die physiologischen Einzelheiten sind hier nicht zu erörtern, aber das Geheimnis der Integration zeitlich getrennter Vorgänge ist grundsätzlich naturalistisch auflösbar. „Flaschenhals“ ist noch untertrieben. Es liegt in der Logik des Modells, daß das Bewußtsein durch ein ausdehnungsloses Loch hindurch muß. In der Rede kommt eins nach dem anderen, daher ist die Zeit die Form des „inneren Sinns“, des Gedankenstroms. Die spekulative Psychologie der Philosophen sprach von der „Enge des Bewußtseins“. Das ist zwar schon für die Wahrnehmung physiologisch nicht zu ratifizieren, denn Wahrnehmung ist einerseits meist multimodal, andererseits voller Parallelverarbeitung. Die eigene Lösung der Verfasser ist immer noch mentalistisch-kognitivistisch geprägt, was sich schon an der baldigen Einführung des kognitivistischen Kernbegriffs der „Repräsentation“ zeigt: „Why doesn’t interference between successive sounds (or signs) obliterate linguistic input before it can be understood? The answer, we suggest, is that our language system rapidly recodes this input into chunks, which are immediately passed to a higher level of linguistic representation.“ „Repräsentation“ macht das Ganze unbrauchbar. Das System wird ständig verändert, aber das läßt sich nicht als Repräsentation auffassen. Und wieso „linguistic representation“? Etwas verstanden zu haben verändert die Voraussetzungen für das nächste, aber es ist eine Veränderung des Organismus, nichts Sprachliches. Gerade wenn das Problem nicht sprachspezifisch ist, sondern Wahrnehmung und Verhalten allgemein betrifft, müßte die „Repräsentation“ doch ebenfalls nichtsprachlich sein. Jede Erfahrung integriert zeitlich Gedehntes und Vergangenes. Das ist durch die Veränderung des Organismus naturalistisch zu erfassen. Andernfalls könnten wir nicht die einfachsten Tätigkeiten ausführen, und für Tiere würde das gleiche gelten. Die Wahrnehmung ist immer interpretierend, mitbestimmt von einer simultanen Umgebung und vorhergehenden Ereignissen. Man rechnet auch mit „Erwartungen“, aber dieser Begriff muß operationalisiert werden. Wie kommt es zur Verkennung dieser Tatsachen? Das Flaschenhals-Modell des Bewußtseins ist offensichtlich von der Linearität der Rede abgeleitet: Es kann immer nur ein Wort oder ein Gedanke nach dem anderen hervorgebracht werden. Auch folgt ein Gesprächszug auf den anderen; die Logik ordnet sie entsprechend. Nach diesem Modell trifft die „Lautkette“ beim Hörer ein: stets eins nach dem anderen, und wie das Ganze sinnvoll gedeutet werden kann, scheint das Problem des Gedächtnisses aufzuwerfen. Man versucht es mit „Rekodierung“, „Speicherung“ und „Repräsentation“ zu lösen. Es ist die alte Bewußtseinsphilosophie in neuen begrifflichen Schläuchen, die kognitivistische Mode. Die Verfasser behaupten zuversichtlich: „The existence of a Now-or-Never bottleneck is relatively uncontroversial (...)“ Das kann man nur sagen, wenn man große Teile der Fachdiskussion ausklammert. Weder von den Verfassern noch von den Diskutanten wird die behavioristische Gegenposition berücksichtigt, Skinner ist nicht erwähnt, auch nicht die vielen einschlägigen Arbeiten von dessen Schüler Terrace, etwa: Herbert S. Terrace: „The simultaneous chain: a new approach to serial learning“ (Trends in Cognitive Sciences 9/2005:202-209 Herbert S. Terrace: „Chunking & serially organized behavior in pigeons, monkeys and humans“ (https://pigeon.psy.tufts.edu/avc/terrace/default.htm) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.03.2025 um 07.06 Uhr |
|
Fortsetzung: Die ständige Rede vom sprachlichen „Input“ und seiner „Verarbeitung“ geht am Hören als Verhalten vorbei. Sie stammt aus der Computersimulation. (S. dagegen David C. Palmer: „The speaker as listener: the interpretation of structural regularities in verbal behavior“. The analysis of verbal behavior 15/1998:3-16.) Hören ist ein Verhalten, das u. a. von akustischen Reizen gesteuert wird. Sie verändern den Organismus, und diese Veränderung überdauert eine gewisse Zeit. Innerhalb dieser Zeit sind jene speziellen Leistungen möglich, die den Experimenten mit der Millerschen Zahl („7 +/– 2“) entsprechen und zur Konzeption des Kurzzeitgedächtnisses geführt haben. Andere Leistungen sind auch später noch möglich. Wenn wir die introspektionsgestützte Annahme der „Enge des Bewußtseins“ aufgeben, kann von einem „now or never“ an keiner Stelle die Rede sein. Wenn jemand mir zum Beispiel mitteilt, daß eine bestimmte Straße gesperrt ist, werde ich auch Tage später noch einen Umweg wählen. Christiansen/Chater konstruieren daraus ihr Problem: Wie kann das sein, wenn der Wortlaut vergessen ist? Nach ihrem Modell wäre die Mitteilung zwar nicht im Wortlaut, aber in irgendeiner anderen Formulierung nach Tagen noch – als Mitteilung oder Nachricht – gespeichert. Das ist eine willkürliche, vom kognitivistischen Vorurteil geprägte These. Nachrichten sind Sprache, Zeichen, aber es gibt keinen Grund, die Veränderungen des Organismus als zeichenhaft zu modellieren. Wir können nur sagen, daß die Mitteilung über die Straßensperrung die Bereitschaft des Hörers verstärkt, einen anderen Weg zu nehmen. Wenn ich meine Brille abends auf die Fensterbank lege, bin ich am nächsten Morgen eher bereit, sie dort zu suchen. Das ist auch der Fall, wenn mir jemand am Abend SAGT, daß er meine Brille auf die Fensterbank gelegt habe. Die Suche folgt aber keiner irgendwo gespeicherten Instruktion. Das ganze Verhalten wird ununterbrochen von Tausenden von Erfahrungen geleitet, die nicht in zeichenhaften Begriffen zu beschreiben sind, sondern in Begriffen fortschreitender Anpassung: Unser Verhalten wird immer geschickter, d. h. angepaßter. Die „Verarbeitung“ der Sprache im Gehirn kann nicht ihrerseits sprachlich oder allgemeiner: zeichenhaft sein. Ein realistischer Zeichenbegriff würde das sofort klären. Ein Computermodell kann den Kategorienfehler nicht ausgleichen, wenn es lediglich Handlungssimulationen liefert und damit die personalistische Begrifflichkeit weiterführt. Die kognitivistische Psychologie bleibt auch in der modernen Verkleidung in Computersprache die alte Homunkuluspsychologie. Dabei wird bereits der Computer vermenschlicht oder, genauer gesagt, personalisiert, denn Sprache irgendeiner Art gehört zur Person, nicht zur Maschine. Der Computer arbeitet nicht mit Sprache, sondern verschiebt Ladungen usw., und erst den Output in einer angeschlossenen Peripherie deuten wir als Sprache (oder Musik oder Bilder usw.). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.03.2025 um 08.46 Uhr |
|
Wörter und Sätze sind keine natürlichen Gegenstände, sondern konventionelle Deutungen von solchen. Es ist sinnlos, sie mit neurophysiologischen Sachverhalten zu korrelieren. Im Gehirn gibt es so wenig Wörter und Sätze wie im PC Texte, Musik oder Bilder. Das sind Deutungen oder Verwendungen bestimmter in der angeschlossenen Peripherie entstehender Phänomene. Als Kinder lugten wir durch das Lochgitter in der Rückwand des großen Radioapparates, sahen die geheimnisvoll glimmenden Röhren und atmeten die nach Bakelit und Staub riechende warme Luft, die daraus aufstieg. Aber wo war das Symphonieorchester? So kindlich denken viele Kognitivisten, wenn sie mit Hirnscans nach dem Sitz der Sprache fahnden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.03.2025 um 16.12 Uhr |
|
Die Frequenz der Sprechstimme liegt zwischen 300 und 2000 Hz. Die höchste Empfindlichkeit hat unser Ohr bei 2000 Hz – das entspricht dem Notruf von Kindern und Frauen, es ist "emotional besetzt" (nach Rainer Sinz: Lernen und Gedächtnis: Stuttgart 1980:210). Jedenfalls ein schöner Gedanke. Es ist schon vor Jahrzehnten bewiesen worden, daß junge Frauen ihren Schritt beschleunigen, wenn sie auf der Straße aus irgendeinem Fenster ein Baby schreien hören. Wenn wir hören, daß jemand Kinder nicht leiden kann, ist er für uns erledigt. Apropos Alarm: Heute war ja Sirenenprobe. Trockener Kommentar der Enkelin (3;2): "Das stört mich beim Essen." |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 13.03.2025 um 18.19 Uhr |
|
Hohe Töne mag wohl auch unser jüngster Enkel (2;5). Als er mit einem Auto spielte, machte er dazu zu unserer Überraschung nicht "brumm, brumm", sondern "piep, piep". Die Mutter erklärte, daß er das vom Warnton eines rückwärtsfahrenden Lasters abgehört hat. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.03.2025 um 04.08 Uhr |
|
Zweifellos richtig, vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#52568 Ich weiß nur nicht, ob die Kinder von selbst auf die phonematisch angepaßte Nachahmung kommen oder ob ein Erwachsener ihnen das schon vorgemacht haben muß. Wir übersehen gern die große Entfernung zwischen Naturlauten bzw. technischen Geräuschen einerseits und sprachlicher Lautmalerei andererseits. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.03.2025 um 05.01 Uhr |
|
Christiansen/Chater eröffnen auf der Grundlage ihres Flaschenhalsmodells die Alternative: auf den Input entweder sofort reagieren oder ihn „rekodieren“ (und in der rekodierten Formulierung speichern). Aber das Rekodieren bleibt etwas Sprachliches, und es gibt keinen Grund, die „Informationsverarbeitung“ im Kopf (Geist oder Gehirn) für sprachlich, also zeichenhaft zu halten. Bei nichtsprachlichen Reizen und bei Tieren entfällt ein solches Rekodieren von vornherein. Die Sprachlichkeit des „Systems“ ist der Kern der Homunkuluspsychologie, die heute als „Kognitionsforschung“ wiederauferstanden ist. Naturalistisch gesehen verändert das Hören (von Sprache oder etwas anderem) den Organismus und damit dessen künftiges Verhalten; es gibt keinen Grund, diesen Veränderungen einen sprachlichen Charakter zuzuschreiben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.03.2025 um 05.39 Uhr |
|
Das Gehirn ist in allen Teilen aktiv, solange es lebt. Es sind also Trillionen von Impulsen gegeben, die alle in Verhalten münden könnten, wenn sie entsprechend verstärkt würden. Sie müssen gehemmt werden bis auf einige wenige, die zuletzt das physisch mögliche und der Situation angepaßte Verhalten steuern (competitive queuing). Diese Koordination herzustellen, soweit sie nicht angeboren ist, ist die Funktion des Lernens. Man sieht es noch an den zuerst „fahrigen“ Bewegungen des Säuglings, die unter dem Eindruck ihres wechselnden Erfolgs immer mehr koordiniert werden. Auch angeborene Koordinationen lassen sich gut erkennen, etwa der Greifreflex. Vgl. dagegen den späten Erwerb des Pinzettengriffs! An der Artikulation sind übrigens rund 14.000 Muskeln beteiligt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.03.2025 um 05.54 Uhr |
|
Gute Zusammenstellung der frühkindlichen Reflexe: https://de.wikipedia.org/wiki/Frühkindlicher_Reflex „Das Greifen ist dementsprechend so kräftig, dass ein Neugeborenes sich damit an einer Stange festhalten könnte.“ Tja, und der von der Geburt ohnehin aufgewühlte Vater, dessen Finger das Neugeborene so überraschend kräftig umklammert, ist mächtig gerührt von diesem Vertrauensbeweis. An gleicher Stelle der Hinweis, daß der Greifreflex (beim Fuß ohnehin ein Atavismus) natürlich gelöscht werden muß, damit das Kind überhaupt gehen und mit den Händen etwas anderes anfangen kann. |
Kommentar von Rainer Beckmann, verfaßt am 14.03.2025 um 10.33 Uhr |
|
»An der Artikulation sind übrigens rund 14.000 Muskeln beteiligt.« Dagegen: »Jeder gesunde Mensch besitzt 656 Muskeln.« (https://de.wikipedia.org/wiki/Muskulatur) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.03.2025 um 12.04 Uhr |
|
Wahrscheinlich sind Fasern oder kleinere Bündel gemeint. Die Zunge ist ein Muskel oder ein Bündel davon. Ich habe aber meine Quelle (ein Buch der Aphasieforscherin Ruth Lesser) nicht mehr zur Hand und verzichte gern auf die These.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.03.2025 um 06.37 Uhr |
|
Zum "selfish gene": Es hat sich herumgesprochen, daß es allzu menschlich und gerade sinnlos ist, bei Tieren „egoistisches“ und „altruistisches“ Verhalten zu unterscheiden. Aber weiterhin ist von „kooperativem“ und „kompetitivem“ Verhalten die Rede, als ob das etwas änderte. Sogar Tests werden darauf aufgebaut und fördern natürlich zutage, was man hineingesteckt hat. Der Wettbewerb kann sich aber gerade als Kooperation erweisen. Ein kompetitives Spiel (und fast alle Spiele beruhen auf Wettbewerb, Gewinnen und Verlieren) ist in höherem Sinne kooperativ, darum wird es ja gespielt. Ein anderes Beispiel ist der Markt: Konkret im Feilschen um den Preis, heute meist abstrakter in Form von Angebot und Nachfrage, ist der Wettbewerb höchst kooperativ.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.03.2025 um 07.03 Uhr |
|
Angeblich können Tiere, die dem Menschen ferner stehen als Menschaffen, Zeiggesten verstehen und teils sogar gebrauchen. Oft genannt werden Hunde, aber auch Elefanten. Diese schnüffeln mit dem periskopartig erhobenen Rüssel nach Duftreizen und können so „directions of interest“ anzeigen. In diesem Sinne kann man bekanntlich auch Pferden und Hunden Richtungshinweise geben. Auch Bienen und Ameisen können solche Richtungshinweise geben und befolgen. Das ist aber kein Zeigen. Das spezifisch menschliche Zeigen ist kein kommunikativer Akt, sondern Teil eines solchen: ein Gegenstand wird physisch-gestisch eingeführt und zugleich etwas darüber gesagt. Das echte gegenstandsbezogene Zeigen hängt also mit der Satzbildung zusammen, mit der grundsätzlichen Mehrgliedrigkeit menschlicher Äußerungen: Zeigen – Nennen – Sagen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.03.2025 um 16.05 Uhr |
|
Ich hatte die "Millersche Zahl" erwähnt (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#54926). De Aufsatz Millers, einer der einflußreichsten der ganzen Psychologiegeschichte, hat folgenden Titel: George A. Miller: „The magical number seven plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information“. (Psychological review 63/1956:81-96) Kaum jemand bemerkt, daß schon hier das "erschlichene Wir" eingeführt wird, das mit der Sprache der Informationsverarbeitung unverträglich ist. Nicht wir als Personen sind es, die Informationen verarbeiten. Es ist also die übliche, den ganzen Kognitivismus prägende "System-Akteur-Kontamination", die vor über 40 Jahren Theo Herrmann aufgedeckt hat – folgenlos, wenn man meine davon überzeugte Wenigkeit ausnimmt, und ich bin ja kein Psychologe. (Trotzdem habe ich damals in der von Herrmann mitherausgegebenen Zeitschrift drei Arbeiten veröffentlichen dürfen, eine davon eine harsche Kritik an Herrmann selbst, alles mit seiner Unterstützung.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.03.2025 um 05.08 Uhr |
|
Morten H. Christiansen/Nick Chater: The language game. London 2023. Zum Sprachursprung stellen Morten Christiansen und Nick Chater ihre Scharadentheorie vor. Einleitend erinnern sie an Cooks Begegnung mit den Südseeinsulanern, mit denen seine Leute mangels gemeinsamer Wortsprache offenbar durch das kommunizierten, was man gewöhnlich Zeichensprache oder Pantomime nennt und was die Autoren als „Scharade“ bezeichnen. Das ist in mehrfacher Hinsicht unglücklich. Ein solches Zusammentreffen ist nicht die Ursituation, in der Sprache allererst entsteht, sondern beide Seiten verfügten bereits über voll entwickelte Sprachen und wußten, welchen Platz die mimetischen Bewegungen darin haben. Für sich selbst sind sie ein Verstellungsspiel und nicht einmal zeichenhaft. Vgl. Wittgensteins Beispiel: „Denken wir uns ein Bild, einen Boxer in bestimmter Kampfstellung darstellend. Dieses Bild kann nun dazu gebraucht werden, um jemand mitzuteilen, wie er stehen, sich halten soll; oder, wie er sich nicht halten soll; oder, wie ein bestimmter Mann dort und dort gestanden hat; oder etc. etc.“ (Philosophische Untersuchungen 22) Damit hängt ein zweiter Einwand zusammen: Eine Scharade ist ein sprachbezogenes, sogar metasprachliches Gesellschaftsspiel, bei dem es darauf ankommt, pantomimisch dargestellte Wörter zu erraten. Sie ist also einzelsprachspezifisch, während die Pantomime sprachunabhängig ist. Pantomime und nicht Scharade ist das universelle Hilfsmittel, auf das Sprachunkundige zurückgreifen. Es ist aber spezifisch menschlich: Affen kann man noch so viel vorspielen, sie wissen damit nichts anzufangen. Weder Aufforderungen noch Erzählungen kann man ihnen so vermitteln. Der gestische Ursprung der Sprache ist auch keine neue Idee, sondern eine der klassischen Ursprungstheorien (vgl. Michael Corballis: From hand to mouth. Princeton 2003). Nur die Bezeichnung „Scharade“ ist neu und irreführend. Theorien über "the gestural origin of language" versäumen es meistens, die Semantisierung des mimetischen Verhaltens darzustellen. Erst sie macht den Unterschied und erklärt, warum Pantomime dem Menschen etwas sagt, dem Schimpansen aber nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.03.2025 um 16.19 Uhr |
|
Der dritte Punkt, den ich bei Christiansen/Chater problematisch finde (außer "Scharade" und "Flaschenhals"), ist das „Eisberg“-Modell der Bedeutung. „The words, phrases and sentences we produce are just the tip of what we call the communication iceberg. It’s the submerged part – all the social and cultural knowledge, our ability to understand each other more generally – that really has made language possible and that makes language special.“ (Christiansen in einem Interview https://psychology.cornell.edu/news/why-language-charades-and-could-save-us-ai) – Dazu gibt es auch eine Zeichnung (Christiansen/Chater 24) Zum verborgenen Teil gehören „factual knowledge“, „values“, „conventions“, „empathy“, „culture“ usw., eine bunte Mischung, die begrifflich zur allgemeinen Bildungssprache gehört und kaum auf eine kontrollierbare Art wissenschaftlich genauer bestimmt werden kann. Wenn man die Mystifikation aufgibt, bleibt übrig: Sprachliche Ausdrücke bezeichnen nicht ihre eigenen Verstehensvoraussetzungen. Oder in Verhaltensbegriffen: Aus Sprachverhalten (Sprechen und Hören) läßt sich nicht auf die dahinterstehende Konditionierungsgeschichte schließen. Daher Skinners Satz: „‘Bedeutung’ ist ein Surrogat für Geschichte.“ |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.03.2025 um 06.10 Uhr |
|
Theorien über „the gestural origin of language“ versäumen es meistens, die Semantisierung des mimetischen Verhaltens darzustellen. Erst sie macht den Unterschied und erklärt, warum Pantomime dem Menschen etwas sagt, dem Schimpansen aber nicht. Diese Tatsache wird durchweg übersehen. Erzählen Sie Ihrem Hund mal, wo Sie gestern gewesen sind! (Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1106#50580 f.)
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.03.2025 um 05.19 Uhr |
|
„Meaning is not transmitted like a message in a bottle but has to be constructed collaboratively by the participants in a conversation. The words that we utter or sign are only clues to the intended meaning. To fully understand what someone is saying, we need to construct an interpretation based on the linguistic cues and what we know about the world, what we know of each other and what was said before. This constructive process is at the heart of how language functions. (...) We need to read each other’s minds, at least to a certain degree, to play the language game successfully. When we are talking with one another, the words, phrases and sentences we utter are merely the tip of waht we will refer to as the communication iceberg. Much of the work in the language sciences has concentrated on this visible part. “ (Morten H. Christiansen/Nick Chater: The language game. London 2023:23) Aus dem Zusammenhang geht hervor, daß die Verfasser den sichtbaren Teil des Eisbergs einerseits mit der sprachlichen Form vergleichen, aus dem die Bedeutung zu erschließen sei, andererseits aber auch mit der primären Bedeutung im Gegensatz zum Mitgemeinten. Gegen die erste Deutung ist einzuwenden, daß bei einem Eisberg der sichtbare und der unsichtbare Teil aus dem gleichen Material sind, während Form und Bedeutung von Zeichen schon begrifflich unvergleichbar sind. Die zweite Deutung wird durch die bekannte Kürzestgeschichte nahegelegt, mit der sie das Kapitel einleiten: „For sale. Baby shoes. Never worn.“ Darin ist die Familienträgödie nicht „enthalten“, die möglicherweise dahintersteht. Aus naturalistischer Sicht geht es darum, immer weitere Zusammenhänge als das Sprachverhalten steuernde Faktoren einzubeziehen. (Ich spreche vom „Format“ der steuernden Faktoren und vermeide es, vom „Wissen“ der Gesprächspartner zu reden wie die Verfasser: „what we know about the world, what we know of each other and what was said before“). Die Darstellung leidet daran, daß als Agens des Konstruierens (unglücklicherweise auch als „constructive process“ bezeichnet) wieder die Person („we“) angenommen wird, als wäre es eine Handlung (trotz „process“). Das Kind „konstruiert“ in keinem vernünftigen Sinn eine „Interpretation“, wenn es „komm mal her“ hört und zum Sprecher läuft, und Hörer befinden sich als Personen nicht in der Situationen eines Philologen, der einen unbekannten Text zu entziffern hat. An Tiere darf man gar nicht denken, weil es allzu weit hergeholt wäre, einem Hund das „Konstruieren einer Interpretation“ zuzuschreiben. Konditionieren ist sparsamer zu erklären, aber diesen Weg haben die Verfasser sich verbaut. Zum "Gedankenlesen" habe ich mich anderswo schon geäußert. Solche Metaphern erklären nichts. Aber vielleicht sehen die Verfasser den metaphorischen Charakter gar nicht? Ihre Einschränkung "to a certain degree" könnte darauf schließen lassen. So kommt es zu einem unentwirrbaren begrifflichen Durcheinander. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 21.03.2025 um 10.14 Uhr |
|
Am Konditionieren mag schon einiges dran sein, aber es hat auch einen passiven Beiklang, so als sei der Mensch seiner Umwelt, die ihn konditioniert, bedingungslos, sozusagen hilflos ausgeliefert. Hat der Mensch nicht, je älter er wird und je mehr er lernt, sehr wohl immer bessere konstruktive, schöpferische Fähigkeiten, die über rein konditioniertes Verhalten hinausgehen?
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 21.03.2025 um 12.07 Uhr |
|
Jetzt fällt mir das Wort ein, das mir auf der Zunge lag: Klingt konditionieren nicht immer auch ein bißchen wie dressieren? Beim Tier geht das in Ordnung, beim Menschen kann das aber doch nicht das Alleinige sein. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.03.2025 um 12.44 Uhr |
|
Zu "aktiv oder passiv": http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1548
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 21.03.2025 um 18.58 Uhr |
|
Die Beispiele unter "Homunkulus" scheinen mir auf einer anderen Ebene von Aktivität und Passivität zu stehen als die, die ich meine. Hören, Lernen, das Leben an sich sind natürlich irgendwie alles aktive Vorgänge. Das ist eigentlich selbstverständlich. Jedes Tier muß aktiv Nahrung suchen und aufnehmen, trinken, sich vermehren, auch lernen, nachmachen, wiederholen, alles aktiv bis zur Perfektion, klar. Was ich also vor allem meine, wenn ich sage, Konditionierung klingt für mich passiv, das ist das allgemeine Verhalten. Nicht beim Lernen, sondern im Grunde danach. Es kommt besonders beim Menschen zur Geltung. Konditionierung laut Behaviorismus ist wie (so macht es auf mich den Eindruck): einmal gelernt, dann verhält sich der Organismus immer so, natürlich mit schrittweise weiterer Verbesserung, aber darum geht es hier nicht. Der Mensch verhält sich ja nicht immer so, wie er es gelernt hat. Er berücksichtigt eine Vielzahl von Faktoren, dann tut er entweder das, was erwartet wird, oder etwas anderes. Er ist durch Konditionierung nicht auf ein bestimmtes Verhalten festgelegt. Mit Aktivität meine ich vor allem, daß der Mensch sich frei entscheidet, nicht blind bzw. reflexartig einem erlernten Schema folgt. Er konstruiert sich ein Feld von mehreren Möglichkeiten im Kopf, wägt ab, wählt aus. Wie berücksichtigt der Behaviorismus das, noch dazu "sparsamer"? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.03.2025 um 05.15 Uhr |
|
Wie man eine Waage zuerst auf Null stellen muß, so wird auch die Wahrnehmung genullt: Farben sind Signale, aber wo nichts Relevantes zu sehen ist, werden die Farben (bzw. Wellenlängen) zur Nichtfarbe Weiß gemischt. Goethe wollte das nicht einsehen, daher seine wütende Polemik gegen Newton. Die Wahrnehmung von warm und kalt ist ein Alarmzeichen. Am wohlsten fühlen wir uns, wenn wir gar keine Temperaturempfindung haben. Um die 20 Grad herum ist Null. Davon unabhängig ist jeder Wechsel wiederum alarmierend, wie der bekannte Schulversuch mit der Hand abwechselnd in kaltem, heißem und neutralem Wasser zeigt. Man könnte das Prinzip auf andere Gebiete ausdehnen, wo es ebenfalls um „nichts“ geht. Was denken wir, wenn wir nichts denken? Nichts ist immer = nichts Besonderes. Das muß aber erst mal hergestellt werden, eben als Nullung. Das Nervensystem feuert immer, das Ruhepotential ist nicht einfach nichts. Es ist wie ein Rundfunksender, der immer sendet, auch wenn er nichts sendet (wenn nichts Besonderes auf die Trägerwelle aufmoduliert ist). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.04.2025 um 04.45 Uhr |
|
Wenn man die Geschicklichkeit, mit der ein Kleinkind Gegenstände manipuliert, als Anwendung theoretischer Einsichten in die Physik und Geometrie versteht, sind es staunenswerte Fähigkeiten, die dem Spracherwerb nicht nachstehen. Trotzdem haben die Chomsky-Anhänger einen grundsätzlichen Unterschied konstruiert – ein Artefakt ihrer Willkür (vgl. den Irrsinn hier: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#43979). Dieser Fehler ist trotz grundstürzender Kritik immer noch nicht ganz überwunden.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.04.2025 um 13.00 Uhr |
|
Die „Metaphysik der Geschlechtsliebe“ (Schopenhauer) läßt sich naturalistisch rekonstruieren. Der naturalistische Fehlschluß ist so bekannt, daß von dieser Seite keine Gefahr droht, wenn wir „secundum naturam vivere“ in einem nichtnormativen, deskriptiven Sinn auslegen: Die Funktion des Lebens ist das Leben. Körperbau und Verhalten der Organismen stehen ganz und gar im Zeichen der Fortpflanzung, ob man nun die Arten oder die Gene als Replikatoren ansetzt. Dawkins hat das in der oft mißverstandenen, von ihm selbst bereuten Metapher vom „egoistischen Gen“ eingefangen. Es existieren überhaupt nur noch die Arten oder Gene, die sich im richtigen Ausmaß fortgepflanzt haben, so daß im Rückblick dies die entscheidende Funktion war, bei Strafe des Verschwindens. Im richtigen Ausmaß – also weder zu viel noch zu wenig, sondern eben „nachhaltig“, wie man heute sagt. Dazu gehört natürlich außer der Replikation selbst auch die beim Menschen enorm ausgeweitete Brutpflege, also die sogenannte Liebe. (Auch dazu vgl. Schopenhauers Abhandlung im zweiten Band.) Für die Gruppenfitneß kann es nützlich sein, daß einige Individuen auf die Fortpflanzung verzichten. Bei den staatenbildenden Insekten sind es sogar bei weitem die meisten. Ob das bei den höheren Tieren einen Sinn hat, ist schwer zu sagen, erst recht beim Menschen, weil die menschlichen Gemeinschaften so ungemein vielfältig sind, andererseits für einen Vergleich ihrer Fitneß nicht zahlreich genug. Erfolg und Mißerfolg können auch von historischen Zufällen abhängen. Die schönste Anpassung an die Natur und die beste Organisation von Gesellschaften können durch Krieg, Unterwerfung und andere Katastrophen zuschanden werden usw. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.04.2025 um 08.56 Uhr |
|
Skinner bezieht sich in „Verbal behavior“ mehrmals auf Trollope (Last chronicle und Autobiographie), weil dieser zwar keine wissenschaftliche Psychologie betreibt, aber ausgezeichnete Illustrationen typischer Verhaltensweisen liefert. Ich möchte ergänzend zwei weitere Beispiele anführen. Warum kommen John Eames und Lily Dale nicht zusammen? Diese Frage wird in den beiden letzten Bänden immer wieder aufgegriffen und von verschiedenen Seiten behandelt. Der Leser denkt sich mittlerweile schon, was der tiefste Grund ist, aber das spricht der Erzähler erst spät mit klaren Worten aus: „She had known him first as a boy, with boyish belongings around him, and she had seen him from time to time as he became a man, almost with too much intimacy for the creation of that love with which he wished to fill her heart.“ Spielkameraden, die wie Geschwister aufwachsen, erleben auch die geschwistertypische Inzestschranke (vgl. Norbert Bischof: Das Rätsel Ödipus). Lily kann John nur, wie sie selbst sagt, wie einen Bruder lieben und nicht auf eine erotische Beziehung umschalten. Der Leser bedauert das zunächst, sieht es aber im Laufe der beiden Bände ein. Das ist sehr fein entwickelt. Mein zweites Beispiel: Archdeacon Grantly hat sich eigentlich vorgenommen, die Geliebte seines Sohnes zur Schnecke zu machen, weil sie es als bettelarme Tochter eines diebstahlverdächtigen Pfarrers wagt, seinen Lieblingssohn heiraten zu wollen. Kaum steht er dem Mädchen gegenüber (sie hat gerade mit den Kindern gespielt und verzichtet darauf, sich für das plötzliche Interview zu frisieren), ist er hin und weg und muß anerkennen, daß sein Sohn einen guten Geschmack hat. Nämlich seinen eigenen. Seine Frau (Susan, geb. Harding, eine sehr vernünftige Frau) ist ja die Mutter des Sohnes, und Söhne suchen überdurchschnittlich oft eine Frau, die in irgendwelchen Zügen der Mutter ähnelt, der ersten Liebe jedes Menschen. (Den Ödipussi lassen wir mal beiseite.) John, Lily, Crawley und andere sind ambivalent dargestellt und leiden alle am gleichen Defizit: sie sind nicht authentisch. Lily liebt eigentlich nicht den Schuft Crosbie, sondern ihre eigene Verliebtheit und später ihren Liebeskummer (als „old maid“), ähnlich John, der es sich ganz komfortabel als ewiger Junggeselle einrichtet. Crawleys krankhafter Stolz auf sein eigenes Unglück wird bis ins Karikaturhafte ironisiert usw. Nur seine Tochter Grace ist ganz sie selbst. Um ihre engelhafte Darstellung nicht ins Kitschige abgleiten zu lassen, rauht Trollope die Geschichte mit den leicht komischen Zügen der Gelehrsamkeit beider Schwestern auf: sie beherrschen Latein und Griechisch besser als die geistlichen Herren ihrer Umgebung mit Ausnahme des Vaters usw. Schon bei der Einführung der armen Pfarrersfamilie wird erwähnt, daß Crawley seine Töchter mit unregelmäßigen griechischen Verben traktiert. Das ist für die Mädchen aber offensichtlich keine Qual, und sie machen auch kein Aufhebens von ihrer ungewöhnlichen Bildung. Der Erzähler ironisiert diesen Zug noch, wenn er etwa über Jane sagt: „Though she was only sixteen, and had as yet read nothing but Latin and Greek—unless we are to count the twelve books of Euclid and Wood’s Algebra, and sundry smaller exercises of the same description—she understood, as well as anyone then present, the reason why her absence was required.“ (Es handelt sich um das Standardwerk von James Wood: The Elements of Algebra: Designed For The Use Of Students In The University.) Das Griechische wird – gleichsam als Chiffre – noch mehrmals zu allerlei komischen Effekten benutzt. Gegen Ende nimmt sich sogar der brave John zwecks Ablenkung die Ilias vor, merkt aber, daß er das Griechische ganz von vorn, vom Alphabet an, neu lernen müßte, und legt den Homer wieder beiseite. Er will sich, wie viele andere Figuren, nicht besonders anstrengen. Über Trollopes Frauenbild fetzen sich heute die Gelehrten, aber das Leben ist zu kurz, um sich daran zu beteiligen. Wie weit er feministischen Idealen entsprach, ist mir wirklich gleichgültig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.04.2025 um 18.18 Uhr |
|
Die große Geschicklichkeit der Primatenhand ist eine natürliche Voraussetzung für kulturell ausgefeiltere Tätigkeiten. Darüber darf man nicht die erstaunliche Geschicklichkeit der Zunge vergessen, eine Voraussetzung der Sprache. Ich habe erwähnt, wie geschickt wir z. B. eine Gräte aus dem Nahrungsbrei fischen. Ähnlich die Fähigkeit, ein Bonbon im Mund zu drehen. Dabei ist die Zunge durch ihre eigentümliche Aufhängung eigentlich wenig für solche Arbeiten geeignet. Jedenfalls trifft die Lautsprache auf ein bereits hochentwickeltes Organ. Wenn die Primatenhand schließlich Klavier spielen kann, warum sollte die Zunge dann nicht für die deutsche Sprache exaptierbar sein?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.05.2025 um 08.14 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#54899 Die indische Sprachphilosophie kennt das „Flaschenhals“-Argument auch schon: Wörter gibt es nicht, weil jeder Laut nur existiert, solange er erklingt, und daher nicht mit einem anderen, schon verklungenen, also nicht mehr existierenden verbunden werden kann (bzw. einem noch nicht erklungenen, noch nicht existierenden). (Vgl. R. C. Pandeya: The problem of meaning in Indian philosophy. Delhi 1963:236, nach Patanjali u. a.) Das ist eine Variante der Zenonschen Paradoxien (der ruhende Pfeil usw.). Auf die naturalistische Auflösung will ich hier verzichten. Wie Pandeya zeigt, hat die indische Philosophie unabhängig von der westlichen Tradition, aber auch dem Boden der gleichen referentiellen Zeichenauffassung, "Meinongs Paradox" behandelt (Pandeye geht aber auf die Parallele nicht ein) und so gelöst, daß der Bezugsgegenstand der Wörter im "Geist" existiere. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.05.2025 um 04.07 Uhr |
|
„We have maintained before that chimpanzees show well-developed abilities to conceptualize and to name object and events, certainly two fundamental prerequisites for language (…) We recognize that there is evidence that chimpanzees can form very simple sentences.“ (David F. Armstrong/William C. Stokoe/Sherman E. Wilcox: Gesture and the nature of language. Cambridge 1995:23) So ähnlich liest man es in fast allen Texten, die sich mit dem mutmaßlichen Ursprung der Sprache beschäftigen. (Was „conceptualize“ bedeuten soll, sei dahingesellt; ein Verhalten ist es jedenfalls nicht.) Affen sollen viele Wörter und auch kurze Sätze bilden und verstehen. Was auf dem Boden dieser falschen Voraussetzung spekuliert wird, hat keinen Wert. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.06.2025 um 13.01 Uhr |
|
Oft liest man, der Mensch sei ein Mängelwesen und brauche die Sprache (und Kultur überhaupt), um diese Mängel auszugleichen: „Eben weil der Mensch als Tier nicht überlebensfähig wäre, braucht er ein prinzipiell andere Art des Weltverhaltens, und das ist seine Sprache.“ (Bernhard Weisgerber) Das ist nicht biologisch gedacht. Hier wie überall in der Geschichte gilt vielmehr: „Der Ersatz ist vor dem Verluste da und wird Ursache des Verlustes.“ (Wilhelm Scherer: Zur Geschichte der deutschen Sprache. Berlin 1868:XV) Ob der einzelne Mensch als Tier überlebensfähig wäre, ist nicht entscheidbar, weil es solche Menschen nicht gibt. Alle Menschen sind von anderen Menschen aufgezogen worden, und wenn sie aus irgendeinem Grunde sich selbst überlassen werden wie Robinson, bringen sie die kulturellen Fertigkeiten mit, die sie erworben haben und die unter unglücklichen Umständen tatsächlich nicht ausreichen, um ihr Überleben zu ermöglichen. Das ist aber untypisch und sagt nichts über den Menschen als Gattung.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.06.2025 um 16.02 Uhr |
|
Es scheint uns selbstverständlich, daß wir mit bloßen Händen, Faustkeilen, Hebeln, Flaschenzügen oder Kettensägen auf unsere Umwelt einwirken können. Anders erleben wir die Macht der Sprache. „Worte brechen keine Knochen“, aber viele Menschen haben sich darüber gewundert, daß ein „bewegtes Lüftchen“ (Herder) die größten, manchmal weltgeschichtlichen Wirkungen haben kann. Die antike Rhetorik feierte die Zauberkraft des Wortes und damit sich selbst. In der indischen Mythologie ist die Rede eine Göttin. Im Alten Testament wird die Welt durch Gottes Wort geschaffen, im Neuen ist von Macht und Gefährlichkeit der Zunge die Rede. Aber auch im Alltag werden überall auf der Welt Bräuche gepflegt, die den Glauben an die Macht der Sprache bezeugen: Gebete, Beschwörungen, Segnungen, Weihungen, Exorzismen, Ernennungen, Flüche, Eide, Glaubensbekenntnisse, Entschuldigungen, Euphemismen, Sprachtabus, Political correctness. In Schriftkulturen genießen Schriftzeichen und Bücher hohes Ansehen, oft ergänzt durch die Pracht der Kalligraphie. Die Macht der Sprache soll darin begründet sein, daß Zeichen anders als gewöhnliche Gegenstände nicht nur eine wahrnehmbare, stoffliche Seite haben, sondern auch Bedeutung – „eines der tiefsten Probleme der gegenwärtigen Philosophie“. Der Philosoph Hans Lenk, von dem diese Formulierung stammt, spricht geradezu vom „Wunder des Bedeutens“. Die Wirkung eines Zeichens auf den Empfänger und der Anlaß seines Auftretens stehen, wie es scheint, in keiner Beziehung zu seiner Form, Masse oder Energie (Burrhus F. Skinner: Verbal behavior. New York 1957:1). Schließlich benutzen verschiedene Völker verschiedene Zeichen zum gleichen Zweck. All dies zusammen macht die Willkürlichkeit oder Konventionalität des sprachlichen Zeichens aus, die schon von antiken Autoren bemerkt, aber auch in Frage gestellt wurde. (Exkurs zur Konventionalität:) Vgl. Ilias 2.804; Aristoteles de int. 16a. Die bekannteste Diskussion über die „Richtigkeit der Namen“ ist Platons „Kratylos“. Zur konventionellen, „willkürlichen“ Natur der Wörter vgl. Friedrich Hebbels Distichon: „Viel sind der Sprachen auf Erden; schon dieses sollte uns lehren, daß kein inneres Band Dinge und Zeichen verknüpft.“ Das war also nicht „die große, immer noch nicht genügend gewürdigte Entdeckung von Ferdinand de Saussure“ (Klaus P. Hansen: „Sprache und Kollektiv“. In: Heidrun Kämper/Ludwig M. Eichinger, Hg.: Sprache, Kognition, Kultur. Berlin 2008:14-23, S.17). Ebenso: „De Saussure hatte mehrere grundlegende Entdeckungen gemacht, die von großem Einfluss auf die Linguistik waren. So stellte er fest, dass die Beziehung zwischen einem Zeichen und dem damit Bezeichneten rein willkürlich (arbiträr) war.“ (Karl-Heinz Göttert/Oliver Jungen: Einführung in die Stilistik. München 2004:27) – Dem bedeutenden Germanisten Hermann Paul wird zugestanden: „Und selbst die im 19. Jahrhundert weitgehend ignorierte Arbitrarität des Sprachzeichens ist bei Paul vorgedacht.“ (Jörg Kilian in: „Germanistik als Kulturwissenschaft“. Braunschweig 1997:45) Das wurde nicht ignoriert, sondern war eine Selbstverständlichkeit. (Ende des Exkurses) Vor allem aber: Auf ein Geräusch zu reagieren wie ein Tier scheint etwas ganz anderes zu sein als einen Satz zu verstehen; der „Inhalt“ gehört einer anderen Welt an als sein „Ausdruck“. „Wunder“ kann nicht das letzte Wort sein. Gesucht wird eine Erklärung, die den Schein des Übernatürlichen auflöst: „Wie läßt sich eigentlich das Phänomen der Sprache, das über die Natur hinauszuragen scheint, in einer naturalistischen Philosophie unterbringen?“ (Geert Keil: Kritik des Naturalismus. Heidelberg 1993:83) Und wie läßt sich der Schein des Wunderbaren erklären? Die Antwort, die in unserer Zeit möglich geworden ist, lautet: durch konsequente Anwendung der genetisch-historischen Perspektive in ihren vier Dimensionen: Stammesgeschichte, Kulturgeschichte, Lerngeschichte und Aktualgenese. Vorauszusetzen ist jeweils eine Beschreibung des Phänomens, die nicht schon begrifflich eine solche Erklärung unmöglich macht. Das ist die Beschreibung in reinen Verhaltensbegriffen, ohne das „intentionale Idiom“ der Folk psychology. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 14.06.2025 um 18.29 Uhr |
|
Ich halte überhaupt nichts von dieser ganzen Wunderdeuterei. Man kann ja im Grunde alles überschwenglich als Wunder hinstellen: die Geburt eines Kindes, den Regenbogen, das Feuer und seine Beherrschung, das Rad, Eisenbahn und Auto usw., und genauso eben auch die Sprache. Manche stellen das halt gern etwas theatralisch dar und reden dann von Wundern. Andererseits läßt sich alles auch ganz natürlich erklären, einschließlich Bedeutung und Sprache. Was hat der Mensch, was Tiere nicht haben? Er hat, für mich ganz offenbar, eine besondere Fähigkeit, die ihn von Tieren unterscheidet und die ihm das Denken und die Sprache ermöglicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.06.2025 um 03.41 Uhr |
|
Es geht nicht um Wunder im eigentlichen Sinn, und Hans Lenk wäre der letzte gewesen, an Wunder zu glauben. „Bedeutung“ scheint sich nicht in die natürliche Ordnung zu fügen, und wer gut dualistisch von „Materie UND Bewußtsein“ spricht, kann noch so oft behaupten, „in letzter Instanz“ sei Bewußtsein auch nur Materie, er hüpft über eine selbstgeschaffene Erklärungslücke hinweg. Ich glaube nicht, daß es EINE besondere Eigenschaft ist, die den Menschen zu „Denken und Sprache“ (schon wieder UND!) befähigt, sondern das Zusammenkommen mehrerer Züge, die dann die kulturelle Errungenschaft der Sprache ermöglichen. Und erst dann, auf einer sehr späten Stufe, ist die Sprache so angereichert, daß in manchen Gegenden auch das transgressive Konstrukt des „Denken“ aufkommt. Ich lehne also den „koordinativen Dualismus“ (wie ich es hier genannt habe) ab, aber das ist ein weites Feld. Hier noch einmal meine vorläufige Liste von menschlichen Besonderheiten, die für Sprache zusammenkommen mußten: Lachen und Weinen Lächeln Zeigen (und Verstehen von Zeiggesten) Hochhalten von Gegenständen, um sie anderen zu zeigen usw. Überreichen und Anbieten von Gegenständen („geben“) Präzisionswerfen (Jagd) bildliches Darstellen (Zeichnen, Modellieren) Konstruktives Bauen, Justieren, Zentrieren Musik und Tanz Synchronisation gemeinsamer Anstrengungen Verstellungsspiel Lehren durch Vormachen (Verstellung) Lernen durch Üben (Verstellung) Hinführen zu anderen Orten, damit die Artgenossen etwas sehen können voll opponierbarer Daumen (graduell, mehr als die Altweltaffen, Pinzettengriff) Atemkontrolle Manche Eigenheiten des Menschen sind wohl erst mit Hilfe der Sprache möglich geworden: Unterhalt des Feuers (und dessen Erzeugung) Selbstmord Ich werde aber keine Theorie des Sprachursprungs aufstellen, die gibt es schon wie Sand am Meer. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.06.2025 um 12.27 Uhr |
|
Doch, es geht um Wunder im eigentlichen Sinn, aber nicht bei Kognitivisten oder bei mir, sondern nach meinem Eindruck bei Ihnen! Warum schreiben Sie sonst: "Gesucht wird eine Erklärung, die den Schein des Übernatürlichen auflöst"? Es ist nichts Übernatürliches an Sprache und Bedeutung, und es scheint auch nicht so. Zur etwas überschwenglichen, poetischen Rede vom Wunder lassen sich nur manchmal auch kognitivistische Wissenschaftler hinreißen, aber sie meinen es nicht in diesem eigentlichen Sinne. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.06.2025 um 07.19 Uhr |
|
„Die behavioristische Psychologie hat im Zuge der ‚kognitiven Wende‘ ihre Reputation an die Kognitionswissenschaften abgeben müssen.“ (Geert Keil/Herbert Schnädelbach, Hg.: Naturalismus: Philosophische Beiträge. Frankfurt 2000:23 Damit scheint auch für Keil und Schnädelbach das Urteil über sie gesprochen zu sein. Aber „Reputation“ ist so wenig ein wissenschaftstaugliches Kriterium wie die neuerdings oft beschworene „Interessantheit“. Man wundert sich, in anspruchsvollen, durch terminologischen Aufwand beinahe unzugänglichen Darstellungen doch immer wieder solche primitiven Abkürzungen anzutreffen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.07.2025 um 05.32 Uhr |
|
Ich hatte schon zitiert: „Most strikingly, nonhuman primates do not point or gesture to outside objects or events for others, they do not hold up objects to show them to others, and they do not even hold out objects to offer them to others.“ (Michael Tomasello: Constructing a language. Cambridge, Mass. u. London 2003:10f.) Mir fällt dazu ein, daß schon das noch primitivere Geben (Überreichen von Hand zu Hand) bei Affen nicht vorzukommen scheint, und andere Tiere kommen erst recht nicht in Betracht. Anbieten (Wählenlassen) ist ja schon eine Stufe höher. Mir ist dazu aber nichts aus der Literatur in Erinnerung, und eigene Beobachtungen kann ich im Augenblick nicht anstellen. Weiß jemand etwas darüber? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.07.2025 um 03.19 Uhr |
|
Die ältere Psychologie geht von „psychischen Phänomenen“, „Tatsachen des Bewußtseins“, „Empfindungen“, „Sinnesdaten“ aus und versucht, mit diesen elementaren Bausteinen alles andere zu erklären. Man nennt diesen Zugang auch den „introspektiven“. Die neue Psychologie hält solche Gegenstände oder vielmehr das Reden davon für erklärungsbedürftige und auch erklärbare Konstrukte der gebildeten Alltagssprache innerhalb einer bestimmten Kultur. Sie betrachtet das Verhalten als den eigentlich gegebenen Gegenstand. Während die introspektive und geisteswissenschaftliche Psychologie vom Menschen ausgeht, rückt die Verhaltensanalyse eher andere Tiere in den Mittelpunkt und gewinnt an ihnen die Begriffe und Erklärungen, die sie dann auch auf den Menschen anwendet. „Die Psychologie war seit Descartes und Locke gedacht als die Wissenschaft von den Erlebnissen, als eine Theorie dessen, was der sogenannten inneren Wahrnehmung, der Selbstbeobachtung, zugänglich ist. Jeder hat sein eigenes Ich und sein Gesichtsfeld der inneren Wahrnehmung, in das ihm kein Nachbar unmittelbar hineinschauen kann. So war die Psychologie ihrem Ausgangsgegenstand nach eine solipsistisch aufgebaute Wissenschaft.“ (Karl Bühler: Die Krise der Psychologie. Frankfurt, Berlin, Wien 1978 [1927]:17) Bühler stellte auch mit Recht fest, daß Aristoteles der objektiven, ich würde sagen, behavioristischen Psychologie nahestand, zu der die heutige Verhaltenswissenschaft zurückkehrt (allerdings nicht Bühler selbst). Im Grunde treibt schon der Biologe Aristoteles eine „Psychologie ohne Seele“. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.07.2025 um 04.21 Uhr |
|
Karl Bühler war es auch, der wohl als erster, wenn auch mit anderen Worten, die Erkenntnis von der empfängerseitigen Semantisierung ausgesprochen hat. Die geballte Faust ist eine reduzierte und ritualisierte Form des Zuschlagens und als Ausdrucksbewegung deutbar, aber ein wirkliches Zeichen ist sie dadurch noch nicht. Bühler sieht, daß dem Ausdruck ein Eindruck, der Kundgabe eine Kundnahme entsprechen muß, daß also die Semantisierung, die aus einem Verhalten ein Zeichen macht, vom Empfänger ausgeht: „Wenn die geballte Faust nicht mehr zuschlägt, so kann die Bewegung immer noch einen Zweck erfüllen, vorausgesetzt, daß der andere, dem sie gilt, als Wahrnehmender darauf reagiert.“ (Die Krise der Psychologie. Frankfurt, Berlin, Wien 1978 [1927]:34) Bühler ergänzt und korrigiert damit die bekannte Darstellung Darwins und Wundts. Skinner faßt knapp zusammen: „Meaning or content is not a current property of a speakers’ behavior. It is a surrogate of the history of reinforcement which has led to the occurrence of that behavior, and that history is physical.“ (A. Charles Catania/Stevan R. Harnad, Hg.: The selection of behavior. Cambridge u. a. 1988:238) Diese Herleitung des wirklichen Zeichens ist allerdings aus der Erlebnisperspektive nicht erkennbar, sondern nur aus der Sicht der Verhaltensanalyse. Daher die Berechtigung des Behaviorismus, wie Bühler ausdrücklich festhält: Die Forschungen zur Kommunikation der Bienen zum Beispiel (v. Frisch und sein Vorgänger Buttel-Reepen werden erwähnt) machen keinerlei Gebrauch von Begriffen der Erlebnispsychologie. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.08.2025 um 06.07 Uhr |
|
Zu den Dreijährigen, die angeblich schon das intellektuelle Niveau von Schimpansen erreichen, etwas Anekdotisches: Die Enkelin (3;7) sieht, daß die Oma zum Geburtstag Ingwerwürfel in Schokolade bekommen hat; nach dem Essen soll sie davon kosten dürfen. Beim Essen sagt sie: „Oma, kannst du die Tüten mit dem Ingwer wegstellen? Wenn ich sie immer sehe, will ich sie schon vor dem Essen probieren.“ Ein Junge fährt über Stock und Stein, wir erklären ihr umständlich, daß er ein besonderes Rad habe. Sie unterbricht knapp: „Ein Sportrad. Das ist ein Profi.“ |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.08.2025 um 16.48 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#55583 In der wundersamen Wirkung bloßer Zeichen auf die Welt sieht auch Max Black einen Grund für die verbreiteten magischen Ansichten über Sprache (The labyrinth of language. Harmondsworth 1968:5; dt. Sprache. München 1973:15) Durch die Sprache wird jedes Kind zum Zauberer: Es ruft – und die guten Dinge kommen herbei. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 11.08.2025 um 17.44 Uhr |
|
Meine Enkelin (5) beobachtet mich beim Lesen. "Opa, warum liest du nicht?" Ich, verwundert: "Aber ich lese doch", und deute auf mein Buch. Darauf sie: "Aber dein Mund ist zu." |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.08.2025 um 18.01 Uhr |
|
Also die gleiche Verwunderung wie die der Zeitgenossen über Bischof Ambrosius von Mailand. S. aber auch Stephan Busch: „Lautes und leises Lesen in der Antike“ (http://www.rhm.uni-koeln.de/145/Busch.pdf).
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 12.08.2025 um 23.37 Uhr |
|
Beinahe hätte mich meine Enkelin bei dieser Stelle erwischt: "Erst im Mittelalter lernte man lesen, ohne laut zu lesen. Genauso muß ein Junge laut lesen lernen, ehe er leise lesen lernt, und laut dahinplappern, bevor er still zu sich selbst plappert. Und doch haben viele Theoretiker angenommen, die Stille, in der die meisten von uns denken gelernt haben, sei eine notwendige Eigenschaft alles Denkens." (G. Ryle, Der Begriff des Geistes, Reclam 2021, S. 29) Aber ganz so absolut darf man das nach Stephan Busch auch nicht nehmen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 14.08.2025 um 14.50 Uhr |
|
Zwei meiner Enkel zu Besuch bei ihrem Onkel. Er fragt: "Wer hilft mir beim Kochen?" Die 3jährige: "Ich kann helfen." Die 5jährige: "Ich spiel schön." |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.08.2025 um 06.45 Uhr |
|
Durch Ziehen an einem Tuch oder einer Schnur kann ein Gegenstand näher herangeholt werden. Der Vorgang ist selbstverstärkend, ein Kind im Alter von etwa 10 Monaten erlernt ihn. Manche Vögel (Rabenvögel) lernen es, einen Brocken Nahrung an einer Schnur zu „angeln“ oder „einzuholen“, andere nicht. Der Unterschied ist nicht erklärt, könnte aber mit dem Nestbau zusammenhängen. Ich beobachte gern Störche in der Storchen-Webcam und sehe, wie sie täglich ihr riesiges Nest in Ordnung bringen, überstehende Zweige zurückziehen oder -schieben usw. Es sieht rationaler aus, als es ist, scheint aber durch Lernen ausbaufähig.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.09.2025 um 06.50 Uhr |
|
Die jüngste Enkelin zeigt mit vier Wochen das erste Lächeln; das ist guter Durchschnitt. Es wirkt noch zufällig und unsicher, festigt sich aber in den nächsten Tagen. Es scheint reflexhaft zu sein und nicht durch Lernen verstärkt zu werden, aber die kommunikative Wirkung auf die Eltern ist stark. Hinzu kommt der fixierende Blick in deren Augen. Auch ist die Geburtsdeformation des Schädels überwunden und das zerknautschte Gesicht längst zum hübschesten auf der Welt mutiert, wie jedenfalls die Erzeuger (und deren Erzeuger) finden. Das gehört zum Brutpflegeverhalten. – Wichtig ist mir, daß die kommunikative Beziehung zu den Eltern sich in ganz kleinen Schritten entwickelt. Das spricht gegen Tomasellos "Neunmonatsrevolution". Das Kind entdeckt zu keinem Zeitpunkt, daß der andere auch ein Geistesleben hat (eine Person ist, also ein dialogfähiges Wesen). Neun Monate – das ist nicht mehr weit vom ersten Wort entfernt. Dann ist das Kind längst ein Gesprächspartner der Pflegeperson und unterscheidet praktisch zwischen dieser und irgendeinem Ding. Wie kann man das alles übersehen?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.09.2025 um 09.11 Uhr |
|
Neugeborene sehen nicht nur recht zerknautscht aus, sondern wirken auch so, als seien sie sauer, überhaupt auf diese Welt gekommen zu sein. Aber nachtragend sind sie nicht. Mit fünf Wochen blickt das Mädchen der Mutter, die mit ihr spricht, intensiv in die Augen, lächelt immer wieder und zappelt mit den noch unkoordinierten Armen und Beinen, als sei sie voller Tatendrang. Zufriedener kann man nicht aussehen. Manchmal hat sie den Kopf zur Seite gewendet und schaut auf das Fenster und die Bäume, aber dabei lächelt sie nicht. Man kann also die kommunikative Beziehung schon klar unterscheiden. Die erste Stufe der Sprache ist schon da.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.09.2025 um 04.39 Uhr |
|
Wenn der verhexte Großvater sich auf seine nüchterne biologische Sicht der Sache besinnt, kann er feststellen: Das Überleben des Säuglings hängt von der Beziehung zur Mutter ab, nicht von der Geschicktheit im Manipulieren von Dingen; das kommt später hinzu. Das Kind wirbt um die Gunst der Mutter. Das Lächeln ist ein wesentlicher Teil davon, und das ist sein Sinn. (Ich hatte gerade wieder einige Wochen Gelegenheit, das Werben der jungen Möwen um die Gunst der Mutter zu beobachten; irgendwann artet es in Flegelhaftigkeit aus, und die Mutter versucht alles mögliche, um den längst erwachsenen, nur noch ziemlich grauen Blagen Beine bzw. Flügel zu machen und sie selber auf Fischfang zu schicken.)
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.09.2025 um 04.19 Uhr |
|
Kühner Gedanke, das gesamte Wissen, die Wissenschaften und Technologien, als Anpassung zu deuten. Anpassung, die die Geschichte einbezieht. Reaktionen werden durch Erwartungen ergänzt und immens erweitert. Zum Beispiel die Zusammenfassung von Erfahrungen in der Zuschreibung eines Charakters (einer Persönlichkeit oder Verhaltensdisposition). Sprache wäre die umfassendste Anpassungsleistung. Bei kleinen Kindern kann man noch beobachten, wie sie sich mit Hilfe der Sprache immer besser „zurechtfinden“ (ein anderes Wort für Anpassung). Die Handhabung eines Feldsteins ist angepaßtes, überlebensdienliches Verhalten, das leuchtet sofort ein. Das Zuschlagen des Steins zu besserer Handhabbarkeit ist der nächste Schritt. Die mythologische Deutung der Naturerscheinungen ist eine weitere Phase, wenn auch aus Sicht der nächsten, naturwissenschaftlichen, ein Schritt in die falsche Richtung (Comte und die Folgen). Die Natur religiös zu verstehen ist besser als sie gar nicht zu verstehen. Bei den Vorsokratikern sehen wir die Ablösung der religiösen Weltdeutung durch die naturalistische. Daß die Sonne ein glühender Stein sei, ist scheinbar genauso verkehrt wie ihre göttliche Deutung, aber in Wirklichkeit war es ein großer Fortschritt. Die Richtung stimmte. Zweieinhalb Jahrtausende später führte der naturalistische Ansatz zum richtigen Verständnis. Der entscheidende Schritt war, nicht mehr die Oxidation, sondern die Kernfusion als Energiequelle identifizieren zu können. Das war Jahrhunderte nach der Entwicklung der Himmelsmechanik und setzte ein ganz anderes Instrumentarium als die jedermann zugängliche Geometrie und Elementarphysik voraus. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.10.2025 um 17.39 Uhr |
|
Die Störche sind abgezogen, aber wenn sie wiederkommen, kann man ihnen in zahlreichen Webcams beim Reparieren ihrer alten Nester zusehen. Sie haben natürlich keinen Plan vom Nest im Kopf, geschweige denn vom Zweck der Übung (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1106#43419), sondern reagieren auf lokale Abweichungen (Lücken, herausragende Zweige usw.) mit stereotypen, aber zweckmäßigen Aktionen. Sie „können nicht anders“, und so kommt es zu einem schönen runden sturmfesten Nest, in dem auch die nachreisende Gattin und vier Junge Platz haben. Daß es sich so verhält, glaubt man regelrecht zu sehen, wenn man ihnen ein Stündchen genau zuschaut. Sie koten nie ins Nest und entfernen den Kot der Jungen daraus. Natürlich „wissen“ sie nicht, was sie tun, dieser Begriff ist hier nicht anwendbar. Wenn man darüber nachdenkt, läßt sich von „wissen“ nur sprechen, wo ein Organismus „auch anders kann“ (also eine Person, ein Dialogpartner wäre). Wissen setzt voraus, daß der Verhaltensablauf durch Einspruch unterbrochen werden kann. Auch wissen (genauer die Zuschreibung von Wissen) hängt also mit der Intentionalität zusammen, wie wir sie dialogisch rekonstruiert haben. Ohne Sprache kein Wissen. Viele Störche scheinen sich gar nicht mehr die Mühe der weiten Reise nach Afrika zu machen, weil die milden Winter ihnen auch hier genug Frösche und Mäuse bescheren und notfalls ein „Storchenvater“ sich um sie kümmert. Aber meine sind erst mal weg, und bloß ich muß hier überwintern. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 15.10.2025 um 19.11 Uhr |
|
Unser jüngster Enkel ist gerade 3 geworden. Seine Mutter ist Österreicherin, die Familie lebt aber in Berlin und sie sprechen zu Hause normalerweise hochdeutsch. Manchmal wird er auf der Treppe zur Wohnung noch getragen, und dann sagt die Mutter schon mal "jetzt gehts aufi" oder "owi", je nach dem, was er zwar versteht, aber gar nicht mag. Da korrigiert er sie dann, "Nich so reden" oder sogar "Das heißt oben".
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.10.2025 um 04.48 Uhr |
|
Bonobos – von anderen Tieren ganz zu schweigen – lernen nie, ein Feuer zu unterhalten, obwohl sie gern um ein von Menschen zurückgelassenes Feuer herumsitzen (Daniel Dennett: From bacteria to Bach and back. London, New York 2017:252). Daß Kanzi mit bereitgestelltem Gerät ein Feuer anzünden konnte, ist einfach ein weiteres Kunststück und hat nichts mit der menschlichen Beherrschung des Feuers zu tun. Dieser epochalen Erfindung, die wahrscheinlich nicht von heute auf morgen stattfand, ist der Bonobo damit keinen Schritt näher gekommen. Ähnlich ist es mit dem Werkzeuggebrauch, den Affen teilweise lernen – aber nur als Kunststückchen und nicht als Teil ihres Lebens. Verhaltensforscher sind für diesen Unterschied eigentümlich blind.
|