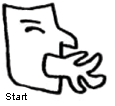


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
17.04.2009
Verweht
Blasse Erinnerungen an die Sprachwissenschaft
In den letzten Jahren sind tonnenweise Bücher aus den Bibliotheken geflogen, die von generativer Grammatik handelten, einst der letzte Schrei.
In unserer Studentenzeit lernten wir aber ganz brav noch andere "Schulen" kennen, freilich ohne die Spur einer Anwendung, aber so stand es in den Lehrbüchern:
Tagmemik (Kenneth L. Pike, vom Summer Institute of Linguistics)
Stratifikationsgrammatik (Sidney Lamb; keine Ahnung mehr, was das war)
Applikationsgrammatik (Schaumjan; seitenweise Formeln, gleich überblättert).
Warum hat man das alles abgedruckt und wiedergekäut? Hätte man die Fruchtlosigkeit nicht schon damals erkennen können?
Leider haben wir damals das nahrhafte Werk von B. F. Skinner nicht in die Hand bekommen, das hätte uns manches erspart und uns weitergebracht.
Gut war die ausgiebige Beschäftigung mit Sprachgeschichte. Daraus könnte man Lehren ziehen.
| Kommentare zu »Verweht« |
| Kommentar schreiben | neueste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.04.2009 um 12.17 Uhr |
|
Weil es gerade ums Aufräumen geht, will ich noch eine Buchbesprechung hier einrücken, die ich vor Jahren mal irgendwo veröffentlicht habe: Peter Suchsland (Hg.): Biologische und soziale Grundlagen der Sprache. Interdisziplinäres Symposium des Wissenschaftsbereiches Germanistik der Friedrich-Schiller-Universität Jena, 17.-19. Oktober 1989. Tübingen: Niemeyer 1992. (Linguistische Arbeiten 280) Der Ausgangspunkt von Manfred Bierwischs Aufsatz (“Probleme der biologischen Erklärung natürlicher Sprache“) ist die bekannte, von der Chomsky-Orthodoxie seit Jahrzehnten unverändert vertretene These, dem Erstsprachenlerner stehe eine so lückenhafte Information zur Verfügung, daß der Spracherwerb nicht ohne die Annahme einer angeborenen „Universalgrammatik“ zu erklären sei. Die Forschung hat längst gezeigt, daß jene angebliche Lückenhaftigkeit in Wirklichkeit die Lückenhaftigkeit einer Forschung ist, die gerade durch das nativistische Dogma längere Zeit daran gehindert worden ist, genauer nachzusehen, was sich – vereinfacht gesagt – zwischen Mutter und Kind tatsächlich abspielt. Auch kann das von Bierwisch mehrfach angeführte, also offenbar für besonders beweiskräftig gehaltene Beispiel aus seinem engeren Arbeitsbereich, den Dimensionsadjektiven, am wenigsten überzeugen. Das Kind lerne Sätze kennen wie Das Brett ist einen Meter lang und Das Brett ist einen Meter kurz. Es könne daraus nicht entnehmen, daß der zweite Satz, obwohl und gerade weil er ebenfalls Sinn hat, dennoch abweichend gebildet ist. Aber solche scherzhaften „Neutralisationsverweigerungen“, wie man sie nennen könnte (Bierwisch führt auch das bekanntere siebzehn Jahre jung an), gehen, wie die verwandten Erscheinungen der Ironie, des Spaßes usw., durchaus mit zusätzlichen Informationen in Kontext und Situation einher, die ihr besonderes Verhältnis zur Norm signalisieren. Das Kind sitzt nicht in einem abgeschlossenen Gehäuse, einzig damit beschäftigt, einlaufende Lautketten zu dechiffrieren. Bierwisch spezifiziert die angebliche Lückenhaftigkeit in der traditionellen Weise: Die Information sei fehlerhaft, unvollständig und umfasse keine „systematischen Korrekturen“ (so mehrfach); auch gebe es keine „systematische“ Instruktion von seiten der Erwachsenen. Was unter „systematisch“ zu verstehen ist, bleibt unklar. Falls gemeint sein sollte, daß alles Richtige immer bekräftigt und alles Falsche immer korrigiert werden müßte, wäre es nicht das, was die behavioristische Lerntheorie fordert. Und gerade gegen diese Lerntheorie wendet sich Bierwisch mit den genannten Argumenten, wie es eben zum guten nativistischen Ton gehört. Dabei fällt auf, daß der Kern der angeblich „obsoleten Konzepte“ „des reinen Konditionierungslernens“ überhaupt nicht erwähnt wird, nämlich die selektive Bekräftigung spontaner Verhaltensformen. – Auf derartig unsicherem Grund wird das Kartenhaus der „Universalgrammatik“ errichtet, und daran schließen sich wieder biologisierende Spekulationen über deren physiologische und evolutionstheoretische Erklärbarkeit an. Es wirkt paradox, daß Bierwisch in der phylogenetischen und in der historischen (kulturgeschichtlichen) Dimension durchaus das evolutionäre Erklärungsschema würdigt, das man mit Donald Campbell als „blind variation and selective retention“ kennzeichnen könnte, daß er die Anwendung desselben Schemas auf die ontogenetische Dimension des individuellen Lernens jedoch nicht ernsthaft in Erwägung zieht. Seit Chomskys Skinner-Kritik scheint hier ein Denkverbot zu herrschen, das sich auch als Wahrnehmungsblockade auswirkt. Übrigens gelangt Bierwisch im Zusammenhang mit der Prinzipien-und-Parameter-Theorie zu der Erkenntnis, daß „Parameter träge sind“, daß daher „Fehler im Informationsangebot keine gravierende Rolle spielen und daß positive Evidenz ausreichend ist.“ Gleichwohl wird die Fehler- und Lückenhaftigkeit des Inputs nach wie vor als Argument gegen die „Lernbarkeit“ natürlicher Sprachen angeführt, obwohl doch gerade für die behavioristische Lerntheorie Fehler und Lücken auch „keine gravierende Rolle“ spielen! Im zweiten Teil geht Bierwisch auf den Ursprung der Sprache ein, bewertet seine Gedanken aber selbst als „spekulativ“, so daß auf eine nähere Erörterung hier verzichtet werden soll. Dafür kann auf das Korreferat von Gábor Györi („Über Spezifik und Entstehung der Sprachfähigkeit“) verwiesen werden. Es korrigiert Bierwischs Darstellung vor allem mit einigen populationsgenetischen Argumenten und ruft auch die wichtige Unterscheidung von teleologischen und teleonomischen Erklärungen in Erinnerung. Funktionale Erklärungen z.B. in der Verhaltensbiologie seien nicht zu beanstanden, wenn man sie teleonomisch verstehe – eine Bemerkung von grundsätzlicher Bedeutung nicht nur im Hinblick auf Bierwischs Beitrag. – Ich möchte noch hinzufügen, daß Bierwisch sich in einen Selbstwiderspruch verwickelt, wenn er zwecks Zurückweisung einer funktionalistischen Erklärung der Sprache auf heutige Steinzeitkulturen verweist, mit artistischen Verwendungsweisen der Sprache, „die extensiv gebraucht werden in weitgehend zweckfreien, luxurierenden Zusammenhängen, deren Funktion weit eher die Pflege des Gruppenzusammenhalts ist als die Regelung der Arbeitsprozesse.“ – Totenkult, Religion und dergleichen mögen dem „Gruppenzusammenhalt“ dienen, aber das ist für diese Kulturgemeinschaften nichts „Luxurierendes“, sondern eine ebenso ernste, auch praktisch wichtige „Arbeit“ wie das Beschaffen der Nahrung usw. (Vgl. auch den Beitrag von Joachim Herrmann: „Das anthropologisch-historische Umfeld für die Herausbildung der Sprachfähigkeit“, wo „Arbeit“ definiert wird als „Tätigkeit des Menschen in der Auseinandersetzung mit der Naturumwelt zur Aneigung der notwendigen Existenzmittel und zur Sicherung der Existenzbedingungen“.) Daß funktionale und biologische Erklärungen der Sprache einander nicht ins Gehege kommen können, stellt Bruno Strecker klar („Zur Evolution von Sprachfähigkeit und Sprache“). Sascha W. Felix („Biologische Faktoren des Spracherwerbs“) versucht – auf derselben chomskyanischen Grundlage wie Bierwisch – seine bekannte These zu untermauern, daß die „Universalgrammatik“ (UG) dem Kind nicht sofort zur Verfügung stehe, sondern allmählich heranreife, so daß das Kind in früheren Stadien durchaus Prinzipien der UG verletzen könne. (Wenn man diese Darstellung gegen den Strich liest, kann man sie auch als erstes Anzeichen einer Abwendung von dem „UG“-Konzept und vom Nativismus überhaupt verstehen. Aber vielleicht bin ich zu optimistisch. Felix folgert jedenfalls aus der Vielfalt der kindlichen Konstruktionen gerade im Gegenteil eine noch weitaus stärkere biologische Determination des Spracherwerbs, während man ebensogut wirkliches Lernen dafür verantwortlich machen könnte. Je mehr man sich auf die tatsächliche Vielfalt der Kindersprache einläßt, desto unglaubwürdiger wird ja die Behauptung, das Kind konstruiere aus fehlerhaftem Input einen korrekten Output.) Um die Argumentationsweise dieses Aufsatzes zu kennzeichnen, genügt wohl ein Beispiel: Eine bekannte Konstruktion aus dem Zweiwortstadium lautet mommy bathroom. Das interpretiert Felix zunächst als „Mommy is in the bathroom“. Daraus gewinnt er die Erkenntnis, daß bathroom eine „Präpositionalphrase“ sei. Ihr fehlt jedoch offensichtlich der „Kopf“, nämlich die Präposition, und damit verletzt sie das universalgrammatische Prinzip der X-bar-Theorie, wonach jede maximale Projektion einen Kopf haben muß! Peter Eisenberg („Platos Problem und die Lernbarkeit der Syntax“) setzt sich kritisch mit Bierwischs Argument der „poverty of evidence“ auseinander und legt auch die geradezu umwerfende Dürftigkeit von Chomskys und Bierwischs „Beweisen“ schonungslos offen. Besonders wichtig scheint mir, daß Eisenberg jeweils die Lerngeschichte der Sprecher berücksichtigt, die ihnen durchaus genügend Hinweise auf die richtige Analyse syntaktischer Vexierbilder gibt. Eisenbergs Aufsatz ist kurz, aber so bedeutsam, daß seine Lektüre allen Nativisten dringend anzuraten ist. Jürgen Tesak („Zur Autonomie-Hypothese der generativen Grammatik“) untersucht insbesondere die Begründungen, die Fanselow und Felix aus der Agrammatismus-Forschung zur Stützung der These von der Autonomie der Grammatik (und damit von der Modularität der Sprachfähigkeit) gewonnen haben. Er zeigt, daß die Lokalisation grammatischer Fähigkeiten in bestimmten Hirnarealen voreilig ist. Weder läßt sich das Syndrom der Broca-Aphasie mit dem Agrammatismus identifizieren, noch gibt es einfache Zuordnungen zwischen Aphasietypen und betroffenen Hirnregionen. Fanselow/Felix haben, wie der Autor weiter nachweist, ein unzulässig verengtes und vereindeutigtes Bild von Broca-Aphasie bzw. Agrammatismus, so daß auch ihre weitreichenden theoretischen Folgerungen nicht haltbar sind. Wolfgang U. Wurzel („Grammatisches und Soziales beim Sprachwandel“) stellt den Sprachwandel, besonders den morphologischen, als Reflex von „Präferenzprinzipien“ dar, womit er seine früheren Überlegungen zur morphologischen „Natürlichkeit“ fortsetzt. Zum Beispiel bevorzugen die Sprecher systematisch gebildete Formen gegenüber suppletiven (Prinzip der Transparenz). Solche Prinzipien können einander widersprechen und müssen deshalb in eine hierarchische Ordnung gebracht werden. Der natürliche grammatische Wandel verläuft dann in Richtung auf die weniger markierten und daher bevorzugten Formen. Als Ort, an dem sich diese Tendenz real auswirkt, identifiziert Wurzel naheliegenderweise den kindlichen Spracherwerb, und zwar das Stadium der Übergeneralisierung. Die kindlichen Veränderungen der Sprache bedürfen freilich der Duldung durch die Sprachgemeinschaft. In dieser Haltung der Gemeinschaft, ihrem Normbewußtsein, kommt der soziale Faktor ins Spiel. Wurzel meint, daß Zeiten des sozialen Umbruchs auch zur „progressiven“ Duldung grammatischer Neuerungen führe. In kleinen Sprachgemeinschaften schreitet der phonologische Wandel ungehindert fort und bringt ständig morphologische Markiertheit hervor, die durch morphologischen Wandel eingeebnet werden kann, wozu aber gerade in kleinen Gemeinschaften wenig Anlaß besteht. In größeren sorgt der Ausgleich der Regionen für Verlangsamung des phonologischen Wandels, aber Beschleunigung des morphologischen. Mit diesen und anderen Instrumenten läßt sich der künftige Sprachwandel zwar immer noch nicht vorhersagen, der bereits eingetretene aber plausibler erklären. Inger Rosengren („Zum Problem der kohärenten Verben im Deutschen“) beschäftigt sich mit der Frage, wie „kohärente“ Verbkonstruktionen (im Sinne Gunnar Bechs) in einer Transformationsgrammatik aufzubauen sind. Dazu werden vor allem Stellungsmöglichkeiten und morphologische Veränderungen (Ersatzinfinitiv) im Umkreis von Modalverben, AcI-Verben, Phasenverben (anfangen) sowie Verben wie scheinen, versuchen u.a. untersucht. Was Rosengren – wie auch andere Autoren – als „Daten“ präsentiert, sind leider nach alter generativistischer Unart weitgehend selbstgemachte Beispielsätze nebst hinzugefügten, ebenfalls aus eigener Machtvollkommenheit stammenden Akzeptabilitätsurteilen. Als untadelig gelten z.B. Singen dürfen würde er das Lied bestimmt haben können, wenn er es hätte wollen. „Nicht ungrammatisch“ findet Rosengren auch weil es Fritz den Meister entfernen zu dürfen bat. Dagegen hält sie ?weil diesen Baum der Oberförster zu fällen zaudern muß/zaudert für „nicht ganz akzeptabel“. – Es ist theoretisch durchaus nicht belanglos, ob solche Strukturen belegt werden können, ob sie dialektal beschränkt sind und wie häufig sie überhaupt vorkommen; denn nur für geläufige Satzmuster kann man mit einigermaßen festen Gewohnheiten der Sprecher rechnen, die sich linguistisch als „Regeln“ rekonstruieren lassen. Eine Grammatik an sich, jenseits dieser Gewohnheiten, gibt es nicht. Wir wissen einfach nicht, was wir mit Strukturen anfangen sollen, die nicht ohne Grund kaum oder gar nicht belegbar sind. Deshalb sind auch Unterscheidungen wie „grammatisch, aber nicht gut“ gegenstandslos. Aber gerade solche zwiespältigen Prädikate verteilen Autoren wie Rosengren ganz unbedenklich. Statt einer kritischen Reflexion über dieses Verfahren finden wir auch hier wieder wie seit Jahrzehnten den abgeschmackten Streit der Transformationsgrammatiker über die Bewertung ihrer Kopfgeburten. Der Satz wenn er das Kind hätte zu essen zwingen können ist nach Hubert Haider ungrammatisch, Rosengren findet ihn jedoch „ziemlich gut“. Für Gisbert Fanselow („Zur biologischen Autonomie der Grammatik“) ist Radios weiß ich nicht wer repariert hat ein akzeptabler deutscher Satz, andere mögen es bezweifeln. Auch abgesehen von der zweifelhaften Materialgrundlage ist die Argumentation stellenweise fehlerhaft. Rosengren betrachtet anscheinend daß sie die Jägerprüfung hat ablegen müssen und daß sie die Jägerprüfung abgelegt haben muß als bloße Stellungsvarianten mit unterschiedlichen Folgen für den Status des regierten Verbs. In Wirklichkeit sind es verschiedene Sätze (im ersten geht es um ein Gemußthaben, im zweiten um ein Habenmüssen). Wenn das Hilfsverb (haben) das Modalverb (müssen) regiert, kann es selbstverständlich dem Hauptverb (ablegen) keinen Status zuweisen, ganz gleich ob es links oder rechts davon steht. Anita Steube („Kompositionsprinzipien in der Semantischen Form und das Problem der Autonomie der Semantik“) untersucht ebenfalls den Verbalkomplex und im Zusammenhang damit besonders den Bezug von Adverbialbestimmungen. Im weitaus umfangreichsten Beitrag des Bandes („Kompositionsprinzipien und grammatische Struktur“) – eigentlich einem Buch für sich – diskutiert Arnim von Stechow eine Fülle aktueller Probleme der generativen Rektions-und-Bindungs-Theorie. Das kann hier nicht referiert werden. Die Darstellung wird meiner Ansicht nach nur verständlich, wenn man sich die selten ausgesprochene Prämisse der generativen Theorie klar macht, daß alles, was zur Interpretation eines Satzes erforderlich ist, auf irgendeiner „tieferen“ Ebene in der Ableitungsgeschichte dieses Satzes auch ausdrücklich formuliert sein muß, bevor es auf dem Weg zur Oberfläche gegebenenfalls getilgt wird. Dadurch bevölkert sich die „Tiefe“ mit fingierten Objekten: PROs, „Spuren“ und „leeren Kategorien“, numerierten und indizierten Nichtsen, von denen gleichwohl Wirkungen ausgehen sollen. Der Band enthält noch eine Reihe kürzerer Korreferate und Gelegenheitsarbeiten von geringerem Interesse. Sonderbar ist, daß – vom Umfang her gesehen – fast die Hälfte des Bandes von Arbeiten ausgefüllt wird, die mit dem Rahmenthema nichts zu tun haben. A. v. Stechow begründet das für seinen Teil mit dem Hinweis, zum Rahmenthema sei längst alles gesagt und deshalb wolle er lieber von etwas anderem reden. |
Kommentar von Jan-Martin Wagner, verfaßt am 05.06.2010 um 18.40 Uhr |
|
“The field has matured, and there is a trend towards more empirical work,” says evolutionary biologist W. Tecumseh Fitch of the University of Vienna in Austria. One reason is that fewer scientists now follow the early views of linguist Noam Chomsky that language emerged de novo in humans, with little or no ape precursors. Indeed, Chomsky himself no longer holds strictly to that view, as evidenced by a seminal 2002 paper in Science he co-authored with Fitch and Harvard University psychologist Marc Hauser (Science, 22 November 2002, p. 1569), urging research into both the aspects of human language unique to humans and the aspects shared with other animals. (Aus "Animal Communication Helps Reveal Roots of Language", Science 328, pp. 969–971, 21. Mai 2010; erschienen anläßlich der Konferenz "Evolang8" in Utrecht [http://evolang2010.nl/]) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.05.2022 um 04.55 Uhr |
|
Ein gewisser Andrew Radford war äußerst erfolgreich als Verfasser von ein oder zwei Lehrbüchern der Transformationsgrammatik, die nicht nur an deutschen Universtitäten als Grundlage von Einführungskursen dienten, weil sie als didaktisch vorbildlich und außerdem als zuverlässig im Sinne der jeweils geltenden Version von Chomskys Lehre galten. Ich kann mich nicht erinnern, dem Namen Radford sonst irgendwo begegnet zu sein. Der relative lange Eintrag bei Wikipedia kennt nicht einmal sein Geburtsdatum. Meine Frau mußte in München auch nach seinem Buch lernen, Seite für Seite, ohne daß der ganze Ansatz je hinterfragt wurde. Es galt damals als erstrebenswert, nur ein einziges Buch, dieses aber sehr gründlich studiert zu haben. Mir kam es damals schon scholastisch vor. Wir haben das zerlesene Buch inzwischen entsorgt. Es ist jammerschade, daß so viele junge Leute in ihren bildsamen Jahren nicht historische Sprachwissenschaft studiert haben statt dieses Zeug. |