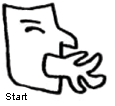


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Nachrichten rund um die Rechtschreibreform
Zur vorherigen / nächsten Nachricht
Zu den Kommentaren zu dieser Nachricht | einen Kommentar dazu schreiben
01.10.2013
Stefan Stirnemann
Von den Kehllauten kindlicher Eidgenossen
Ein Märchen über Deutschland, die Reform der Rechtschreibung und die Schweizer Orthographische Konferenz
Diesen Beitrag von Stefan Stirnemann im „Schweizer Monat“ (Ausgabe September 2013) veröffentlichen wir hier mit großzügiger Erlaubnis des Herausgebers Dr. René Scheu.
Vor zweihundert Jahren veröffentlichten die Brüder Wilhelm und Jacob Grimm ihr Märchenbuch. Nicht nur Märchen sammelten sie aber, sondern auch Wörter; die vielbändige Sammlung trägt den schlichten Titel «Deutsches Wörterbuch». Der Märchenschatz und der Wortschatz des deutschen Brüderpaars freuen und nähren bis heute auch unsere Schweizer Ohren, Augen und Seelen, und auch bei uns zu Lande steht der Name Grimm in Ehren. Und was ist mit unserer Ehre? Wilhelm Grimm sagte, als er 1846 auf dem Germanistentag zu Frankfurt am Main seinen «Bericht über das Deutsche Wörterbuch» vortrug und dabei die verschiedenen Mundarten würdigte: «Zwischen den Kehllauten des Schweizers dringt das Naive seiner Worte um so lebhafter hervor.» Das war ernst und freundlich gemeint; doch Freundlichkeit, die von oben kommt, weckt ungute Gefühle bei dem, den sie ins Unten versetzt. Seht das putzige Gartenzwerglein, dem Deutschland irgendwas ins geflochtene Rückenkörblein legen kann, vor hundertfünfzig Jahren ein Schulterklopfen und heute – schauen wir auf unsere Zeit – eine verunstaltete Rechtschreibung, an der seit bald zwei Jahrzehnten gebastelt wird.
Wilhelm Grimms Wort ruft nach Antwort, und so sei ihm und seinem Bruder in ihrem Jubiläumsjahr ein Märchen erzählt. Wenn jemand in der Nähe ist und zuhören möchte, so verwehre ich es ihm nicht. Achtung, das Märchen beginnt.
In alten Zeiten, als das Fluchen noch geholfen, wenn auch nichts genützt hat, reformierten die Kultusminister Deutschlands die Rechtschreibung der deutschen Sprache, und ein scheues Alpentier – selten gesehen, noch seltener geschrieben – trat nicht mehr als Gemse, sondern als Gämse auf. Frage: Warum liessen die mächtigen Minister nicht auch Vater und Mutter zu Ältern umschreiben, sind sie doch von Berufs wegen die Älteren? Antwort: Weil im Raum der deutschen Sprache deutlich mehr Eltern als Gemsen leben und weil diese Eltern das Recht haben, Politiker abzuwählen, wenn sie Unfug anstellen. Von vornherein war also das politische Ziel, zwar etwas zu verändern, aber allzu groben und insofern gefährlichen Unfug zu meiden. Unfug freilich blieb genug: Es tut mir Leid, morgen Abend und morgen Früh, ich bin dir Spinnefeind, Trennungen wie beo-bachten und konst-ruieren, ich will Blumen sprechenlassen, Spagetti, wohl bekannt (für wohlbekannt), wieder sehen (für wiedersehen), gräulich (für greulich)...
Unfug ist ein schwacher Ausdruck dafür, dass Wörter nicht mehr so geschrieben werden, wie sie gemeint sind. «Vereinfachung durch Systematisierung» lautete das Zauberwort, aber das eigentliche Zauberwort war das Wort Reform, denn wer es hört, ist sogleich bezaubert und kann sich nicht mehr wehren. In gleichem Sinne zaubermächtig war die Einführung der Unterscheidung von «alter» und «neuer» Rechtschreibung, denn wer bleibt beim Alten, wenn es das Neue gibt? «Sie wohnen, meine Dame, in einem reichlich alten Haus», sagte die Immobilienmaklerin nach liebenswürdigem Türklingeln, «heute wohnt man in neuen.» Wer wagt es da noch, nach scheinbar alten Regeln im allgemeinen zu schreiben und gestern nacht, obwohl die scheinbar neuen Schreibweisen im Allgemeinen und gestern Nacht aus dem tiefen neunzehnten Jahrhundert stammen? Wo Propaganda das Sagen hat, hat es die Wirklichkeit schwer.
Schrift als Sprache des Abwesenden
Halt, es scheint mir, dass mein Märchen müde macht und dass die Hörer schon schläfrig mit den Augen zwinkern. Flugs stelle ich ein aufweckendes Rätsel: Was bedeuten die Sätze Wir fahren Gut? Ich hoffe, Sie können wieder sehen, wenn wir uns wiedersehen? Der erste ist der wirksame Werbespruch eines Transportunternehmens, den zweiten gab einst Kurt Reumann, Redaktor der FAZ, dem Kultusminister Hans Zehetmair mit auf den Weg, als er ihn zur Rechtschreibreform befragte. Beide Sätze spielen mit Bedeutungen, und wer sie versteht, fühlt, warum wir Wörter gross oder zusammen schreiben. «Schrift», schrieb Sigmund Freud im Aufsatz «Das Unbehagen in der Kultur», «ist ursprünglich die Sprache des Abwesenden», und es kommt alles darauf an, dass der anwesende Leser klar und deutlich und ohne Verunsicherung aufnehmen kann, was der abwesende Schreiber ihm mitteilen will. Es sind gerade diese Königreiche des Schreibens, die Bereiche des Grossbuchstabens und des Zusammenschreibens, in denen die Kultusminister mit groben Pfoten alte Gleichgewichte störten und Ausdrucksmittel vernichteten. Sie haben sich an der deutschen Sprache vergriffen.
Aber ich merke, dass mir das Märchen nicht gelingen will. Hilft es, wenn ich eine Hexe aufbiete? Schon steht sie da, die Reformhexe, in ein gräuliches Schlottergewand mehr eingeschlagen als gekleidet und mit einem dudengelben Kopftuch tief in der Stirn. Der Aphoristiker Lichtenberg schrieb vor über zweihundert Jahren: «Es tun mir viele Sachen weh, die andern nur leid tun.» Die Hexe spuckte auf den Satz und kratzte ihn folgendermassen in ihr Hexen-Regelbuch: «Es tun mir viele Sachen weh, die andern nur Leid tun.» Als sie das grosse Leid schrieb, drückte sie die Feder, dass die schwarze Tinte spritzte, und lachte, weil dieser Grossbuchstabe so herrlich sinnlos war. Lacht sie heute noch, die Unholdin, nach siebenmal sieben Versuchen, die Schäden der Reform loszuwerden? Tatsächlich muss sie heute «Es tut mir leid» wieder richtig schreiben, aber das Reformbuch der verballhornten oder unverständlichen Sätze ist noch längst nicht abgearbeitet. Da die Hexe Bildung schätzt, liest sie die NZZ, und einen Satz aus einer Buchbesprechung, der in der NZZ natürlich richtig stand, verunstaltet sie heute im Sinne der Reform so: «Hilde Domin hat Recht und gut daran getan, eine erneute Zwischenbilanz der deutschsprachigen Nachkriegslyrik zu ziehen.» Als der Gymnasiallehrer Konrad Duden (1829–1911) die Rechtschreibung seiner Zeit sichtete und im Jahre 1880 in einem «Vollständigen Orthographischen Wörterbuch der deutschen Sprache » zusammenstellte, war es ihm ein Anliegen, dass Gleiches gleich behandelt wird, dass z.B. Adverbien gleichmässig klein geschrieben
werden. Diesem Anliegen wurde die wirklich neue
Rechtschreibung, die Rechtschreibung des zwanzigsten Jahrhunderts, gerecht; mit Beginn der Reform im Jahre 1996 aber traten die deutschen Kultusminister diesen und andere Grundsätze über den Haufen. Und damit, du Hexe, du schlechte Dienerin schlechter Herrinnen und Herren, ab mit dir ins Gestrüpp des Waldes, wo du in deiner struppigen Verworrenheit hingehörst.
Am guten Ende eines Märchens wählt die kluge Prinzessin den Prinzen, und der vermeintlich tölpische dritte Sohn erfüllt die gestellte Aufgabe, weil er ein offenes Herz hat. Die Aufgabe lautet: Schreibe ohne Fehler glasperlenspiellesend! Die Lösung: Das Wort wird genau so geschrieben, wie Hermann Hesse es bildete. Als ihm der Zürcher Autor Rudolf Jakob Humm von einem Coiffeur berichtete, der sich für drei Franken monatlich von einem Buchhändler Bücher zum Lesen ausleihe und auch den Roman «Das Glasperlenspiel» gelesen habe, da freute sich Hesse über die «Erzählung von dem glasperlenspiellesenden Coiffeur»; das überlange Adjektiv macht mit einem kleinen Wortwitz das, was der Haareschneider tut, zu seiner stehenden Eigenschaft. Spaltet man es, im Geiste der Reform, nüchtern zu Glasperlenspiel lesend auf, geht dieser Sinn verloren. Wann verbuchen die Wörterbücher die Wörter wieder so, wie sie gebildet und verwendet werden, und schreiben sie so, dass man sie ohne Verunsicherung liest? Dann hätte das Märchen ein gutes Ende.
Was Praktiker und Sprachwissenschafter empfehlen
Viel ist dazu nicht nötig. Man verzichte auf Regeln, welche vielleicht einfach sind, aber die Sprachwirklichkeit verfehlen. Jacob Grimm sagte: «Diese Sprachkünstler scheinen nicht zu fühlen, dass es kaum eine Regel gibt, die sich steif überall durchführen lässt; jedes Wort hat seine Geschichte und lebt sein eigenes Leben.» So denkt auch die Schweizer Orthographische Konferenz (SOK), gegründet von Praktikern und Sprachwissenschaftern, um eine einheitliche und sprachrichtige Rechtschreibung wiederherzustellen. Die SOK-Empfehlungen finden immer mehr Anwender. Der Reclam-Verlag, der der Rechtschreibreform «kritisch-konstruktiv» gegenübersteht, orientiert sich seit längerem an ihnen.
Ist das Unternehmen SOK ein Zeichen schweizerischer Naivität? Ist es naiv zu glauben, dass sich der Staat von einem Zusammenschluss sachkundiger Bürgerinnen und Bürger auf die Sprünge helfen lässt? Nein. Es ist im Gegenteil naiv zu glauben, dass die staatlich verordneten Rechtschreibfehler Bestand haben können. Und dass der Bürger Verantwortung übernimmt, Fehler anpackt und nicht alles duldet, das ist das Wesen der Demokratie.
Als im Jahre 1837 der König von Hannover die Verfassung aufhob, verweigerten ihm Wilhelm und Jacob Grimm zusammen mit fünf Kollegen der Universität Göttingen den Gehorsam und steckten Entlassung und Verbannung ein. Heute geht es um unsere Sprache. Unsere?
Es wird noch anderswo als nur in Deutschland Deutsch gesprochen, gelesen und geschrieben, und wer, wenn er die deutsche Sprache hört, gleich eine Landesfahne hissen möchte, muss zuerst überlegen, welche. Die Sprache hält sich an keine Grenze und auch nicht an andere politische Vorgaben. Die Tatsachen, vor die die deutschen Kultusminister uns gestellt haben, sind nicht vollendet. Das Schlusswort, gerichtet an alle Gutmeinenden deutscher Sprache, habe Jeremias Gotthelf, auch einer der Schweizer vom kindlichen Kehllaut: «Dank heygit und tüet nüt zürne!» Das heisst in der deutschen Mutter-, Haupt- und Heldensprache: «So habet denn Dank und arbeitet mit der SOK zusammen!»
Stefan Stirnemann ist Philologe. Er ist Mitarbeiter am Thesaurus linguae Latinae (München), Mitglied der Arbeitsgruppe der Schweizer Orthographischen Konferenz (SOK) und Lateinlehrer an der Bündner Kantonsschule in Chur.