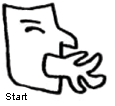


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Nachrichten rund um die Rechtschreibreform
Zur vorherigen / nächsten Nachricht
Zu den Kommentaren zu dieser Nachricht | einen Kommentar dazu schreiben
09.12.2005
„Die kulturelle Wirklichkeit fortbestehender paralleler Schreibweisen“
Zwei Juristen zur Rechtschreibreform
In zwei Beiträgen bilanziert das führende Fachorgan Neue Juristische Wochenschrift (49/2005) die Rechtsprechung zur Rechtschreibreform.
Dr. Wolfgang Kopke, Arbeitsrichter und Autor der Arbeit Rechtschreibreform und Verfassungsrecht (1995), kommentiert die jüngsten Beschlüsse des OVG Lüneburg. Er ergreift die Gelegenheit, »die dürftige Argumentation«, welche dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1998 zugrunde lag, noch einmal zu resümieren. Mit Blick auf die auffällige Eile, mit der die Karlsruher Richter seinerzeit eine eigene Entscheidung verkündeten, urteilt Kopke, es sei ihnen ersichtlich »nicht um unbefangene Rechtsfindung« gegangen, sondern darum, »der KMK beizuspringen«:
»Während das BVerfG ansonsten nicht müde wird, unter Hinweis auf seine Überlastung die Rechtsuchenden aufzufordern, zuerst die Fachgerichtsbarkeit zu bemühen, hatte man es hier ganz eilig, dem BVerwG zuvorzukommen. Denn hätte dieses in Fortsetzung seiner bisherigen Schulrechtsprechung das wohlbegründete Urteil des VG Berlin bestätigt, wäre die Reform erledigt gewesen, da die Senatsverwaltung hiergegen nicht vor das BVerfG hätte ziehen können und die Verfassungsbeschwerde dann schon vor einer mündlichen Verhandlung des BVerfG zurückgenommen worden wäre.«
Unabhängig von diesen Vorgängen habe das Karlsruher Urteil »nur eine begrenzte Reichweite«. Die Lüneburger Richter hätten richtig erkannt, daß ihm »keine Bindungswirkung hinsichtlich der Auslegung von Landesrecht zukommt«. Außerdem beruhe das Urteil von 1998 auf Annahmen, »die zwischenzeitlich widerlegt sind, nämlich den jeweiligen Prognosen der Kultusminister, die Reform erleichtere den Rechtschreibunterricht und werde sich auch außerhalb der Schule allgemein durchsetzen«. Die Akzeptanz der Reform sei weiterhin zweifelhaft, wie Repräsentativumfragen ebenso wie der fortwährende Widerstand namhafter Schriftsteller und bedeutender Pressehäuser zeigten. Kopke verweist zudem auf die Zwangsmittel, mit denen seit 1998 die Verwendung der amtlichen Schreibung vorangetrieben wurde: »[W]o die neue Schreibung verwendet wird, ist dies häufig auf eine Lektoratsentscheidung zurückzuführen, welcher sich der Autor (so auch hier) beugen muss«.
Von politischer Seite gehe es inzwischen »offensichtlich nur noch darum, aus falsch verstandener Staatsraison das Eingeständnis eines Fehlers zu vermeiden«. Von den Kultusministern werde kaum mehr zur Sache argumentiert, sondern nur darauf abgehoben, daß ein Aufgeben der Reform »untragbare Kosten verursache und den Schülern nicht zuzumuten sei«. Eine fortgesetzte »Verunsicherung« sei aber auch mit den Revisionsbemühungen verbunden, die von der Zwischenstaatlichen Kommission begonnen wurden und gegenwärtig vom Rat für deutsche Rechtschreibung fortgesetzt werden.
Das Lüneburger Gericht habe zwar »einen Anspruch der Schüler bejaht, (auch) in der herkömmlichen Schreibung unterwiesen zu werden«, andererseits aber keinen »vollstreckbare[n] Titel geschaffen«, indem es einen Antrag der Klägerin auf einstweilige Anordnung abwies. Dennoch, so Kopke, sei das Land Niedersachsen »gehalten, den vom höchsten für die Auslegung des Schulgesetzes zuständigen Gericht festgestellten Anspruch der Schülerin zu erfüllen«. Dies auch im eigenen Interesse, da es andernfalls »zu unnötigen weiteren und (zumindest im Hauptsacheverfahren) für das Land kostenträchtigen Klagen« kommen könne. In jedem Fall seien die Länder »dauerhaft verpflichtet, beide Schreibweisen zu lehren«, wenn auch die herkömmliche weiterhin außerhalb der Schulen üblich bleibe. Für den Fall einer Rücknahme der Reform gelte weiterhin der Leitsatz eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes vom 20. 7. 1999: »Es besteht kein Anspruch auf Unterrichtung nach den Regeln der Rechtschreibreform« (NJW 1999, 3477).
Dr. Klaus Ferdinand Gärditz, Assistent an der Universität Bayreuth, zieht eine Bilanz nach »Zehn Jahren Rechtschreibreform«. Er erinnert an den Beschluß der KMK zur Durchführung der Reform vom 1. 12. 1995, welcher der Wiener Absichtserklärung vom 1. 7. 1996 voranging.
Gärditz wagt einen Ausflug in die Geschichte der Rechtschreibnormierung und kommt dabei zu dem Schluß, die Rechtschreibung sei im Unterschied zur gesprochenen Sprache »zu einem maßgeblichen Teil Derivat des schulisch vermittelten Bildungsauftrags des Staates«. »Bereits die vom preußischen Kultusministerium einberufene I. Orthographische Konferenz in Berlin 1876 und ihre Folgekonferenzen [!]« hätten »das Ziel einer einheitlichen Schulorthografie« verfolgt. (Für diesen Teil seiner Ausführungen gibt Gärditz keine Quellen an.)
Gärditz stellt fest, daß die von der Reform und ihrer sanktionsbewehrten Einführung betroffenen Schüler durchaus in ihren Grundrechten berührt seien: »Die Schreibfreiheit ist ein Ausdruck der auch sprachgeprägten Persönlichkeit des Schreibenden und wird daher dem Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts [...] zugeordnet.« Zugleich werde »mittelbar-faktisch« auch in das grundgesetzlich geschützte Erziehungsrecht der Eltern eingegriffen.
Hingegen verneint Gärditz einen aus der sog. Wesentlichkeitstheorie abgeleiteten Gesetzesvorbehalt. Die Reform gehöre in den »Bereich »technischer« Fragen der Lehrplangestaltung und wertfreier Wissensvermittlung«. Ihre »objektiv geringe Intensität« spreche »gegen eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung von verfassungsrechtlicher Relevanz«. Der Wortlaut des 1998 per Volksentscheid erwirkten Zusatzes zum schleswig-holsteinschen Schulgesetz ist Gärditz offenbar unbekannt, da er argumentiert, ein »fiktives »Rechtschreibgesetz«« würde den »eher befremdlichen Eindruck erwecken [...], Rechtschreibfehler seien nunmehr mit dem Makel der Gesetzeswidrigkeit behaftet«. »Die Pflege der Rechtschreibung durch die Exekutive« sei daher »Ausdruck rationaler Entscheidungszuordnung«.
Gärditz konzediert dennoch, daß »Sprache etwas Lebendiges« sei, das nicht beliebig dem staatlichen Zugriff unterliege: »Sprachformung [!] bedarf als gesellschaftlich-kulturelles Phänomen auch eines Mindestmaßes [!] an Akzeptanz in der Bevölkerung.« Daß die herkömmliche Rechtschreibung voraussichtlich »zumindest für längere Zeit als bedeutendes kulturelles Phänomen erhalten bleiben« werde, bedeute für die Schule, daß sie sich der herrschenden »orthografischen Pluralität nicht vollständig entziehen« könne. In diesem Sinne deckt sich sein Résumé mit den Forderungen Kopkes:
»Es besteht ein Anspruch auf eine schulische Ausbildung, deren Inhalte nicht in einer bloßen Selbstbeschreibung verharren oder auf die »Amtlichkeit« des vermittelten Wissens verweisen, sondern im Interesse eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Freiheit gerade diese gesellschaftlichen und kulturellen Kompetenzen vermitteln. [...] Auf das Phänomen Rechtschreibung bezogen bedeutet dies, dass sich das staatliche Schulwesen nicht auf eine reine Unterrichtung der neuen Schreibregeln zurückziehen darf, sondern zugleich flankierend auf die kulturelle Wirklichkeit fortbestehender paralleler Schreibweisen angemessen hinweisen muss.«
| Kommentare zu »„Die kulturelle Wirklichkeit fortbestehender paralleler Schreibweisen“« |
| Kommentar schreiben | neueste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Reinhard Markner, verfaßt am 09.12.2005 um 10.00 Uhr |
| Gärditz betet zum Teil ziemlich unkritisch das Urteil von 1998 nach. Aber gerade das macht seine Schlußfolgerung besonders wertvoll. Aus seiner Prämisse, daß staatliche »Sprachformung« eines »Mindestmaßes an Akzeptanz in der Bevölkerung« bedürfe, ließe sich ja auch ableiten, daß die Reform nicht zu beanstanden sei, da sie (nach Auffassung ihrer Urheber) die Sprache selbst unberührt lasse und ihre Vorgaben auch außerhalb der staatlichen Sphäre mittlerweile in beachtlichem Maße befolgt würden. Im Gegenteil dringt aber Gärditz zur gleichen Einschätzung der Lage vor wie Kopke und die Lüneburger Richter. |
Kommentar von Heinz Erich Stiene, verfaßt am 09.12.2005 um 12.12 Uhr |
| Erinnert sei in diesem Zusammenhang an das Interview, das der ehemalige Bundesverfassungsrichter Mahrenholz vor einigen Monaten der Welt gegeben hat. Er ging davon aus, daß das Urteil von 1998 mit seiner Beteiligung so nicht ergangen wäre. Die Sache stinkt zum Himmel. There must have been something rotten in the city of Karlsruhe. |
Kommentar von Kai Lindner, verfaßt am 09.12.2005 um 14.38 Uhr |
| Ich frage mich, ob man nicht noch einen zweiten Klageversuch wagen sollte... diesmal jedoch mit Hilfe einiger pensionierter Verfassungsrichter, die genau wissen, worauf man bei einer solchen Klage achten muß. Das Problem ist doch immer, daß man als Privatperson mit einem (vielleicht überforderten Anwalt) gegen die ganze staatliche Bürokratie (= unzählige erfahrene Juristen) steht. Und vor dem Verfassungsgericht besteht man schließlich nur, wenn man seine Klage optimal und auf den Punkt formuliert. Seit der letzten Klage haben sich einige neue Aspekte der Rechtschreibreform aufgetan... insbesondere die Weisung für die Bundesbeamten steht doch gegen das bisherige Verfassungsurteil und die Freiheit der Bürger. Man hat heute – entgegen der offensichtlichen Meinung der Richter – nicht mehr die freie Wahl der Rechtschreibung. Wenn man im Ergebnis dazu kommt, daß in der Schule parallel auch die bewährte Rechtschreibung unterrichtet werden muß und daß die Beamten schreiben dürfen wie sie wollen, dann hätte man schon viel gewonnen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.12.2005 um 16.55 Uhr |
| Im Sommer 1998 wurde manches erzählt, was ich hier nur noch einmal in Erinnerung rufe, ohne mich dazu äußern zu wollen. Der neue Vorsitzende des Ersten Senats, Papier, solle ein enger Freund des bayerischen Kultusministers sein und diesem den Rücken freihalten wollen. Das Verfassungsgericht sei vorgeprescht und habe sogar nach dem Rückzug der Kläger geurteilt, um dem Bundesverwaltungsgericht zuvorzukommen, das eigentlich "dran" war und höchstwahrscheinlich anders geurteilt hätte, sich aber später nicht mehr traute. Alles geschah unter dem Termindruck, der durch das Datum des Inkrafttretens gesetzt war, das Urteil erging zwei Wochen vorher und damit gerade noch rechtzeitig. Erstaunt war ich, daß einer der beiden juristischen Gutachter ein Gutachten vorlegte, das sein Assistent ihm für das Verfahren Holstein gegen Land Berlin ausgearbeitet hatte und das nun fast identisch zum zweiten Mal Verwendung fand. (Ein juristischer Beteiligter klärte mich über die für meine Begriffe und Verhältnisse – C3, wie Ihr alle wißt – astronomischen Honorare auf, die Rechtsprofessoren für Gutachten und Vortrag bekommen.) |
Kommentar von Norbert Schäbler, verfaßt am 09.12.2005 um 21.37 Uhr |
| Tabu oder Nichttabu – das ist hier die Frage Im August 2004, als die Springerpresse auf die vorreformierte Schreibweise umstellte, tat Jutta Limbach – einst Richter am BverfG – in ihrer Ruhestandsfunktion (als gehobene Angestellte des Goethe-Instituts) folgenden Ausspruch: „Das ist Widerstand nach Ladenschluss!“ Es gibt also jenseits von Mahrenholz auch ehemalige Kollegen, die den damaligen Richterspruch – unabhängig von den nach Objektivierung drängenden Erkenntnissen – als unumstößliches Tabu verteidigen. |
Kommentar von nos, verfaßt am 09.12.2005 um 23.02 Uhr |
| Schelte an die „Engelmacher“ Rechtsprechung ist niemals etwas Heiliges. Auch Justitia kann sich irren; sonst brauchte man ja keine Kronzeugenregelung, Alibis, Tatmotive, Zeugen und Geständnisse. Wie aber sieht es im umgedrehten Falle aus? Kann derjenige, der als Richter evtl. einen Justizirrtum begangen haben könnte, das Rad der Geschichte zurückdrehen? Kann oder würde ein Richter seine Indizienkette hinterfragen, ohne daß ihn jemand dazu nötigt (wer könnte einen Richter nötigen?)? Oder gibt es so etwas, daß ein Richtergremium sein eigenes Urteil revidierte, oder daß einzelne jenes Gremiums zumindest von der sog. Einstimmigkeit abweichen könnten (ist ein Gremium nicht per se etwas Zusammengeschmiedetes?)? Ich formuliere einen völlig blauäugigen Gedanken, wissend, daß das BVerfG-Urteil vom 14. Juli 1998 einstimmig erging. Dem ersten Senat wohnten damals bei: Papier, Grimm, Kühling, Jaeger, Haas, Hömig, Steiner. Wie denken diese hochrangigen Juristen heute? Weilen sie überhaupt noch unter den Lebenden? Denken sie konform? Denken sie konträr? Denken sie so wie die Kultusminister, die fast unisono meinen: „Wir hätten die Rechtschreibreform nicht machen sollen“, jene Reform, die sie gleichwohl unisono ein- und durchführten? (Auch von den damaligen Kultusministern haben schon etliche ihr Amt quittieren müssen!) Und ich frage mich, wer diesen innerpersönlichen und innergesellschaftlichen Zwiespalt zwischen Denken und Tun denn jemals revidieren soll, wenn nicht diejenigen, die den Ruf der Heiligkeit und Unanfechtbarkeit genießen, aber oft nur „Engelmacher“ sind. |
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 09.12.2005 um 23.14 Uhr |
| Der von Herrn Lindner angeregte erneute Klageversuch klingt auf den ersten Blick einleuchtend, aber in der Realität dürfte das nicht so einfach sein. Zunächst stellt sich die Frage, wer denn klagen sollte oder könnte. Ich kann mir vorstellen, daß eine erneute Klage von Eltern Schwierigkeiten aufwerfen würde – schließlich ist das Lehren zweier Formen von Orthographie, wie sie Kopke und Gärditz vorschlagen, eine praktische Schwierigkeit und eine nicht unerhebliche Hürde für lernende Kinder. Es ist abzusehen, daß die Kultusministerien dieses Argument ins Feld führen werden, und ich persönlich glaube, daß das Richterkollegium dem folgen würde. Vielleicht sollte besser ein betroffener Verwaltungsbeamter klagen, aber auch dieser müßte zunächst einmal den gesamten Instanzenzug durchlaufen. Im Falle von Bundesbeamten dürfte dieser jedoch nur aus dem Bundesverwaltungsgericht bestehen. Fragt sich nur, ob sich unter den ohnehin schon unter enormem Druck stehenden Beamten des Bundes einer findet, der genügend Rückgrat und auch den notwendigen langen Atem finanzieller Art aufbringt, um ein solches Vefahren durchzustehen. Auch was die Einschaltung ehemaliger Verfassungsrichter angeht, erlaube ich mir, skeptisch zu sein. Unter Verfassungsrichtern, ja unter Richtern generell, existiert ein ebenso starker Corpsgeist, wie dies bei anderen Berufsgruppen der Fall ist. Man denke nur an das betretene Schweigen der deutschen Linguistik angesichts der RSR ... Vermutlich wäre der beste Weg über die Verwaltungs-, Oberverwaltungs- und notfalls auch Verfassungsgerichte der Länder. Wenn die RSR nur in zwei Bundesländern aufgrund der neuen Einsichten und des Lüneburger Urteils gerichtlich gekippt oder aufgeweicht werden kann, dürfte das Gebäude in sich zusammenbrechen. Rüttgers und Wulff werden nur darauf warten, vielleicht auch der bayerische Zauderer. In jedem Fall wäre es wohl notwendig, genügend kompetente und entschlossene Juristen zu finden, welche die Zerstörung ihres Handwerkszeuges nicht einfach hinzunehmen bereit sind. Diese müßten freilich eng mit Linguisten, Lehrern und Schriftstellern zusammenarbeiten. Vielleicht geben die neuen Veröffentlichungen von Kopke, Gärditz und Quambusch Anlaß zu einem gemeinsamen Symposium der genannten Expertengruppen, bei dem sich Strategien erarbeiten lassen. An juristisch relevanten Materialien herrscht ja mittlerweile, anders als 1998, kein Mangel, so etwa Herrn Icklers und Herrn Munskes kritische Veröffentlichungen, die vier Kommissionsberichte, die Tatsache, daß Literatur aus den Schulen verbannt wird, nur weil die Autoren sich dem Orthographiediktat nicht beugen wollen, die erheblichen fachlichen Mängel der Reform, die schlechtere Lesbarkeit reformierter Texte, die unausgewogene Zusammensetzung des Rates, die mittlerweile überdeutlichen Probleme der Umsetzung in den Schulen etc. Es müßte halt nur ein Anfang gemacht werden ... |
Kommentar von Norbert Schäbler, verfaßt am 10.12.2005 um 00.28 Uhr |
| So ist das eben! (Lehrsatz urdeutscher Pädagogik) Das Lehren von zweierlei Orthographien ist schultechnisch keine Schwierigkeit! Von 1996 bis 2000 habe ich das praktiziert, und jene Synopse (die Gegenüberstellung von zwei widerstreitenden Möglichkeiten) war eine absolut logische pädagogische Maßnahme – sie ist die freiheitlichste Form der Lehre, die es überhaupt gibt. Erst der Vergleich eröffnet doch dem nach Mündigkeit strebenden und für die Mündigkeit vorgesehenen Schüler die Möglichkeit, sich für das Sinnvollere, Bessere, Funktionellere, ... zu entscheiden. Dem steht entgegen, daß die politischen Machthaber in 14 deutschen Bundesländern keine andere Alternative dulden, als diejenige, die von ihnen ins Leben gerufen wurde. Seltsamerweise läßt diese Doktrin im Übergangszeitraum jegliche gesellschaftliche Akzeptanz vermissen. Dem steht andererseits von Seiten der Kritiker das Ideal der „einheitlichen Rechtschreibung“ entgegen; eine Forderung, die mehr und mehr inakzeptabel, veränderungshemmend und weltfremd zu werden scheint. Aber genau jenes Ideal deckt sich (doppelt paradox) mit der Forderung der politischen Machthaber, die eine Einheitlichkeit unbedingt anstreben, nachdem sie ebendiese Einheitlichkeit im Jahre 1996 (Option: 1998/vor nunmehr sieben Jahren) zerstört haben. Etwas klar machen (und das sollte klarsein), kann immer nur derjenige, der das Klärungsmonopol hat, wobei der nachfolgende Satz stellvertretend für dumpfdeutsche Staatspädagogik und -jurisprudenz steht: „So lange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, ...“. So ist das eben! |
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 10.12.2005 um 00.38 Uhr |
| Noch zwei Gedanken zu einem möglichen erneuten Prozeß vor dem Bundesverfassungsgericht: Zum einen wäre ein solcher geeignet, dem ganzen Thema wieder eine breitere Öffentlichkeit zu verschaffen. Die linguistischen Details dürften dabei für die Mehrheit weniger interessant sein als die fragwürdige Art und Weise der Durchsetzung im öffentlichen Leben. Die wohlwollende Begleitung durch zahlreiche Pressorgane, selbst SPIEGEL und SZ, kann man wohl voraussetzen. Zum anderen mögen es Richter, besonders Richter, nicht, beschwindelt und an der Nase herumgeführt zu werden. Da die Beklagten im Verfahren aus dem Jahr 1998 recht großzügig und kreativ mit der Wahrheit umgegangen sind, um es einmal vorsichtig auszudrücken, könnte dieser Aspekt, so es denn gelingt, ihn deutlich herauszuarbeiten, Hemmungen im Richterkollegium, eine frühere Entscheidung zu revidieren, überwiegen. So gesehen mag der Gang vor das BVerfG vielleicht doch keine schlechte Idee sein. |
Kommentar von kratzbaum, verfaßt am 11.12.2005 um 09.22 Uhr |
| Vom Guten des Schlechten Das BVerfG ist wegen seines Rechtschreiburteils mit guten Gründen viel gescholten worden. Gegenstand der Klage war ja, daß es zur Einführung der Reform in den Schulen eines förmlichen Gesetzes bedurft hätte. Dies hat das Gericht verneint. Viele haben das bedauert und kritisiert, vor allem mit dem Argument – das auch dasjenige der Kläger war – ein so bedeutender und tiefgreifender Eingriff in das Erziehungsrecht der Eltern müsse auf jeden Fall parlamentarisch diskutiert und dann demokratisch legitimiert werden. (Wesentlichkeitstheorie des BVerfG selbst bei anderer Gelegenheit.) Im Rückblick erweist sich das Urteil als Glücksfall, ja wahrer Segen. Man stelle sich vor, es gäbe tatsächlich ein "Rechtschreibgesetz". Erstens wäre es viel schwerer wieder wegzubekommen als eine bloße Verwaltungsvorschrift. Es müßte entweder vom Gesetzgeber selbst aufgehoben oder wiederum per Verfassungsklage zu Fall gebracht werden. Zweitens würde dem Bürger noch leichter als heute suggeriert werden können, er sei gesetzlich zur Anwendung der reformierten Orthographie verpflichtet. So aber ist die Materie der Verwaltungsgerichtsbarkeit zugewiesen. Dadurch ist sie aus den luftigen Höhen des Verfassungsrechts und der entrückten Denkwelt der Verfassungsrichter (man lese bloß die hanebüchenen Ergüsse über Sprache und Sprachvolk im Urteil) zurückgekehrt in die Lebenswirklichkeit, wie sie sich im Umgang zwischen Verwaltung und Bürger darstellt. Dies berechtigt zu einem vorsichtigen Optimismus. |
Kommentar von Kai Lindner, verfaßt am 11.12.2005 um 11.10 Uhr |
| Wirklich wichtig wäre jedoch ein Gesetz, das uns den Fortbestand der "alten" Rechtschreibung garantiert... Jede noch so kleine Sprachgruppe wird durch deutsche und europäische Gesetze geschützt. Nur die große Mehrheit... die muß sich dem Diktat einer wahnsinnigen Stümperbürokratie beugen. Ginge es hier um das Niederdeutsche oder das Sorbische oder sogar das Bairische, dann könnte man seine Ansprüche vor Gericht durchsetzen und würde damit problemlos jegliche Regelungsgewalt des Staates zurückschlagen... man stelle sich nur vor, die Bundesregierung wolle das Bairische neu ordnen, ein Aufschrei des Unverständnisses würde durch das Land gehen... So aber gehört man zur versklavten Bürgermehrheit und muß sich daher jeglichem Zwang des Staates (am besten noch kritiklos) unterwerfen. Das ist ungerecht... Und bevor mir jemand antwortet: Das ganze Leben ist ungerecht! (das weiß ich wohl, denn ich hab schließlich auch die Brautprinzessin gelesen ;-) |
Kommentar von Die Welt, verfaßt am 14.12.2005 um 09.54 Uhr |
| »Zu viele Ungereimtheiten Rechtschreibchaos geht weiter von Dankwart Guratzsch Was wird aus der Rechtschreibreform? Seit dem Regierungswechsel in Berlin und der Absetzung der Zwischenstaatlichen Rechtschreibkommission ist die Situation unübersichtlicher denn je. In der neuen Bundesregierung sitzen drei Reformbetreiber der ersten Stunde: Schäuble, Müntefering und Schavan. Aber in der Kultusministerkonferenz sind die Meinungen über die Reform inzwischen geteilt. Eine "Autorität" in Sachen neue Schreibweisen gibt es nicht mehr. Nach jüngsten Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg können Schüler sogar den "Anspruch" erheben, "in der herkömmlichen Schreibung unterwiesen zu werden". Andererseits hat das Gericht jedoch keinen "vollstreckbare[n] Titel geschaffen", so der Arbeitsrichter und Autor der Arbeit "Rechtschreibreform und Verfassungsrecht", Wolfgang Kopke. Und doch hat das Urteil für die "Verbindlichkeit" der neuen Regeln unübersehbare Relevanz. Denn unabhängig von einem "vollstreckbaren Titel", so Kopke, sei das Land Niedersachsen fortan "gehalten, den vom höchsten für die Auslegung des Schulgesetzes zuständigen Gericht festgestellten Anspruch der Schülerin zu erfüllen". Dies auch im eigenen Interesse, da es andernfalls "zu unnötigen weiteren und (zumindest im Hauptsacheverfahren) für das Land kostenträchtigen Klagen" kommen könne. In jedem Fall seien die Länder "dauerhaft verpflichtet, beide Schreibweisen zu lehren", solange auch die herkömmliche weiterhin außerhalb der Schulen üblich bleibe. Inzwischen ist der Rat für deutsche Rechtschreibung dabei, das gesamte Reformwerk einer Revision zu unterziehen. Als vorerst "letzten" Komplex hat er sich die Groß- und Kleinschreibung vorgenommen, die von den Kultusministern von 14 der 16 Bundesländer bereits für "unstrittig" erklärt worden war und an den Schulen dieser Länder seit Schuljahresbeginn "verbindlich" benotet wird. Bis Mitte Januar soll die vom Rechtschreibrat eingesetzte Arbeitsgruppe eine Beschlußvorlage mit folgenden vier Punkten erarbeiten: Schreibung des Anredepronomens "du", Schreibung fester Verbindungen aus Adjektiv und Substantiv (z.B. gelbe/Gelbe Karte), Schreibung von Einzelfällen zumal aus dem Überschneidungsbereich von Groß-Klein- und Getrennt-Zusammen-Schreibung (Pleite gehen, Recht haben) sowie Schreibungen im Randbereich (z.B. auf allen vieren (gehen). Das Durcheinander scheint der vorsichtigen Vorgehensweise recht zu geben, derer sich die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen sowie der schweizerische Kanton Bern befleißigt haben. Sie wollen die neue Rechtschreibung an den Schulen erst "verbindlich" einführen, wenn der Rechtschreibrat seine Arbeit abgeschlossen hat.« ( Die Welt, 14.12.05 ) |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 23.01.2007 um 15.50 Uhr |
| Die Begründung "wegen der Staatsraison" ist durch den "Fall Kurnaz" jetzt endgültig zum Synonym für "unmenschlich" und "menschenrechtswidrig" geworden. Es ist zu hoffen, daß kein Politiker sich mehr trauen wird, dieses (Un-)Wort zu verwenden. |
| Als Schutz gegen automatisch erzeugte Einträge ist die Kommentareingabe auf dieser Seite nicht möglich. Gehen Sie bitte statt dessen auf folgende Seite: |
| www.sprachforschung.org/index.php?show=newsC&id=366#kommentareingabe |
| Kopieren Sie dazu bitte diese Angabe in das Adressenfeld Ihres Browsers. (Daß Sie diese Adresse von Hand kopieren müssen, ist ein wichtiger Teil des Spamschutzes.) |
| Statt dessen können Sie auch hier klicken und die Angabe bei „news“ von Hand im Adressenfeld ändern. |
