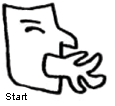


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Nachrichten rund um die Rechtschreibreform
Zur vorherigen / nächsten Nachricht
Zu den Kommentaren zu dieser Nachricht | einen Kommentar dazu schreiben
24.02.2005
Hans Krieger
Die Kompromiß-Falle
Hartmut von Hentigs Widerspruch
Hartmut von Hentig, der große Lehrer aufgeklärten pädagogischen Denkens, hat im Wallstein Verlag »14 Punkte zur Beendigung des Rechtschreib-Kriegs« veröffentlicht.
Die kleine Schrift (44 Seiten) enthält kluge Bemerkungen zu Sinn und Zweck der Rechtschreibung (Hilfe zum genauen Verstehen) und zu ihrer Behandlung in der Schule (Problemverständnis statt Regeldrill), bleibt bei ihrem eigentlichen Thema aber, der »Beendigung des Rechtschreib-Kriegs«, merkwürdig widersprüchlich und inkonsequent.
Hentig setzt auf einen Kompromiß. Diesen Kompromiß bereits inhaltlich genauer zu umreißen, erklärt er in der »Coda« für nicht zweckdienlich, da er von den »Streitenden und Betroffenen« ausgehandelt und »aus Einsicht befolgt« werden müsse; außerdem habe ja die Einführung der Reform gezeigt, daß »die Tauglichkeit der Regeln erst bei ihrer Anwendung im Einzelfall erkennbar« werde. Das hindert ihn aber nicht daran, den Kompromißvorschlag der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung so zu präsentieren, als sei er bereits die brauchbare Grundlage für einen Friedensschluß, und in diesem Sinne wird die Intention des Buches auch im Klappentext resümiert. Daß der Akademievorschlag von der Neuregelung nicht nur übernehmen will, »was sinnvoll, sondern auch, was ohne nennenswerten Schaden hinnehmbar ist« (also auch, was zwar Schaden anrichtet, aber keinen »nennenswerten«), wird in einer Weise zitiert, die nur als zustimmend empfunden werden kann. Hentig geht davon aus, daß das »Sinnvolle« und das »Hinnehmbare« zusammen etwa 95 Prozent der Reformschreibungen ausmachen (nach der Häufigkeit des Vorkommens gerechnet) und fügt hinzu: »Über den Rest – ›das was nicht akzeptiert werden kann‹ – muß man verhandeln.«
Ein sehr eigenartiges Verständnis von Kompromißbildung tritt da zutage: man verhandelt nicht – in der Erwartung, daß beide Seiten Zugeständnisse machen – über das Gesamtpaket, sondern die eine Seite schluckt als Vorleistung schon einmal die allermeisten Kröten und erklärt den Rest des schlechterdings Nichtakzeptablen nicht etwa für schlechterdings nicht akzeptabel, sondern will darüber verhandeln, nachdem sie allerhand Schädliches, aber eben nicht »nennenswert« Schädliches ohne Verhandlungen abgesegnet hat.
Nicht denkbar ist laut Hentig ein Kompromiß, »wo zwei einander widerstreitende Prinzipien ins Feld geführt werden«: auf der einen Seite das von den Reformern verfolgte Prinzip strikt formalistischer Regelkriterien, die ohne Bedeutungsverständnis sozusagen mechanisch befolgt werden können, auf der anderen Seite das von den Reformkritikern und nach Hentigs Meinung auch von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung hochgehaltene Prinzip, den inneren Gesetzlichkeiten und den Entwicklungstendenzen der Sprache zu folgen, also nicht »präskriptiv«, sondern »deskriptiv« vorzugehen. Hentigs Formulierung läßt ein wenig in der Schwebe, ob ein Kompromiß an der tatsächlichen Unvereinbarkeit der beiden Prinzipien scheitert oder nur an der Art, wie sie »ins Feld geführt werden«. Er muß aber wohl letzteres meinen, denn sonst wäre er zu der Schlußfolgerung gezwungen, daß eine Kompromißlösung aus sachlichen Gründen unmöglich ist – außer in solchen Regelungen, die lediglich Äußerlichkeiten des Schriftbildes betreffen und die Sprache selber nicht berühren. Das hieße: allenfalls die ss/ß-Regelung und die Dreifachkonsonanten können von Reformgegnern als Preis für die Rücknahme aller übrigen Reformteile hingenommen werden.
Die beiden Prinzipien sind aber nicht nur in der Tat unvereinbar; sie unterscheiden sich auch im Grad der Rücksichtnahme auf die Natur der Sprache so stark, daß es einem Sprachkundigen kaum möglich sein kann, beiden die gleiche theoretische Dignität zuzuerkennen, und Hentig selbst liefert dafür mehrmals schöne Belege. Er hat aber nicht erkannt, spricht es zumindest nicht aus, daß die Darmstädter Akademie eben eine Vermengung der beiden Prinzipien versucht hat, und er hat jedenfalls nicht erkannt, daß eben darum dieser Kompromißvorschlag so inkonsequent und widersprüchlich, also unbrauchbar ausgefallen ist und dazu nötigt, Schaden an der Sprache, wenn auch einen angeblich nicht »nennenswerten« hinzunehmen.
Er übersieht auch im Detail viele Widersprüche. Er begrüßt die etymologisierende Schreibung »behände« statt des seit Jahrhunderten üblichen »behende«, weil man die Beziehung zu »Hand« nicht nur kenntlich machen könne, sondern »sollte«, obwohl es doch (ohnehin ein Wort eher für Gebildete) häufig in einem Zusammenhang gebraucht wird, in dem der Gedanke an Hände nur störend wirken kann. Er sieht offenbar nicht, daß dies ebenso ein »archaisierendes Konstrukt« ist wie »Leid tun«, zwar ohne grammatische Implikationen, dafür mit psychomanipulativen: dem Leser wird diktiert, woran er beim Erblicken des Wortes zusätzlich zur eigentlichen Wortbedeutung zu denken hat. Dem »präskriptiven« Prinzip redet Hentig hier entschiedener das Wort, als seine Sympathie für das »deskriptive« erlauben sollte.
Nicht hinreichend geklärt ist die Rolle, die dem Staat in Rechtschreib-Fragen zukommt. Auf den ersten Seiten erscheint es als selbstverständlich, daß der Staat Regelungen zu treffen hat. Auf Seite 23 heißt es, der aktuelle Streit um die Rechtschreibung sei »nur durch einen Machtakt der Politik« zu entscheiden, freilich mit der Linguistik »als Schiedsrichter«. Auf Seite 35 kommt dann endlich eine Klarstellung, die vieles zuvor Gesagte annulliert: »Die Kultusminister dürfen über die richtige Schreibung der deutschen Sprache so wenig bestimmen wie über die Richtigkeit der Mathematik oder die Entwicklung des Klimas.« Sie können lediglich regeln, wann, wie und in welchem Umfang Rechtschreibung gelehrt und wie ihre Beherrschung bewertet wird. Das könnten die Kernsätze eines ganz anderen Buches sein. Denn aus ihnen folgt zwingend, daß die Rechtschreibreform nicht nur sachlich verfehlt war (das ergäbe sich schon aus Hentigs Definition der Aufgabe der Rechtschreibung), sondern auch widerrechtlich – trotz des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Juli 1998, das Hentig zitiert, ohne es zu problematisieren.
Dieses andere Buch hat Hentig nicht schreiben können, weil er sich als Friedensherold zu Äquidistanz nach beiden Seiten verpflichtet fühlte. Die von dieser Äquidistanz geforderte political correctness bringt es mit sich, daß man in Hentigs Augen schon zu den »Rechthabern, Radikalisierern, Raufbolden« gehört, wenn man die Rechtschreibreform eine »Zwangsreform« oder gar eine »nationale Katastrophe« nennt.
Man kann schon manches lernen aus diesem Büchlein. Aber ein Beitrag zur Problemlösung ist es leider nicht.
Hartmut von Hentig
14 Punkte zur Beendigung des Rechtschreib-Kriegs
Parva Charta für den bleibenden Regelungsauftrag
42 Seiten, engl. brosch., Format: 12,5 x 21
Eur (D) 12,- / Eur (A) 12,40 / sFr 22,10
ISBN 3-89244-902-302 / 2005
| Kommentare zu »Die Kompromiß-Falle« |
| Kommentar schreiben | neueste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.02.2005 um 18.30 Uhr |
| Randbemerkungen zu Hartmut von Hentigs neuer Schrift Hartmut von Hentig gehört der Rechtschreibkommission der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung an. Zwei andere Mitglieder, Harald Weinrich und Peter Eisenberg, haben ebenfalls schon eigene Stellungnahmen abgegeben, der eine zehn Maximen, der andere den mehrfach abgeänderten Kompromißvorschlag. v. Hentigs Schrift ist Peter Eisenberg gewidmet und stellt einen weiteren Versuch dar, die Rechtschreibreform durch Reparatur zu retten. Wie Eisenberg strebt v. H. eine zweitbeste Lösung (vom Platoniker zum „deuteros plous“ geadelt, S. 24) an, übernimmt dessen Kompromißvorschlag aber nicht zur Gänze. Seine eigene, kaum begründete Auswahl von Zustimmung, Ablehnung und Duldung stellt er am Ende ausdrücklich unter den „Vorbehalt linguistischer Argumente, die der Autor dieses Textes nicht kennt oder übersehen hat.“ Das Heft ist selbst in einer eigentümlichen Mischorthographie geschrieben (Heysesche s-Schreibung, aufwändig, großschreiben, aber auseinandernehmen, gleichlautend, letztere, mei-stens, Mini-ster usw., verlorengegangen neben verloren gegangen). Der Untertitel verrät bereits, daß v. H. den staatlichen Anspruch auf Normierung der Schriftsprache grundsätzlich anerkennt. Eine Art Begründung liest man auf S. 9: „In unseren Bildungsanstalten sind alle 'Gegenstände' (und die meisten Verfahren) behördlich, manche sogar gesetzlich verordnet: Was über Politik und Moral, Religion und Sexualkunde, Geschichte und Kunst gelehrt wird, haben die staatlichen Instanzen zu bestimmen – da sollte die Rechtschreibung ausgenommen sein?!“ Aber die Gegenstände der genannten Fächer: die Religionen, die Tatsachen der Fortpflanzung usw., sind vorgegeben und werden nicht vom Staat gestaltet, im Unterschied zur Schriftsprache. Daß die allgemein übliche Schreibweise im Unterricht vermittelt werden soll, kann ja nicht gemeint sein, denn das hat niemand je bestritten. „Im Jahre 1993 hat die Konferenz der Kultusminister Deutscher Länder gemeinsam mit den entsprechenden österreichischen und Schweizer Behörden eine Reform initiiert.“ (S. 7) Worauf soll sich das beziehen (abgesehen von der seltsamen Bezeichnung der KMK)? „(...) die preußische Schulorthographie von 1862, die in ganz Deutschland durchzusetzen dem preußischen Kultusminister Falk im Jahre 1876 auf der ersten Rechtschreibkonferenz nicht gelungen war (...)“ Es war nicht die Aufgabe dieser Konferenz, die preußische Orthographie durchzusetzen. v. Hentig sieht drei Motive einer Neuregelung wirksam werden: das Aufkommen der elektronischen Textverarbeitung, die deutsche Wiedervereinigung und die zunehmende Schwierigkeit des Erlernens der deutschen Rechtschreibung. Daran stimmt fast nichts. Die elektronischen Medien und die Wiedervereinigung haben bei der Reform keine Rolle gespielt. Bedeutung und Betonung sind nicht mit Rücksicht auf die Korrekturprogramme aus den reformierten Regeln herausgehalten worden, wie man nach den Ausführungen S. 10 annehmen könnte. v. H. berücksichtigt auch nicht, daß im Zuge der jüngsten Revision Bedeutung und Betonung als Kriterien wiedereingeführt worden sind. Seine Bemerkungen über die Unfähigkeit des Computers, Zeichenketten zu disambiguieren, bleiben hinter dem Stand der Technik zurück. Es ist sehr wohl möglich, den Kontext automatisch zu analysieren. Die Wiedervereinigung Deutschlands war kein Motiv der Reformer. Es ist nicht einmal gelungen, die wenigen Abweichungen der schweizerischen und österreichischen Schreibweisen von den deutschen völlig zu beseitigen; jüngst wurden sogar neue eingeführt (Spass, Mass). Und was die Schwierigkeiten betrifft, so hat zwar der Duden im Laufe des vorigen Jahrhunderts einige spitzfindige Einzelfestlegungen angehäuft, aber daraus hätte sich allenfalls die Mahnung an den Duden ableiten lassen, die Darstellung von solchen Haarspaltereien freizuhalten (wie der langjährige Dudenchef vor zehn Jahren selbst eingestand). Die fünfzig häufigsten Rechtschreibfehler bei Schülern, vor 20 Jahren von Wolfgang Menzel ermittelt, werden von der Reform bekanntlich gar nicht berührt. „Agenten des Wandels sind: Nachlässigkeit in der Aussprache (...), Abschleifung (...), Vergessen des Ursprungs (...)“ (S. 6) – Als „Agenten“ kann man solche Erscheinungen wohl kaum bezeichnen. Außerdem sind „Stengel statt Stängel, überschwenglich statt überschwänglich“ keine Beispiele für Nachlässigkeit in der Aussprache, denn die Aussprache unterscheidet sich hier gar nicht. lahmlegen und leertrinken sind auch keine Beispiele für Univerbierung, denn die Zusammenschreibung schafft keine neuen Wörter im morphologischen Sinn. „Die Getrenntschreibung Leid tun folgt nicht einem 'sich vollziehenden' Wandel, sondern versucht diesen rückgängig zu machen.“ (S. 7) – Wie v. H. jedoch auf S. 17 richtig feststellt, ist die herkömmliche Schreibweise leid tun. Die Neuschreibung behände begrüßt der Verfasser, weil „wir nach dem Stammprinzip den Bezug zur Hand sichtbar machen sollten“ (S. 23). Tausend Jahre lang hat man nicht so geschrieben, und es gab hier kein Rechtschreibproblem – schon gar nicht für heutige Schüler, die ja dieses Wort nie gebrauchen. Als der Bezug zur Hand noch gefühlt wurde, schrieb man nicht nach dem Stammprinzip, und als dieses sich durchsetzte, wurde der Zusammenhang nicht mehr gefühlt, wie zahllose Texte (behänden Schrittes usw.) beweisen. Stängel müßte Neutrum sein, wenn der Zusammenhang mit Stange noch lebendig wäre (wie es beim Dialektwort ja auch der Fall ist). Und wenn v. Hentig behende und Stengel ändern will – warum dann nicht auch z. B. Eltern, kentern, Spengler und hundert andere? Er lehnt volksetymologische Schreibungen wie Quäntchen oder Tollpatsch ab, obwohl diese weit besser belegt und angebahnt sind als behände und Stängel. Bei der Getrennt- und Zusammenschreibung bezeichnet er solche „archaisierenden Konstrukte“ ausdrücklich als verfehlt (S. 6). Hier scheint es um reine Geschmacksurteile zu gehen, die nicht mit allgemeiner Zustimmung rechnen können. Daß die ß/ss-Regelung der Reform „allgemein akzeptiert“ sei (S. 24), kann man wohl nicht behaupten; sie ist ja gerade der Geßlerhut für jeden, der nicht bekunden will, „daß er die Neuregelung nicht grundsätzlich bekämpft“ (wie es die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung treffend ausdrückte – um sich dann selbst zu dieser Fügsamkeit zu bekennen). Wertvoll ist der Hinweis, daß es keine wissenschaftlichen Untersuchungen zur Fehlerverminderung durch die Reform gibt: „Peter Eisenberg hat mit seinem Institut systematisch nach einschlägigen Untersuchungen gefahndet. Es gibt sie nicht.“ (S. 32) Die Übergangszeit bis 2005 wird vom Verfasser irrigerweise als „Probezeit“ bezeichnet. Die Reformer haben oft genug klargestellt, daß davon keine Rede sein könne, daß es vielmehr darum gehe, die Reform in dieser Zeit einzuführen und einheitlich durchzusetzen. Auf einem anderen Blatt steht, daß dies wegen der Fehlerhaftigkeit der neuen Regeln nicht gelingen konnte und es dann zu ganz anderen, nicht vorgesehenen Aktivitäten der Zwischenstaatlichen Kommission kam, schließlich zu deren Auflösung. Dem „Rat für deutsche Rechtschreibung“ gibt v. H. wohl mit Recht keine Chancen. Er sei zu groß, falsch besetzt, machtlos und ohne die erforderlichen Forschungsmittel. Punkt 6 lautet: „Die Rechtschreibung dient gleichermaßen dem Leser wie dem Schreiber. Dem Leser garantiert sie, dass er im Geschriebenen das erkennt, was der Schreiber mitteilen wollte; dem Schreiber garantiert sie, dass die Zeichen das enthalten und wiedergeben, was er sprachlich im Sinn hat, - und nicht etwas gleich- oder ähnlichlautendes anderes.“ (S. 13) Das ist nicht zweierlei, sondern dasselbe. Der Schreibende weiß ja, was er meint, das Problem der Mehrdeutigkeit stellt sich nur beim Lesen. Der Status der „Regeln“ wird nicht thematisiert. v. H. schreibt: „Dem Schreiber wird die aktive Kenntnis der Regeln abverlangt, dem Leser nur eine passive.“ (S. 13) Der Schreiber muß keine Regeln kennen, er muß nur wissen, wie geschrieben wird. Und Wiedererkennen ist leichter als Selbermachen. Die herkömmlichen Wortschreibungen sind nicht von Regeln abgeleitet. Daher sind auch die Zusammenschreibungen bei wehtun und kundtun kein „Produkt einer Ad-hoc-Ausnahmeregel“, wie v. H. meint (S. 17). Die „Regel“, mit der man solche orthographischen Tatsachen zu beschreiben versucht, könnte falsch sein – ein Verdacht, der bei „Ausnahmen“ immer naheliegt, wenn man das Verhältnis von Tatsache und Regel richtig auffaßt. Die Überschätzung der Regeln hat auch zur Folge, daß die ganze Abhandlung viele zu sehr auf Regeln konzentriert ist und über das Wörterverzeichnis nur wenig sagt. Es wird aber ohnehin nicht deutlich, wie sich v. H. die endgültige Fassung seiner orthographischen Vorschläge vorstellt. Am ehesten wohl in der Art, wie Eisenbergs sehr kritikwürdige Darstellung es versucht. Dieser hat allerdings die Ausformulierung des Wörterverzeichnisses Frau Wahrig-Burfeind überlassen, und sein Regelwerk paßt durchaus nicht dazu (vgl. meine Besprechung). Es finden sich zahlreiche rhapsodistische Einfälle, die eher ratlos machen: „Bei schwierigeren Fragen (zum Beispiel: Ist im Übrigen oder im Ganzen nicht ebenso wie infolge oder anstatt oder zuliebe eine adverbiale Bestimmung = ein Adverb, sobald man es anders schreibt?) könnte die Regel lauten: Prüfe, ob du/Du es so oder so empfindest/verstanden wissen willst.“ Man muß kein Sprachwissenschaftler sein, um solche Irrtümer zu vermeiden. Die Ausführungen zu Stückweit (S. 29) sind erläuterungsbedürftig, da es dieses Wort weder nach alter noch nach neuer Schreibweise gibt. Man kann nicht feilbieten und notlanden im selben Atemzug nennen; überhaupt ist die Redeweise von Zusammensetzungen gerade bei der Verbzusätzen noch unreflektierter als im Akademie-Kompromiß, den der Verfasser hier als so klar und verständlich preist (S. 27ff.). „Wenn die Geschäfts- und Reklamewelt uns Fotoapparate und Ketschup anpreist, werden Lehrer und Schüler nicht bei Photoapparat und Ketchup bleiben.“ (S. 21) Es waren die Reformer und nicht die Geschäftsleute, die Ketschup aufgebracht haben. „Getrenntschreibung gilt als Normalfall“ ist keine „neue Regel“ (S. 13), sondern galt schon immer. Im Schlußkapitel („Coda“) spricht der Verfasser sich für die Reformregel aus, die den „Fortfall eines nicht mehr wahrgenommenen Lautes: geschrien statt geschrieen“ fordert. Das ist unverständlich, denn man kann die Verbform zwei- oder dreisilbig sprechen, weshalb der Duden bisher fakultativ auch die Hinzufügung eines zweiten e verzeichnete. Leider hatte er es versäumt, dieselbe Möglichkeit auch für Pluralformen wie Kniee zu eröffnen (während man bei Seen eventuell von der Verdreifachung absehen könnte). Dasselbe gilt für das Verb knien, das man auch knieen sollte schreiben können und auch tatsächlich oft so geschrieben hat, entgegen der Dudenvorgabe. Diese Ausdrucksmöglichkeit noch rigider einzuschränken als der alte Duden ist Willkür und folgt keineswegs aus den 14 Punkten. v. Hentig gibt keine Antwort auf die Frage, was an der bisher üblichen Schreibweise (nicht an ihrer Darstellung im Duden) veränderungsbedürftig gewesen sein sollte. Er stellt diese naheliegende Frage nicht einmal. Am nächsten kommt er ihr noch unter Punkt 5: „Das Ziel einer Reform der Rechtschreibung muss es sein, diese 'stimmig' zu machen, das heißt: sie von tatsächlichen Widersprüchen, unnötigen Bestimmungen, abgestorbenen Schreibgewohnheiten (Noth, Thier, Beywort, Accusativ, ohngefähr) befreien und neue Erscheinungen aufnehmen und einordnen.“ Eine merkwürdige Darstellung. Abgestorbenes braucht man nicht zu beseitigen, es ist schon weg, und gerade die angeführten Schreibweisen verschwanden im 19. Jahrhundert sozusagen ganz von selbst. (Bei ungefähr < ohngefähr liegt zusätzlich eine motivierende Umdeutung zugrunde.) Im übrigen kann es unter den Tatsachen der üblichen Schreibweise keine „Widersprüche“ geben, nur unter den Regeln zu ihrer Beschreibung. Aber eben der Regelbegriff ist unklar, beginnt v. Hentig doch seine Abhandlung so: „Die Verbindung zwischen Laut und Schrift wird in einer Sprachgemeinschaft durch Gewohnheit – eine zu lernende Konvention – geregelt. Die Summe der aufeinander bezogenen Regeln nennt man Rechtschreibung.“ (S. 5) Hier kann „Regel“ nur als Synonym von „Gewohnheit“, also im Sinne einer impliziten Regel oder besser Regularität, also Regelhaftigkeit verstanden werden. Später scheint sich v. Hentig jedoch meist auf die explizite Regel, also die linguistische Beschreibung bzw. extern gesetzte Vorschrift zu beziehen, die etwas ganz anderes ist als das Konstrukt einer vom Sprecher geübten Gewohnheit. Diese Äquivokationen verunklaren die gesamte Diskussion. Die 14 Punkte sind eine Sammlung von Notizen zu diesen oder jenen Problemen, die im Zusammenhang mit der Rechtschreibreform aufgetreten sind. Man vermißt einerseits eine systematische Darstellung, andererseits die Sorgfalt im Detail. v. Hentig weiß das selbst: „Die Verführung, den denkbaren und/oder gewünschten Kompromiss an dieser Stelle darzustellen, ist groß; ihr nachzugeben widerspräche jedoch der Vorstellung, dass dieser von den Streitenden und Betroffenen ausgehandelt und aus Einsicht befolgt werden sollte.“ (S. 40) Gehört der Verfasser denn nicht zu den Streitenden und Betroffenen? Steht sein Versuch so hoch über allem Streit, daß er der „Versuchung“ zu einer diskutierbaren Gesamtdarstellung nicht „nachgeben“ kann und solche niedere Arbeit lieber einem Peter Eisenberg überläßt? Dann dürfte sein Text das Schicksal ähnlicher Einwürfe, auch und vor allem des Akademie-Kompromisses teilen: „nicht aufgenommen“ zu werden. Das Heft kann auch als weiterer Versuch verstanden werden, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, die ein orthographisches Alternativwerk mit Regeln und Wörterbuch angekündigt, aber nicht verwirklicht hat, bei den Kultusministern doch noch Gehör zu verschaffen. Aber warum sollten sich die Politiker mit einem derart unsystematischen und unvollständigen Entwurf, der vom Eisenbergschen schon wieder verschieden ist und an Sachkenntnis sogar hinter den Reform-Urhebern deutlich zurücksteht, ernsthaft beschäftigen? Das Unsystematische, Subjektive hat es schon bisher den Reformern leicht gemacht, solche Skizzen als buchstäblich nicht diskutierbar zurückzuweisen. |
Kommentar von Hans-Jürgen Martin, verfaßt am 26.02.2005 um 17.29 Uhr |
| Hentig hat in der Tat ein sehr eigen(artig)es Verständnis von "Kompromißbildung". In folgendem Gleichnis würde er sich wohl wiederfinden: Zwei Jungen streiten sich auf der Straße um eine Tafel Schokolade: Einer beansprucht die ganze Tafel, der andere ist bereit zu teilen. Ein Erwachsener hört den Streit und macht einen Kompromißvorschlag, der jeden der beiden zum Verzicht nötigt: Der Junge, der alles wollte, bekommt drei Viertel, der andere hingegen, der mit der Hälfte zufrieden war, ein Viertel. Allerdings: Hartmut von Hentig will nicht die Hälfte, ja nicht einmal ein Viertel … |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.06.2011 um 16.16 Uhr |
| Hentigs Lebenserinnerungen sind bei Hanser in einer gemischten Reformschreibung erschienen, mit vielen Fehlern: Ich war überzeugt, dass die anderen Schuld seien. aufwändige Spielsachen, die schnellkaputt gingen und manches andere. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.06.2011 um 17.10 Uhr |
| Übrigens: Hentig bezeichnet seine Mutter als "älteste Tochter von Ernst von Kügelgen, einem Urenkel des Malers Gerhard von Kügelgen, des Bruders von Wilhelm, der die berühmten 'Jugenderinnerungen eines alten Mannes' geschrieben hat." Der Maler Gerhard von Kügelgen war aber doch der Vater, dessen Ermordung den fulminanten Schluß der Jugenerinnerungen bildet. Es gab zwar auch einen Bruder, aber war der auch Maler? Bekannt ist er wohl nicht als solcher, und er scheint auch nicht – wie Munzingers Archiv meint – der Zwillingsbruder gewesen zu sein, sondern vier Jahre jünger. Allerdings kann ich mich an diesen Punkt nicht mehr genau erinnern, obwohl ich das Buch zweimal gelesen habe. Weiß jemand etwas Genaueres? |
Kommentar von R. M., verfaßt am 24.06.2011 um 19.42 Uhr |
| Hilft das? www.deutsche-biographie.de/sfz46596.html www.deutsche-biographie.de/sfz51318401.html www.deutsche-biographie.de/sfz46605.html |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.06.2011 um 09.08 Uhr |
| Hier ist noch eine interessante Einzelheit aus Hentigs Erinnerungen: 1990 kandidierte Hentig für das Amt des Vorsitzenden der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung gegen den phlegmatischen Herbert Heckmann, der zum vierten Male antrat. „Ich forderte, unter Berufung auf unseren Namen, in dem ‚Sprache‘ vor ‚Dichtung‘ steht, eine stärkere Beschäftigung mit der Ersten an und nannte als Zweites von sechs bisher von uns vernachlässigten Sprach-Themen die uns von den Kultusministern angekündigte Rechtschreibreform. Diese hatte Herbert Heckmann im Einklang mit der Mehrheit im Hause für unter unserer Würde gehalten und nie in die Tagesordnung aufgenommen. (Das sollte sich 1996 bitter rächen.)“ (Mein Leben –- bedacht und bejaht II:577) Heckmann wurde wiedergewählt, Hentig war auch in gewisser Weise erleichtert. In meiner Dokumentation zur DASD steht: "Schon zur Anhörung in Bad Godesberg am 4. Mai 1993 hatte die Akademie weder eine schriftliche Stellungnahme eingereicht, noch war sie – infolgedessen – zu Veranstaltung selbst eingeladen worden. Später hieß es, die Aufforderung zur Stellungnahme sei nicht erfolgt oder bei der Akademie verlorengegangen; eine Nachfrage scheint es auch nicht gegeben zu haben. Der Präsident der Akademie war damals Herbert Heckmann." |
Kommentar von Oliver Höher, verfaßt am 25.06.2011 um 18.20 Uhr |
| Ergänzend zu den Verweisen von Herrn Markner führe ich noch an, was Walther Killy in seiner Ausgabe der Briefe Wilhelm von Kügelgens an den Bruder Gerhard (Wilhelm von Kügelgen: Bürgerleben. Die Briefe an den Bruder Gerhard 1840–1867, hrsg. und mit einer Einleitung versehen von Walther Killy, München: C. H. Beck 1990, S. 1067) in den Stammtafeln mitteilt: Gerhard von Kügelgen (6.2.1772–27.3.1820), der bei Loschwitz ermordete Vater war Portrait- und Historienmaler. Gerhard von Kügelgen (11.5.1806–28.12.1883), der in Estland gestorbene Bruder war zunächst Besitzer von Versenau-Neuhall und in Estland dann Verwalter des Stiftes Finn. Gerhard von Kügelgen (27.5.1833–28.6.1866), der Sohn Wilhelms fiel als Hauptmann bei Skalitz. Der einzige weitere Maler ist der Onkel (Zwillingsbruder des Vaters) Karl von Kügelgen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.09.2013 um 06.01 Uhr |
| Zum erlesenen "deuteros plous" paßt auch, daß Hentig in seiner Autobiographie jenes fehlerhafte Schriftchen zur Rechtschreibreform sein "Encheiridion" nennt. Daß 99 Prozent seiner Leser das Wort nicht kennen, ist gerade der Sinn der Sache. |
Kommentar von stefan strasser, verfaßt am 26.09.2013 um 13.58 Uhr |
| Ist Enchiridion (kleines Handbuch) oder Encheiridion (?) gemeint? |
Kommentar von Argonaftis, verfaßt am 26.09.2013 um 14.24 Uhr |
| Ελληνική γλώσσα εγχειρίδιο διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης (ξένης) γλώσσας / Aus dem ngr. übersetzt: Griechische Sprache Handbuch für den Unterricht Griechisch als zweite (Fremd-) Sprache |
Kommentar von Argonaftis, verfaßt am 26.09.2013 um 14.33 Uhr |
| Oh, das ging schief, das Programm kann griechische Schrift nicht abbilden. Hier in lateinischen Lettern: Ellīnikī glṓssa : encheirídio didaskalías tīs ellīnikīs ōs deúterīs (xénīs) glṓssas |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 26.09.2013 um 22.43 Uhr |
| encheiridion ist altgriechisch, encheiridio ist neugriechisch; beides bedeutet Dolch, Kurzschwert, Handbuch. |
Kommentar von Argonaftis, verfaßt am 27.09.2013 um 08.34 Uhr |
| Zu #9601, #9602 Dank an die Redaktion für die Transkription. Argonaftis Kastro/Ilias/Gr. |
| Als Schutz gegen automatisch erzeugte Einträge ist die Kommentareingabe auf dieser Seite nicht möglich. Gehen Sie bitte statt dessen auf folgende Seite: |
| www.sprachforschung.org/index.php?show=newsC&id=210#kommentareingabe |
| Kopieren Sie dazu bitte diese Angabe in das Adressenfeld Ihres Browsers. (Daß Sie diese Adresse von Hand kopieren müssen, ist ein wichtiger Teil des Spamschutzes.) |
| Statt dessen können Sie auch hier klicken und die Angabe bei „news“ von Hand im Adressenfeld ändern. |
