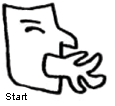


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
Sie sehen die neuesten 12 Kommentare
Nach unten
Durch Anklicken des Themas gelangen Sie zu den jeweiligen Kommentaren.
Manfred Riemer zu »Kognitivismus« |
|
Ich nehme an, der Eintrag http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1074#57186 ist versehentlich dort gelandet, deshalb setze ich meine Frage hier ein. Sie verwenden oft den Begriff "(sprachliches) Konstrukt", und fast genauso oft frage ich mich, was damit gemeint ist. Könnten Sie das noch einmal genau definieren? Es wäre für mich sehr hilfreich. Was ist für Sie ein sprachliches Konstrukt? In welchem Sinne existiert es und in welchem Sinne existiert es nicht? Bewußtsein, Verstand zählen Sie zu den Konstrukten, Schmerz, Gefühle, Sinneswahrnehmungen dagegen nicht, verstehe ich Sie so richtig? Sind Bewußtsein, Verstand solche Konstrukte wie Äquator, Pol, Schwerpunkt, oder sind sie völlig andersartig (z. B. hinsichtlich Existenzfragen)? |
Theodor Ickler zu »Buch oder Bildschirm« |
|
Zu Gary Marcus: Solange KI-Skeptiker sich auf das Verstehen berufen, das der KI unerreichbar sei, bin ich nicht überzeugt. „Marcus hat aktuelle Sprachmodelle als Annäherungen an den Sprachgebrauch und nicht an das Sprachverständnis beschrieben.“ (Wikipedia) Auf einer bestimmten Ebene gibt es diesen Unterschied nicht mehr. Pointiert gesagt: Auch unser Verstehen geschieht ohne Verständnis (wie das Planen ungeplant geschieht usw.). |
Theodor Ickler zu »Neues aus dem Rat« |
|
Die Frage, wann, wie und warum „Bewußtsein“, „Geist“, „Verstand“ oder „Organismen mit einer Psychologie“ in die Welt gekommen sind, hat keinen Sinn. In die Welt gekommen ist die Sprache, und die hat sich über Hunderttausende von Jahren arbeitsteilig so reich ausdifferenziert, daß es ganz zuletzt in gewissen Regionen und Schichten zu psychologischen Konstrukten wie den genannten gekommen ist. |
Theodor Ickler zu »Delirium« |
|
Die berühmtesten philosophischen „Gedankenexperimente“ sind: Blinde Mary (Frank C. Jackson), Gehirn im Tank, Zwillingserde, Superspartaner (alle von Hilary Putnam), Chinesischzimmer (John Searle) und die verwandte Mühle (Gottfried W. Leibniz), Schiff des Theseus (antik/Otto Neurath). Ausführlichere Listen bei Wikipedia. Die beste Widerlegung dürfte Kathleen Wilkes gegeben haben (Real people. Personal identity without thought experiments. Oxford 1988). |
Theodor Ickler zu »Neues aus dem Rat« |
|
Das stimmt, vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1074#52565 Die Streichung hatte ich auch irgendwo dokumentiert, sie liegt ebenfalls schon sehr lange zurück. Und dabei hat der Rat heute eine Geschäftsstelle und ein Budget! |
Timo Paehler zu »Neues aus dem Rat« |
|
Daß es seit 15 oder 20 Jahren drei Fragen sind, ist nicht ganz richtig: Es waren mal fünf. https://web.archive.org/web/20161228214018/https://www.rechtschreibrat.com/service/fragen-und-antworten/ (»Die FAQs des Rats werden fortlaufend erweitert« – ja, es gibt ja auch negative Steigungen.) |
Theodor Ickler zu »Kognitivismus« |
|
„When atoms and molecules are organized in a suitably complicated way, the result is something that perceives, knows, believes, desires, fears, feels pain, and so on—in other words, an organism with a psychology.“ (Alex Byrne: „What mind-body problem?“ Boston Review Mai/Juni 2006) Die Organisation von Atomen und Molekülen ist notwendig, aber zur Entwicklung und Zuschreibung psychologischer Prädikate kommt es unter bestimmten gesellschaftlichen Umständen. Die Psychologie gehört zum Beobachter, nicht zum beobachteteh Organismus. Bewußtsein kann nicht beobachtet werden und „emergiert“ nicht. Kein Biologe wird je feststellen, ob ein Lebewesen sich einer Sache bewußt ist oder nicht. Auch der kompliziertesten Anordnung von Molekülen kann man nicht zuschreiben, daß sie etwas „weiß“ oder „fühlt“. Das ist keine Tatsachenfrage, sondern wäre eine Vermischung unvereinbarer Begriffe, ein Kategorienfehler im Sinne Ryles. |
Theodor Ickler zu »Niedriger hängen!« |
|
„Narzissten lassen sich an den Augenbrauen erkennen.“ Das haben kanadische Psychologen festgestellt. |
Theodor Ickler zu »Neues aus dem Rat« |
|
Die Ankündigung von Sitzungen für das vergangene (!) Jahr auf der Website des Rechtschreibrates ist ebenso bezeichnend für die absolute Trägheit dieses Gremiums wie der unerschütterliche Bestand von drei (!) „Fragen und Antworten“ seit 15 oder 20 Jahren. |
Theodor Ickler zu »Trüber Morgen« |
|
Es gibt die Geschichte vom Mafiaboß und vielfachen Mörder, der schließlich wegen Falschparkens erwischt und verurteilt wird. Letzteres kann heute durch „Vorkommen in den Epstein-Files“ ersetzt werden. Viele vermuten, das Interessanteste stehe in den 2,5 Mill. Dokumenten, die das Justizministerium nicht veröffentlichen will (entgegen dem Gesetz). |
Theodor Ickler zu »Trüber Morgen« |
|
Trump wirbt für die Kohle, die auf seine Anweisung hin im Weißen Haus stets „schöne saubere Kohle“ genannt werden muß. Das hat er selbst bekanntgegeben. Solche Schibboleths sind täglich zu absolvierende Loyalitätstests. |
Theodor Ickler zu »Synonymie« |
|
Olympia-Teilnehmer sind noch keine „Olympioniken“, sie sind aber auch noch keine Loser, nur weil sie Trump kritisieren. („Loser“ ist die Standardbeschimpfung im Munde des stets gewinnorientierten Donald Trump.) |
Zurück zur Übersicht | nach oben