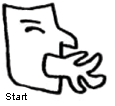


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
09.03.2007
Zwei Fragen
Regelmäßigkeiten und Regeln
Aus philosophischen Gründen, die nicht direkt mit der Rechtschreibung zusammenhängen, möchte ich den Lesern zwei Fragen stellen:
1. Bauen Bienen ihre Waben auf regelmäßig-sechseckigen Grundrissen? Oder quetschen sie einfach zylindrische, auf kreisrundem Grund erbaute Röhren aneinander und füllen den Zwischenraum mit Wachs aus? Im ersten Fall müßte in ihrem Hirn irgendeine Entsprechung zur Zahl 6 oder die Anweisung zum Bau bestimmter Strecken und Winkel verankert sein, im zweiten natürlich nicht. Am Rande einer Wabe müßte man es erkennen können, ich habe aber keine zur Hand, und die schematisierten Abbildungen in Büchern tun alle so, als sei der sechseckige Grundriß eine ausgemachte Sache.
2. Hat jemand ein altes Planimeter, das er mir preisgünstig überlassen könnte? Bei Ebay kann man welche ersteigern, aber sie werden zuletzt immer ziemlich teuer. Es ist ein philosophisch hochinteressantes Gerät, weil es Integralrechnungen simuliert und doch nur ein feinmechanisches Stück ist, das von Mathematik soviel versteht wie ein Holzklotz.
| Kommentare zu »Zwei Fragen« |
| Kommentar schreiben | neueste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Kai Lindner, verfaßt am 09.03.2007 um 18.22 Uhr |
|
Die Wabenform ergibt sich zwangsläufig, wenn man Honig in Zylinder quetscht... bzw., wenn man zylindrische Stäbchen gleichen Durchmessers in idealer Packung übereinanderschichtet. Sehr schön erkennbar ist das auch, wenn Seifenblasen aneinanderkleben... dann bilden sich ebenfalls sechseckige Muster. Grundsätzlich bauen Bienen (denke ich) eher runde Zylinder, die im Sechseck angeordnet sind – also um jeden Zylinder herum befinden sich sechs andere Zylinder. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 09.03.2007 um 19.07 Uhr |
|
Wespen bauen ihre selbsttragenden Waben in derselben Sechseckform und Größe wie Bienen, aber aus einer Art sehr dünnem und sehr leichtem Papier, das sie aus zerkautem Holz und Spucke anfertigen. Sie sammeln ja keinen Honig, weil nur die Wespenkönigin den Winter überlebt. Alte Nester benutzen sie nicht wieder. Die steifste selbsttragende Konstruktion wären Dreiecke (siehe Fachwerkträger im Stahlbau), aber die wären als Hohlform unpraktisch. Vierecke sind ungeeignet, weil verschiebbar, aber Sechsecke sind auch beliebig fortsetzbar und als Gesamtheit sehr steif. |
Kommentar von Sigmar Salzburg, verfaßt am 10.03.2007 um 09.29 Uhr |
|
Dem Sechseckmuster der Bienenwaben liegt die dichtestmögliche regelmäßige Kugelpackung in der Ebene zugrunde. www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/35955 Wenn dieses Prinzip auf gekrümmte Flächen übertragen wird, etwa beim Facettenauge der Insekten, scheitert auch die Natur an der Mathematik in der Zusammenfügung regelmäßiger Sechsecke. Es werden ab und zu Fünfecke eingebaut. Aus ähnlichen mathematischen Gründen kann es auch keine räumlichen Stabtragwerke aus gleichlangen Stäben geben, die über einen Ausschnitt aus einem Ikosaeder hinausgehen. |
Kommentar von Hans-Jürgen Martin, verfaßt am 10.03.2007 um 19.16 Uhr |
|
Die erste Frage ist keine philosophische, sondern eine physikalische und auch ethologische. Daß Bienen keine "genialen Baumeister" sind, sondern "einfach" runde Zellen bauen und deren sechseckige Form einem physikalischen Prinzip verdanken, habe ich seinerzeit unter "http://www.wildbienen.de/wbi-news.htm#n3" berichtet. Es gibt übrigens nicht nur (domestizierte) Honigbienen: Wer sich für die etwa 555 (!) Wildbienenarten Deutschlands, ihre Biologie und Gefährdung interessiert, kann sich unter www.wildbienen.de informieren. Das von Herrn Salzburg angeführte Protokoll unter "http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/35955/" zeigt übrigens, daß auch Wissenschaft unwissenschaftliche Schwächen hat, wenn sie "politisch korrekt" die Sprachwissenschaft ignoriert und die zwangsreformierte Schulschreibung nachzuäffen sucht und dann z. B. erklärt, wie die exakte Geometrie der Bienenzellen "zu Stande" kommt: Die untersuchten Zellen der Honigbienen liegen bekanntlich waagerecht, die der Hummeln (= "primitiv eusozialer" Wildbienen) aber stehen senkrecht mit ihren Öffnungen nach oben, und die Zellen der sozialen Wespen (die sich gelegentlich in unseren Garagen, Gartenhäuschen und Dachböden einnisten) hängen mit ihren Öffnungen nach unten. |
Kommentar von Kelkin, verfaßt am 12.03.2007 um 08.27 Uhr |
|
Bei Bienen scheint hier die Frage unklar zu bleiben, aber meines Wissens läßt sich der Bauplan von Spinnennetzen nicht durch Aneinanderreihen von Löchern erklären. Das Einspeichern von Winkelfolgen muß also in solchen 'primitiven' Tieren möglich und effektiv sein.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.03.2007 um 09.39 Uhr |
|
Um das Interesse an solchen scheinbar fernliegenden Fragen noch etwas zu erläutern: Das Sprachverhalten und natürlich auch die Beherrschung der Rechtschreibung lassen sich als Befolgen von Regeln auffassen. Das ist aber nur ein bestimmtes Beschreibungsformat, das durch gewisse Gewohnheiten nahegelegt wird. Ein Biologe hat einmal gesagt: "Nicht alles, was berechnet werden kann, beruht auf Berechnung." Die Planeten folgen nicht den Keplerschen Gesetzen, sondern wir Kulturmenschen stellen die Gesetze auf, um die Bewegung der Planeten zu beschreiben und vorauszusagen. Pädagogen sind sich im klaren, daß Regelwissen und wirkliches Können zweierlei sind. Wenn man beides gleichsetzt, kommt man zu einer unangemessenen Intellektualisierung und vergißt das Üben. Bekanntlich haben die Rechtschreibreformer die Leichtigkeit der Regelformulierung mit der Einfachheit des Schreibens verwechselt, die auf Intuitionen beruht. Usw., die ganze bekannte Debatte. Deshalb sind Beispiele wie die Bienen oder das Planimeter aufschlußreich. Ich hatte vergessen, daß wir mit Herrn Martin einen Sachkenner unter uns haben, entschuldigen Sie bitte! Der entscheidende Satz in der von Herrn Martin angegebenen Quelle lautet: "Wie Forscher aus Südafrika und Würzburg herausfanden, formen sie jedoch nicht die bekannten sechseckigen Tönnchen, sondern nur weitgehend runde Zylinder. Dabei erwärmen sie das Wachs auf 40° Celsius, wodurch es zu fließen beginnt und automatisch die energetisch sparsamste Form annimmt: die des Sechsecks." Das hatte ich mir schon gedacht. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 12.03.2007 um 11.23 Uhr |
|
Leider habe ich die riesige Wespennestkugel mit mehreren Waben aus meinem Dachboden schon weggeworfen, aber wenn ich wieder eine finde, werde ich prüfen, ob das "Papier" aus zerkautem Holz und Speichel, aus dem es gemacht ist, bei Erwärmung auf 40°C wieder zu fließen beginnt und sich zur Sechseckform verformen läßt. Die äußere Kugelschale des Papiernestes, die unter der glatten Außenhaut wie ein Isoliermaterial aus unzähligen Luftkammern und Stegen besteht, hält jedenfalls die sommerliche Hitze direkt unter den Dachziegeln locker aus, ohne zu zerfließen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.03.2007 um 11.36 Uhr |
|
In der Tat fällt es schwer, sich den Bau solcher Waben nach dem Muster der zerfließenden Bienenwachswände vorzustellen; vgl. www.natur-lexikon.com.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 11.01.2009 um 02.52 Uhr |
|
Sie ist schon sprichwörtlich geworden für eine absolute Unmöglichkeit, für etwas, das es in der Realität einfach nicht gibt: die Quadratur des Kreises. Darunter versteht man den Versuch, nur mit Zirkel und Lineal aus einem Kreis ein flächengleiches Quadrat zu konstruieren. Oder anders gesagt: mit diesen Mitteln den Flächeninhalt eines Kreises in den üblichen quadratischen Einheiten (z.B. qm und beliebige Bruchteile davon) zu messen. Es ist ganz einfach nicht möglich. Um wieviel absurder muß einem dann erst der Gedanke vorkommen, nicht nur eine so regelmäßig, ja geradezu ideal geformte Fläche wie einen Kreis, sondern jeden beliebigen, von einer stetigen, endlich langen Linie begrenzten Tintenklecks oder sonstirgendwie gezackten Blitzsternhalbmond absolut genau vermessen zu wollen? Aber genau diese verrückte Idee geht mit einer im Verhältnis dazu nur minimalen Erweiterung der Voraussetzungen in Erfüllung: Doppelzirkel statt Zirkel und eindimensionales Meßrad statt Lineal, zusammen genannt Planimeter! Die Mathematik beschreibt nicht nur exakte Formeln und genaue Konstruktionen, sondern auch Näherungsverfahren und -konstruktionen, die sich in unendlich vielen Schritten dem gewünschten Ergebnis zwar beliebig genau annähern, aber dennoch praktisch irgendwann abgebrochen werden müssen, und die dann mit einer kleinen (meist vernachlässigbaren) Restungenauigkeit behaftet sind. Zum Beispiel kann man jeden Winkel mit Zirkel und Lineal sehr einfach und ganz exakt in zwei gleiche Teile teilen, aber schon die Dreiteilung eines beliebigen Winkels ist unter den gleichen Voraussetzungen mit endlich vielen Schritten unmöglich. Und nun muß man sich vergegenwärtigen: Die dem Planimeter zugrundeliegende Theorie und Methode ist nicht etwa ein Näherungsverfahren, wie es z.B. für die Dreiteilung eines Winkels notwendig wäre, sondern das Planimeter liefert tatsächlich eine absolut genaue Aussage über den Flächeninhalt jeder beliebigen (stetig und endlich begrenzten) Fläche! Natürlich muß man hier (genau wie bei der Zweiteilung des Winkels) von der dem benutzten Gerät innewohnenden mechanisch und menschlich bedingten Ungenauigkeit absehen, aber das Verfahren an sich ist (anders als bei der Dreiteilung eines Winkels) absolut genau. In dieser unendlichen Kompliziertheit des konkreten Sachverhalts, die sich in einem geradezu grotesk einfach anmutenden und trotzdem absolut genauen mathematischen Verfahren auflöst, liegt das, was die Augen eines Mathematikers zum Leuchten bringt. Dieser Tagebucheintrag ist fast 2 Jahre alt, und ich habe oft darüber nachgedacht, was wohl ein Planimeter mit der Sprache zu tun haben möge. Prof. Ickler hat mich selbst auf den Gedanken gebracht. In seiner Schrift "Die Ränder der Sprache" schreibt er, über den Konflikt zwischen unverständlichen "Satzriesenschlangen" einerseits und der Kompliziertheit von juristischen und mathematischen Sachverhalten andererseits reflektierend: "Was würde ein Mathematiker sagen, bäte man ihn, seine Zeichenketten um der Übersichtlichkeit willen in kürzere zu zerhacken?" Natürlich ist es manchmal gar nicht möglich oder nicht immer sinnvoll, einen komplizierten mathematischen Satz in wenige Zeichen zu fassen. Aber trotzdem gibt es auch ein spezifisch mathematisches Verständnis für Schönheit. Mathematiker schreiben nicht 2/4, sie schreiben 1/2. Wo immer es geht, wird gekürzt. Schönheit sehen Mathematiker dort, wo relativ komplexe Zusammenhänge auf verblüffend einfache Art ausgedrückt werden, wie zum Beispiel – Satz des Pythagoras: a^2 + b^2 = c^2, – der reine Wahnsinn aus Eulerscher Zahl e, Kreiszahl pi, imag. Wurzel i aus –1: e^(i*pi) = –1, – die Äquivalenz von Energie und Masse: E = m * c^2 und viele andere Sätze dieser Art. Und in diese Reihe gehört eben auch der wunderbar einfache Alleskönner, das Planimeter. Nicht nur die Sprache, auch die Mathematik drängt nach dem Einfachen! |
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 02.07.2013 um 16.28 Uhr |
|
Darf ich auch so eine Frage stellen, die nichts mit Rechtschreibung zu tun hat? Typischerweise finden Archäologen doch alles mögliche durch Grabungen. Je älter, desto mehr Meter müssen sie nach unten vordringen, grob gesprochen. Der Staub der Jahrtausende hat sich auf die alten Stätten gelagert. Bedeutet das eigentlich, daß die Kontinente auf dem freien Land immer weiter in die Höhe wachsen? Das wäre ja grundsätzlich möglich, wenn unter dem Strich mehr Biomasse hinzukommt, als andererseits vom Wetter weggespült und weggeweht wird. Weiß das jemand? Ich habe eine Weile nach des Rätsels Lösung gegoogelt, aber nichts gefunden. |
Kommentar von Bernhard Strowitzki, verfaßt am 02.07.2013 um 16.49 Uhr |
|
Wir müssen verschiedene Dinge unterscheiden: archäologische Schichtung, Biosedimentation und geologische Sedimentation. Die archäologische Schichtung kommt daher, daß früher nicht wie heute beim Bau eines Hauses tiefe Kellergeschosse ausgeschachtet wurden, sondern das neue Haus einfach auf den eigeebneten Trümmern des alten errichtet wurde. Im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende konnten so ganze Siedlungshügel ("Tells") entstehen. Daß aufgegebene Siedlungen dann von Flugsand, Pflanzenwuchs und Humus überdeckt wurden, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Biosedimentation findet im wesentlichen in Mooren und Sümpfen statt. Wenn die Pflanzenmasse wegen Sauerstoffmangels nicht verwesen kann, können sich viele Meter dicke Schichten insbesondere von Torfmoos (Sphagnum sp.) bilden. Geologische Sedimentation schließlich resultiert aus der Abtragung der Berge durch die Flüsse, hat also einen einebnenden Effekt. Dem wirken allerdings tektonische Vorgänge entgegen, so daß es sich um einen ewigen Kreislauf handelt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.07.2013 um 17.10 Uhr |
|
Etwas ähnliches wollte ich auch gerade notieren. Bei starkem Regen staune ich oft über die Erosion, und das bei der Kürze der Zeit, die mir zur Beobachtung beschieden ist. Die Hügel hier werden abgetragen, da fällt die Biomasse, die sich anhäuft, kaum ins Gewicht. Ich muß auch gestehen, daß mir lange Zeit nicht bewußt war, wie viel von dem Kraut, das ich in den Komposter schichte, beim Verrotten wieder in die Luft entweicht. Eigentlich ja klar. Herr Strowitzki hat den Flugsand erwähnt. Ein starkes Erlebnis war es, als ich in Jaisalmer (alte Wüstenstadt in Rajasthan, nahe der pakistanischen Grenze) aufwachte und sah, welche Dünen sich schon wieder an Hauskanten und Bordsteinen gebildet hatten. Jeden Morgen wurde das weggeschaufelt, sonst würde der Ort in kürzester Zeit unter dem Sand liegen. In den Dolomiten kann man anschaulich sehen, wie die Berge abgetragen werden, es sind ja nur noch Stummelzähne übrig, für die Bergsteiger allerdings ein Traum. Aber die Kalkalpen bestehen aus Muscheln, nicht wahr? Nicht daß dort oben Meeresboden gewesen wäre, das ist aufgefaltet, aber dieser Vorgang vollzieht sich in anderen Dimensionen. |
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 03.07.2013 um 06.30 Uhr |
|
Herr Strowitzki hat eine gute Orientierung gegeben, insbesondere auch mit dem Hinweis auf die Tells. Professor Ickler hat betont, wie schnell die Zerfallsprozesse vor sich gehen. Darf ich noch einmal nachhaken? Ich sprach ja nicht von Bergen oder Hügeln und auch nicht von Mooren, sondern vom flachen Land. Vergleiche die Beobachtungen von Professor Ickler: Die Dolomiten zerfallen, in der Ebene häuft sich der Sand an. Ein Gedankenexperiment soll meine Frage veranschaulichen: Denken wir uns ab sofort die Menschen weg und greifen wir hundert Automobile heraus, die im Moment irgendwo auf Straßen oder Parkplätzen in Deutschland stehen, und zwar auf dem flachen Land. Meine Vermutung (Zeitraum ist frei erfunden): In 500 Jahren werden diese hundert Autos im Durchschnitt gerade von Erde bedeckt sein. Der Boden auf dem flachen Land wäre also in dieser Zeit um 1,50 Meter angewachsen. Schlußfolgerung: In 5000 Jahren wird der Boden um 15 Meter angewachsen sein. Wo ist der Denkfehler? |
Kommentar von R. M., verfaßt am 03.07.2013 um 11.15 Uhr |
|
Der Denkfehler liegt darin, daß man solche pauschalen Aussagen nicht treffen kann. Auch im Flachland kann es zu Erosion durch Wind und Wasser kommen; es kommt darauf an, wie exponiert die betreffende Stelle ist. Verändert ein Fluß seinen Lauf, könnten die Autos sogar weggespült werden. Nach fünfhundert Jahren wäre aber jedenfalls von Fahrzeugen aus italienischer Produktion ohnehin nur noch ein rostbrauner Fleck auf der Scholle übrig.
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 03.07.2013 um 11.19 Uhr |
|
Die Münchner Schotterebene wurde durch mehrere Eiszeiten aufgeschüttet. Die seit der letzten Eiszeit entstandene Humusschicht ist etwa einen bis zwei Spaten tief. Bei Ausschachtungen findet man zwischen den einzelnen Schotterschichten schwarze Humusschichten. Im Dachauer Moos wurde früher Torf abgebaut. (Moos ist das süddeutsche Wort für Moor.)
|
Kommentar von stefan strasser, verfaßt am 03.07.2013 um 11.50 Uhr |
|
Zu einer ähnlichen Fragestellung hab ich einmal eine filmische Animation gesehen. Soweit ich mich erinnere, gab es zwei Haupteffekte. Einmal wurde der Verfall verfallender Substanzen nachgebildet. Also Rost, Zersetzung und Erosion von Gegenständen und Gebäuden. Als zweiten Haupteinfluß gab es die Ansiedlung von Pflanzen, die von den verschiedenen „Biotopen“ Besitz nahmen, nachdem sich durch Windverfrachtung oder anders Basisschichten zur Ansiedlung gebildet hatten. Wo die Voraussetzungen also günstig sind, verschwindet die ursprüngliche Struktur im Laufe der Zeit durch Zerfall, Überwuchs, Umwandlung und/oder Verfrachtung. Stellenweise kann das vermutlich schon zu 15 m Zuwachs in 5000 Jahren führen. Je nach Örtlichkeit können die Verhältnisse aber sehr unterschiedlich sein, etwa in der Nähe von Wasserläufen; hier findet Ausschwemmung und Anlagerung an anderer Stelle statt. Weil die „Gesamtmenge der Substanz“ so gut wie konstant bleibt, wird über sehr lange Zeiträume weitgehende Einebnung das Endresultat sein, wenn man die äußeren Einflüsse wie Wind, Regen, Temperaturextremwerte und Sonnenschein unverändert läßt. Erdgeschichtlich kommen dann noch Ereignisse wie Eiszeiten, tektonische Verschiebungen, Auffaltungen, Meteoriteneinschläge usw. als Einflußgrößen dazu. Ergänzend noch zur Umwandlung: das beanspruchte Volumen organischer Substanzen bzw. jenes der Zerfallprodukte ist aufgrund geringerer Dichte zumeist höher als die ursprüngliche anorganische Substanz. |
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 04.07.2013 um 05.11 Uhr |
|
Vielen Dank für die Informationen! Ich war von dem Denkmodell ausgegangen, daß die archäologischen Stätten im Prinzip von Flugsand, Staub usw. zugedeckt werden (Sedimentation aus der Luft). Ich fragte mich, warum diese Anhäufung irgendwann aufhört, obwohl doch Flugsand und ähnliches vom Bewuchs noch eher festgehalten werden müßte als ganz am Anfang auf nacktem Stein. Wenn seit der letzten Eiszeit gerade mal ein bis zwei Spaten tief Erde auf dem Münchner Schotter liegt, warum ist das so? Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder sedimentiert zwar permanent Staub und Sand aus der Luft auf das Gelände, wird aber trotz Bewuchs wieder fortgeschwemmt oder fortgeweht. (Vielleicht nur alle paar Jahre bei irgendwelchen extremen Unwettern?) Oder, wie Herr Strowitzki sagte: Sedimentation spielt hauptsächlich in Gewässern eine Rolle. Möglicherweise wurde die Erde, die wir in der Ebene auf dem steinigen Untergrund finden, gar nicht aus dem erodierenden Gebirge oder sonstwoher herangeweht, sondern stammt fast ausschließlich aus der Verwitterung an Ort und Stelle. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.07.2013 um 05.50 Uhr |
|
Als Kinder haben wir gelernt und geglaubt, daß die Steine, die man auf den Feldern liegen sieht, aus der Erde "wachsen". Dieser Eindruck könnte dadurch entstanden sein, daß die Ackerkrume immer wieder weggespült (hierzulande weniger weggeweht) wird und folglich immer wieder neue Steine oben liegen und aufgelesen werden müssen. In manchen Regionen hat man ja diese Steine als Mäuerchen um die Felder aufgeschichtet, die zugleich den Wind brechen und vielleicht auch das Vieh zurückhalten (wie in Irland).
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 04.07.2013 um 09.22 Uhr |
|
Steine "wachsen" tatsächlich aus dem Humus an die Oberfläche, nämlich durch Frostlinsen, die sich im Winter im Humus unter den Steinen bilden und sie nach oben drücken. Das kann man jedes Frühjahr auf den eigenen Blumenbeeten beobachten. Die Humusschicht hängt tatsächlich von der Art der Landwirtschaft ab, durch jährliches Pflügen und Steine absammeln z.B. mit Kartoffelrodemaschinen und Verrottenlassen der Pflanzenreste wächst die Humusschicht. Im Norden von München gibt es trockene Heidegebiete mit ganz dünner Humusschicht, die höchstens für Weidewirtschaft geeignet sind. Das Dachauer Moos mit seinen dicken Torfschichten muß früher z.B. zur Zeit der Römer ein Sumpfgebiet gewesen sein. Prähistorische Siedlungen findet man z.B. bei Germering, wo das Land trocken genug für Landwirtschaft war und das Grundwasser gerade so tief lag, wie es für Brunnen geeignet war. Südlich von München findet man prähistorische Siedlungen nur an Fluß- und Bachläufen z.B. im Hachinger Tal. Sonst liegt dort das Grundwasser zu tief für gegrabene Brunnen. |
Kommentar von Bernhard Strowitzki, verfaßt am 04.07.2013 um 11.37 Uhr |
|
Bodenbildung ist in der Tat ein sehr verwickelter Vorgang. Ob des intensiven Grünens und Gedeihens der Pflanzen im tropischen Regenwald dachten die kolonisierenden Europäer, dies müßte hervorragender Boden für Landwirtschaft sein. Nachdem der Wald gerodet und Äcker angelegt waren, mußte man mit Entsetzen feststellen, daß die Humusschicht verschwindend gering ist. Alles tote organische Material wird sofort zersetzt und wieder in neue Pflanzen und Tiere eingebaut. Unsere Böden stammen zu einem großen Teil tatsächlich aus der Verwitterung und organischen Zersetzung der Gesteine im Untergrund. Je nach Gesteinsart – und weiteren Bedingungen wie Feuchtigkeit – ergeben sich dann die unterschiedlichen Bodentypen. Erosion von Humusboden spielt zwar neuerdings – menschenverschuldet – eine große Rolle, natürlicherweise sitzt dieser aber recht gut fest. Anschwemmungen der Flüsse und Bäche oder auch Geschiebe von Gletschern aus den Bergen sind zu einem großen Teil Gesteins-"Rohmaterial", wie eben die dicken Schotterschichten im Voralpenland. Eine Besonderheit sind die Lößböden der Börden. Hier ist während der Kaltzeiten mit ihrem Tundraklima massiv Staub verweht worden und hat sich vor Gebirgshängen angehäuft. Eine allgemeine Sedimentation von Staub findet aber kaum statt, eine geringe Menge Zuwachs erhält die Erde täglich durch Meteoriteneinfall, sonst handelt es sich aber nur um Verlagerung. In unseren Schulbüchern gab es eine schöne Abbildung über die Wirkung von Wanderdünen an der pommerschen oder Ostpreußischen Küste. Das erste Bild zeigt ein Dorf vor der Wanderdüne, auf dem zweiten ist das Dorf unter der Düne, auf dem dritten schließlich sind die Ruinen des Ortes hinter der weitergewanderten Düne zu sehen. |
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 04.07.2013 um 13.29 Uhr |
|
Höchst interessant. Die aus dem Acker wachsenden Steine haben mich noch auf eine andere Arbeitshypothese gebracht: Der Boden wird grundsätzlich nach unten weggeschwemmt. Der versickernde Wassertropfen nimmt immer ein paar Mikropartikel aus dem Boden mit ins Grundwasser. Und zwar um so mehr, an je mehr Erde er vorbeistreicht, sprich: je tiefer der Boden ist. Also: Je tiefer der Boden, desto mehr wird davon bei jedem Regen nach unten ausgewaschen. Dies würde erklären, warum fast immer eine Erdschicht vorhanden ist (Zuwachs durch Verwitterung und Anwehung) und warum diese andererseits nicht beliebig anwachsen kann. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 04.07.2013 um 16.25 Uhr |
|
Befindet sich unter der Humusschicht eine (wasserundurchlässige) Lehm- oder Tonschicht, findet so gut wie keine "Auswaschung nach unten" statt. Liegt aber unter dem Humus wasserdurchlässiger Kies, bildet sich in der obersten Kiesschicht das hier so genannte "Rotliegende", eine braune Mischung aus Humus und so viel Kies, daß sie als nicht wiederverwendbar gilt.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.06.2017 um 08.19 Uhr |
|
Noch einmal zu den Bienenwaben und anderen Sechsecken. Ich bin bei den hexagonalen Konvektionszellen wieder darauf gestoßen. Wikipedia listet Vorkommen in der Natur auf: https://de.wikipedia.org/wiki/Sechseck Man muß unterscheiden zwischen Sechseck-"Konstruktionen", die schon in den Bestandteilen vorgeprägt sind, und solchen, die erst als Epiphänomene des Ganzen entstehen. Bei Eiskristallen läßt sich die Sechszahl aus der Geometrie der Wassermoleküle ableiten, wo es schon den entscheidenden Winkel von ca. 120° gibt. Hexagonale Bienenwaben und Konvektionszellen entstehen aus der dichten Packung von Kreisen bzw. Zylindern quasi "nebenbei". |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.10.2021 um 05.15 Uhr |
|
Ich mußte an diese Diskussion (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=802#23531) denken, als ich kürzlich las, daß der Torfabbau wenigstens in Deutschland bald auslaufen soll, viel zu spät natürlich. Man denkt über die Wiedervernässung nach, weil Moore viel Kohlenstoff binden. Aber die Landwirtschaftsgesetze stehen dem entgegen und müßten von der nächsten Bundesregierug erst an die neuen Ziele angepaßt werden. Als Ersatz für den Gartenbau wird über direkte Verwertung der Torfmoose nachgedacht (Herr Strowitzki hat sie erwähnt). Das Moor wächst ja nur um etwa 1 mm pro Jahr. Es gibt auch andere Substrate, aber Torf ist bisher unschlagbar. Verbrennen, wie noch in Finnland und Sibirien üblich, kommt natürlich gar nicht in Frage. |
