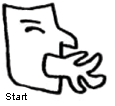


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
21.10.2006
Noch ein seltsamer Germanist
Eng mit der ZEIT und Dieter E. Zimmer verbandelt: Peter Wapnewski
Die SZ veröffentlichte am 3.12.1997 einen ganzseitigen Beitrag von Peter Wapnewski: "Der Buchstabe im Sprachvolk". Er zeigt wenig Sachkenntnis, macht sich über die Schriftsteller lustig, und am Schluß lenkt er auf angebliche Verfallserscheinungen des Deutschen ab.
Bemerkenswert ist, was Wapnewski über die Reformkritiker sagt:
»Das eigentliche Ärgernis aber ist ja nicht das schwächliche Reformwerk, sondern die absurde und gelegentlich an Hysterie grenzende Argumentation der von ihm in ein hektisch um sich schlagendes Leben gerufene Gegnerschaft. So daß ein den Vorschlägen entgegengebrachtes Wohlwollen sich weniger deren Vernunft als vielmehr der Unvernunft der Gegner verdankt und einer soliden Abneigung gegen den Mißton ihres schrillen, fundamentalistisch sich gebenden Eiferertums. Die Motive des Protestes sind simpler Natur. Der Widerstand resultiert aus einem der trübsten Gesetze öffentlichen Verhaltens: auf dem der Gewohnheit. Wir haben das immer schon so gemacht. Also (!) soll es auch weiterhin so gemacht werden ...«
Man sieht hier wieder einmal, wer eigentlich die scharfen Töne in die Debatte gebracht hat. (W. gehört übrigens zu jenen vergeßlichen Germanisten, die wie Jens, Höllerer und eben auch W. aus allen Wolken zu fallen behaupteten, als man sie an ihre NSDAP-Mitgliedschaft erinnerte, und uns einreden wollten, man habe damals Mitglied werden können, ohne es zu merken und zu wissen. W. trat 1940 ein.)
| Kommentare zu »Noch ein seltsamer Germanist« |
| Kommentar schreiben | neueste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Christoph Schatte, verfaßt am 21.10.2006 um 15.29 Uhr |
|
Ein von John Dowland vertonter Text lautet deutsch: "Schweig, trüber Wahn, und wecke nicht den Schmerz!". Dieser kommt einem in den Sinn angesichts des von Wapnewski gewalkten quasibarocken Schriebs von 1997. Da der Titel über den argen Zeilen den Buchstaben und ein sog. Sprachvolk (hier als offensicher Euphemismus für Fußvolk) zusammenpfercht, war und ist vom Text ohnehin nicht viel zu erwarten. Hat Wapnewski zwischenzeitlich seinen Bakkalaureus in Linguistik (und so) gemacht? Falls ja, ist er sich inzwischen kundog geworden, wie groß die Entfernung zwischen dem Buchstaben (welcher wohl?) und dem / einem (~)volk ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.06.2008 um 17.01 Uhr |
|
Falls jemand die Sache noch einmal nachlesen möchte, was sich wegen der z. T. ausgezeichneten Leserbriefe lohnt und auch wegen der Erinnerung an die damalige Situation schon wieder reizvoll ist – hier ist das ganze Paket: SZ 3.12.1997 Der Buchstabe im Sprachvolk Recht haben oder rechthaben – Anmerkungen zum Stand der Rechtschreibreform / Von Peter Wapnewski I „Nachts 10. Im Garten versteht sich iezt von selbst. ging um eilf heut früh in die stadt steckte mich in erbaare Kleider, machte eine Visite, ging zum Herzog, einen Augenblick zur Herzoginn Mutter, wir haben Italiäners hier die uns gute Güsse der Antike schaffen, dann bey Frau v. Stein zu Tisch (. . .). Sie verliesen mich (. . .), da kam der Herzog und der Prinz mit noch zween Guten Geistern. Wir schwazzten und trieben allerley . . .“. So Goethe im Mai 1776 brieflich an Auguste zu Stolberg. Handschriftlich. Gedruckt ging es damals ein wenig geordneter zu, ein jeder Lohn-Schreiber, ein jeder Drucker versuchte den Eindruck barer Willkür einzudämmen, dann ergibt sich ein Schriftbild wie – 1774 – im ersten Brief des leidenden jungen Werther: „. . . ich will mich bessern, will nicht mehr das Bisgen Uebel, das das Schicksaal uns vorlegt, wiederkäuen, wie ich’s immer gethan habe . . .“. Und so fort. So schrieben sie alle damals, die Hölderlin und Lessing und Schiller, die Voss und Wieland, die Herder und Jean Paul, – und gedruckt wurden sie je nach dem Brauch der zuständigen Offizin oder Kanzlei. So setzt der Druck einer Vorrede Schillers zu seinen „Räubern“ – 1781 – ein mit folgenden Worten: „Es mag beym ersten in die Hand nehmen auffallen, daß dieses Schauspiel niemals das Bürgerrecht auf dem Schauplatz bekommen wird. Wenn nun dieses ein unentbehrliches Requisitum zu einem Drama seyn soll, so hat freilich das meinige einen grossen Fehler mehr. – Nun weiß ich aber nicht, ob ich mich dieser Forderung so schlechtweg unterwerffen soll.“ Und so fort. hat nur ein einziges geschlecht der neuen schreibweise sich bequemt, so wird im nachfolgenden kein hahn nach der alten krähen (Jacob Grimm, 1854) Willkürlich herausfallende Beispiele aus dem grenzenlosen Schatzhaus der Literatur des 18. Jahrhunderts. Das heißt, aus jener Epoche der deutschen Kulturgeschichte, in der Dichter und Literaten, Kritiker und Wissenschaftler das Deutsche zu einer gebildeten Sprache machten, – zu einer Sprache von Energie und Geschmeidigkeit, Leuchtkraft und Transparenz, so daß sie nunmehr zum Träger und Instrument der subtilsten Gedanken, leidenschaftlichsten Gefühle und zartesten Stimmungen werden konnte. Von diesem Kraftstrom, diesem überwältigenden Impuls lebt sie bis auf den heutigen Tag. Wenn sie denn lebt. Das Entscheidende aber ist: Die Art und Weise, in der sie geschrieben wurde, war nichts als eine freundliche Beiläufigkeit und hat Wuchs und Entwicklung und Entfaltung dieser Sprache weder gehindert noch gehemmt. II Angefangen hatte das 900 Jahre zuvor. Mit dem Mönch Otfried im elsässischen Kloster Weißenburg, der die Botschaft der Evangelien harmonisch zusammenfügte in deutschen Versreihen. Wer danach in der Folge der Jahrhunderte die deutsche Sprache aufs Pergament, aufs Papier brachte, tat es gemäß dem Brauch dieses oder jenes Scriptoriums, tat es gemäß dem vertrauten Dialekt, tat es gemäß bestimmten Traditionen, nicht willkürlich, aber noch weniger einem allgemeinen Regelwerk gehorchend. Zwar fehlte es nicht an Ratschlägen zur Vereinfachung und Vereinheitlichung (etwa durch Gottsched, Adelung oder auch Klopstock und Johann Heinrich Voss), zumal der Schulunterricht danach verlangte, – sie richteten nichts oder wenig aus. Dieser bunte Zustand mit seinen mannigfachen Varianten hielt sich beharrlich in den Schreib- und Druckstätten und Kanzleien. „die meisten schrieben, wie sie es in der schule oder sonst im leben sich angewöhnt hatten und überlieszen wiederum den setzern die schreibart nach belieben zu verändern, d. h. dem vorherrschenden brauch zu bequemen“ (Jacob Grimm in der Vorrede zu seinem Deutschen Wörterbuch, 1854). Bis die Bismarcksche Reichseinigung auch nach einer Schreibeinigung verlangte. In einer Reihe von Konferenzen zwischen 1880 und 1902 wurde festgelegt, was noch heute im wesentlichen gilt: ein Regelsystem, das der Schulmann Konrad Duden auf der Basis des Preußischen Orthographie-Wörterbuchs hergestellt hatte. Man hat nicht gehört, daß diese Vereinheitlichung die deutsche Sprache merklich verändert habe – obwohl sie radikal vor allem dadurch war, daß sie die regional bis dahin gültigen Schreibweisen außer Kraft setzte. (Ohnehin schrieb jeder weiterhin nach traditioneller Gewohnheit, wenn er dazu Gelegenheit hatte). III Es ist die Sprache, es sind die Wörter, die ihre Schreibung dominieren. Nicht aber bewegt das Buchstäbliche die Sprache. „in den letzten drei jahrhunderten trägt die deutsche schreibung so schwankende und schimpfliche unfolgerichtigkeit an sich, wie sie in keiner andern sprache jemals statt gefunden hat, und nichts hält schwerer als diesen zustand zu heilen. man hat sich von jugend an ihn gewöhnt und niemand kann den leuten ungelegner kommen, als der sich dawider erhebt“ (Jacob Grimm). Inzwischen sind weitere anderthalb Jahrhunderte ins Land gegangen. Die Orthographie – wahrlich eine Magd und nicht mehr als das im Haushalt der Sprache. Und deutlich genug nur unzulänglich ausgestattet, Sprechwirklichkeit in Klang und Artikulation wiederzugeben. Denn „die gewöhnliche schreibung kann lange nicht allen feinheiten der aussprache nachgehen wollen“ (Jacob Grimm), d. h., um es mit der modernen Sprachwissenschaft auszudrücken, die Entsprechung von Phonem und Graphem kann nur auf einen maximalen Annäherungswert hin betrieben werden. Daß der Richtigschreibung ein das Nützliche und Sinnvolle weit überragendes Maß an Wichtigkeit anvertraut wurde, verantwortet also jenes Regelsystem, das wir mit dem Namen des braven Schulmannes Duden verbinden, unter dessen Diktat nun schon drei Generationen von Schreibenden stöhnen: Nicht nur Schüler und Lehrer und Sekretärinnen, sondern ein jeder, der zur Feder greift. Es gibt heute in unserem Lande unter uns niemanden, er halte sich für gebildet oder nicht, der dieses Regelwerk rein beherrschte, sein wirres Dickicht durchschaute. Das ist kein guter Zustand. In ungezählten „Empfehlungen“ haben seit 1921 Kommissionen der zuständigen Wissenschaftler und Politiker ihr Bestes gegeben, ihn zu bessern. Da machte sich auch in unseren Tagen ein Gremium an das saure Werk, und die zuständige Obrigkeit billigte das Resultat seines Unternehmens, förderte es und betreibt nun seine Kanonisierung. Zu dieser sogenannten Orthographie-Reform ist allererst zu sagen – was auch ihre Begründer wissen und betonen –, daß sie alles andere ist als eine Reform. Um sich diesen Titel zu verdienen, hätte die Arbeit bis zur Wurzel, hätte sie radikal vorgehen und sich etwa zur (gemäßigten?) Kleinschreibung entschließen müssen, wie sie Jacob Grimm beharrlich forderte, „den albernen gebrauch groszer buchstaben“ heftig tadelnd. Von solcher reformerischen Entschiedenheit kann in unserem Falle keine Rede sein, jener angleichungswilligen Euro-Euphorie zum Trotz, die einen Verzicht auf die befremdlichen Großbuchstaben nahelegen würde. Vielmehr handelt es sich um den bescheidenen Versuch, gewisse Absurditäten der Schreibung mancher Wörter, vor allem aber das Dickicht einer schlechterdings aberwitzigen Interpunktionsregelung zu bändigen. Ob das Unternehmen notwendig war, steht dahin. Der Bundespräsident in seiner sympathischen Neigung zur vereinfachenden Deutlichkeit erklärte die Reform wie den Widerstand gegen sie für überflüssig „wie einen Kropf“. Allemal ist jedenfalls deutlich, daß der Aufschrei, der durch die Nation hallte, mangelndes Durchdenken des Details, vor allem aber fehlende psychologische Vorbereitung beweist. Die sich den Vorschlägen zur Vereinfachung verdankenden neuen Wörterbücher (Duden und Bertelsmann) spiegeln einen absurden Zirkus wider von Widersprüchen und verwirrenden Ungereimtheiten, die Kritik hat dieses chaotische Bild zu Recht allgemeiner Mißbilligung preisgegeben, auch mit Hohn und Häme nicht gespart. Überdies begingen Reformer und Kultusminister den strategischen Fehler mangelnder psychologischer Vorbereitung der schreibenden Nation. Das eigentliche Ärgernis aber ist ja nicht das schwächliche Reformwerk, sondern die absurde und gelegentlich an Hysterie grenzende Argumentation der von ihm in ein hektisch um sich schlagendes Leben gerufenen Gegnerschaft. So daß ein den Vorschlägen entgegengebrachtes Wohlwollen sich weniger deren Vernunft als vielmehr der Unvernunft der Gegner verdankt und einer soliden Abneigung gegen den Mißton ihres schrillen, fundamentalistisch sich gebärdenden Eiferertums. IV Die Motive des Protestes sind simpler Natur. Der Widerstand resultiert aus einem der trübsten Gesetze öffentlichen Verhaltens: auf dem der Gewohnheit. Wir haben das immer schon so gemacht. Also(!) soll es auch weiterhin so gemacht werden . . . Der Mensch ist ein zur Trägheit neigendes Wesen, er bewährt sich in der Beharrung. Die Gewohnheit nennt er seine Amme, und Bewahren scheint ihm unter allen Umständen ein Wert an sich. Sein konservativ-konservierendes Temperament läßt sich auch durch den wohlfeilen Schrei nach „Innovation“ nicht drängen aus der Bahn des Gewohnten, und mit dem scheindynamischen Imperativ „Weiter so!“ (was eben nicht „weiter“ heißt) lassen sich sogar Wahlen gewinnen. Ein Lied klingt immer am schönsten, wenn gesungen in der alten Melodie, die neue, mag auch alles für sie sprechen, hat gegenüber den vertrauten Tönen keine Chance. Es handelt sich um die Tendenz zu einer allgemeinen Verbeamtung des Bewußtseins. Solches bedacht, kann uns die erlebte Tatsache nicht mehr verwundern, daß Reformen das Scheitern ihrer selbst in sich tragen. Dabei ist doch unbezweifelbar, daß eine Reform der Steuer-, des Renten- und des Gesundheitswesens in diesem unseren Lande nicht nur wünschenswert, sondern zwingend notwendig ist. Jedoch bewährt sich in all diesen Fällen unsere Demokratie als ein System wechselseitiger Blockierung der Vernunftschritte. V Mit der Orthographie-„Reform“ steht es insofern anders, als sie sich anschickt, die Straße zu erobern. Sie steigt hinab in die Tiefen des deutschen Gemütes und macht den Boden vom Wohnzimmer, Küche und Schulstube vibrieren. Insbesondere regt sich ein überraschender Impuls elterlicher Fürsorge, deren pflegliche Gebärde sich wohl auch erklären läßt aus dem Widerwillen, einen einst unter Mühen, ja vielen Qualen erlernten Besitz in den Händen der Kinder zerrinnen zu sehen . . . Wenn Deutschland innenpolitische Probleme bewegen, dann ruft man gern nach den Intellektuellen; die wissen sich dann aufgerüttelt, und auch die Dichter erheben mit hellem Klang ihre Stimme in Form von Unterschriften. Gesetzt den Fall, sie machten sich stark zur Verteidigung von Wert und Ehre der Muttersprache, so tun sie wahrlich ihre Pflicht. In solcher Pflicht sieht sich auch die Deutsche Akademie „für Sprache und Dichtung“. Man darf indes zweifeln, ob sie in dem hier in Rede stehenden Falle gefordert ist, denn „für Schreibung“ ist sie nicht eigentlich kompetent. So ist es dann eine Situation von herber Komik, wenn unsere Schriftsteller sich zur Verteidigung eines überkommenen Zustandes rüsten, den keine Kategorie unser Bürger in Tradition und Selbstverständnis je so konsequent und triftig in Frage gestellt hat wie eben sie. Um nur von unserem Jahrhundert zu reden: Der sprachschöpferische Impetus des Expressionismus hat die herkömmlichen Schreibregeln mit der gleichen Energie gesprengt wie anderseits der marmormeißelnde Stilwille Stefan Georges oder Rudolf Borchardts sie souvewrän ignorierte. Und konsequent zieht der buchstäbliche Eigenwille, der sich dem gültigen Regelkanon verweigert, durch die Jahrzehnte bis in unsere Tage. Das gilt für Bert Brecht (bert brecht) wie für Tucholsky, gilt für Arno Schmidt wie für Ernst Jandl. Es gilt vor allem für die Lyrik. Zu ihrem Wesen gehört die Erprobung des Neuen, also das Experiment. Das Experiment mit der Sprache, und das schlägt sich notwendig als Experiment mit der Schreibung nieder. Ein Prozeß, in dem sich unsere Sprache regeneriert – wie man gegenwärtig Tagen etwa den Gedichten Oskar Pastiors ablesen kann. Und jeder Blick in die Poesie unserer Tage zeigt, mit welch selbstverständlicher Willkür Orthographie, Groß- und Kleinschreibung und Interpunktion eigener Gesetzgebung ausgeliefert werden. Willkür, die keine Willkür ist; immer handelt es sich um den Willen, der dichterischen Formulierung die ihr gemäße graphische Ausdrucksform zu geben. Ginge es mit rechten Dingen zu – aber wann tut es das schon –, müßten die Schriftsteller die Ersten sein, eine Sprengung der beklemmenden Duden-Bande als Befreiung zu empfinden und die Aufhebung dieses peinlichen Monopols fordern. Im übrigen dürfen wir unbesorgt sein: Sie alle werden auch weiterhin so schreiben wie ihnen die Feder gewachsen ist (und auch ich werde mich nicht scheren um Rad fahren oder radfahren, und es wird mir unbeschreiblich, das heißt beschreiblich gleichgültig sein, ob ich rechthaben darf oder Recht habe, und wie Histamin sich trennen läßt). VI Journalisten sind wirklichkeitsnäher als ihre poetischen Brüder. In Hamburg erscheint eine Wochenzeitung, die seit nahezu einem Jahr (genauer: seit dem 1. Januar 1997) in der Haltung vorauseilender Vernunft ihre Texte ausschließlich nach den neuen Regelvorschlägen setzt. Und niemand, der sie liest, merkt irritiert auf, denn so gering, so belanglos ist das Bild der Veränderung. Sie betrifft übrigens, so heißt es, nicht mehr als 0,8 Prozent unserer Wörter. Und da geht es in den meisten Fällen auch noch um Wörter, die wir sehr sparsam gebrauchen. Was aber das doppelte s betrifft als Ersatz des ß, so kennt man es ja längst aus der Lektüre Schweizer Druckprodukte, aus der Tastatur von Computern und Schreibmaschinen. Mit Recht erinnert Konrad Adam (in der FAZ): „Der Streit um die neue Rechtschreibung ist einer um des Kaisers Bart, über den – seine Farbe, seine Länge und sein Aussehen – haben sich die Deutschen aber schon immer ihre Gedanken gemacht, und deshalb sieht es nun so aus, als ginge es in einer Sache, die man auch ganz anders regeln oder weitgehend ungeregelt lassen könnte, um Sein oder Nichtsein“. Im übrigen findet sich alles Grundsätzliche so kenntnisreich wie sachlich in dem Buch von Dieter E. Zimmer, Deutsch und anders. Die Sprache im Modernisierungsfieber (Hamburg 1997). Ließe man, aus dem Felde der Publizistik, Zimmer als denkenden Praktiker und, aus dem Felde der akademischen Gelehrsamkeit, Harald Weinrich als praktischen Denken die Sache in die Hand nehmen: sie käme bald zu einem guten Ende. VII Die rührende Sorge von Eltern, es möchte ihr Kleines nun Schaden nehmen am Gemüt, weil der Schiffahrt ein drittes f hinzugefügt wird und dem Bettuch ein drittes t , beschäftigt nun auch unsere Gerichte – die wahrlich anderes zu tun hätten oder haben –, bis hin zu jenem Gericht im Sächsischen, das in Gestalt eines „Sprachvolks“ eine wahrhaft beunruhigende Größe beschwört. Das Dilemma unserer Gerichte: Einerseits sollen sie Recht sprechen in Verfahrensdingen, denn dafür sind sie zuständig. Andererseits ist aber der Gegenstand des Verfahrens von einer Art, die sich der Zuständigkeit der Jurisprudenz entzieht. Um es Mißverständnisse ausschließend zu sagen: Wofern es der Obrigkeit einfiele, unsere Sprache zu verändern: in ihre Formationen, Fügungen, ihre Struktur und Ausdrucksmöglichkeit einzugreifen mit Hilfe von Erlaß und Gesetz, wäre Widerstand die erste Bürgerpflicht. Denn in Sprache offenbart sich das Wesen eines Volkes, verdinglicht sich seine Natur und Idee. So wissen wir es spätestens seit den Sprachtheorien der Romantik, seit Herder und Humboldt und Jacob Grimm, der tiefer und weiter nachgedacht hat über unsere Sprache und ihr Wesen als je ein anderer, und über den ein Dichter, der wahrlich sein extremer Gegentypus in Leben und Schreiben war, die rühmenden Worte fand: „Der einzige Jakob Grimm hat für die Sprachwissenschaft mehr geleistet als eure ganze Französische Akademie seit Richelieu. Seine deutsche Grammatik ist ein kolossales Werk, ein gotischer Dom, worin alle germanischen Völker ihre Stimmen erheben, wie Riesenchöre, jedes in seinem Dialekte. Jakob Grimm hat vielleicht dem Teufel seine Seele verschrieben, damit er ihm die Materialien lieferte und ihm als Handlanger diente bei diesem ungeheuren Sprachbauwerk. In der Tat, um diese Quadern von Gelehrsamkeit herbei zu schleppen, um aus diesen hunderttausend Zitaten einen Mörtel zu stampfen, dazu gehört mehr als ein Menschenleben und mehr als Menschengeduld.“ So Heinrich Heine 1837. Was jedoch die neuen Regeln vorschlagen, hat eine Veränderung der Sprache weder zur Absicht noch zur Folge. Im Gegenteil: Hier und da lösen sie sogar ein Nachdenken über deren Wesen aus – vor allem wenn sie Freizonen der Entscheidung konzedieren –, sofern sie einleuchtende Stängel schreiben wollen und Quäntchen, und uns nötigen zu hören, daß ein frisch gebackener Bräutigam Lust hat auf frischgebackene Brötchen. Und daß er weit gereist sein muß, um als Weitgereister zu gelten. VIII Kein Eingriff also in die mentale, emotionale und intellektuelle Substanz der Sprachgemeinschaft. Wohl aber Anlaß,sich Gedanken zu machen, was es auf sich hat mit dem Schicksal der Sprache unter dem Diktat des Zeitgeistes. Denn unsere Sprache verrät uns . . . Man darf die Vermutung wagen, daß unsere Sprache in ihrer Substanz, in ihrem Wesen noch nie so gefärdet war wie in unserem, dem Medien- und elektronischen Zeitalter. Die e-mail-Notiz hebt den Schritt und Rhythmus und die lockere Gelassenheit des privaten Briefstils auf. Das Computersignal zerhackt die Syntax, und nichtssagender als ein politisches Statement, das davon ausgeht, daß die Rahmenbedingungen zum Tragen kommen, kann keine Aussage sein. Es ist schwer begreiflich, daß Eltern nach dem Richter rufen, um ihr Kind vor der Vereinfachung der Kommasetzung zu schützen – und doch täglich hören und sehen, wie Dad und Mum mit den Kids shopping gehen, denn das ist trendy und endet in der Spielothek. Eltern, die eine verschmutzte Sprache als selbstverständliche Gegenbenheit hinzunehmen scheinen, in der abgefuckte (abgefackte?) Schrillformeln wie supergeil oder megascharf ätztender Alltagsjargon geworden sind. Und da ist kein treusorgender Vater, ist keine behütende Mutter, die auf die Straße gehen und protestierend aufschreien, und keiner fordert die Anlage von Unterschriftenlisten, darin das Volk sein Begehren kundtut, inmitten solchen Unflats nicht atmen zu können, und zu wollen. Will wirklich niemand begreifen, daß die Sprache in großer Not ist, wir uns in einem Sprachnotstand befinden? Viele Jugendliche, die Nachricht ging soeben durch die Zeitungen, verlassen die Schule als „halbe Alphabeten“, und berauben sich mit einem solchen Defekt der Chance, in den Arbeitsprozeß eingereiht zu werden. Schlimmer: sie verlieren auf diese Weise die Kommunikationsfähigkeit mit anderen, eine Gesellschaft gibt ihren auf Übereinstimmung der sprachlichen Äußerung und ihres Sinnes begründeten Zusammenhalt preis. Die Universitäten klagen, daß Studenten bestimmte Sachverhalte nicht mehr lesend aufnehmen, nicht mehr sprechend oder schreibend angemessen wiedergeben können. Eine Nation droht hinabzutrudeln in eine verquatschte und verstümmelte Sprechweise, in eine Sprachanarchie – und wir streiten uns um das h in Känguruh . . . Was denn soll eine Orthographiereform in einer Gesellschaft, die ihre Sprache als wesentliche Basis von Verstehen und Selbstverstehen wissentlich opfert? Schopenhauer führte einst Klage „über die seit einigen Jahre methodisch betriebene Verhunzung der deutschen Sprache“ (aus dem handschriftlichen Nachlaß). Es würde Schopenhauer, wäre er heute unter uns, gewiß die Sprache verschlagen. Der Autor ist Germanist und Gründer des Wissenschaftskollegs in Berlin. SZ 6.12.1997: Volksbegehren gegen „Schlechtschreibung“ ist ein Bürgerrecht Zu dem Artikel Der Buchstabe im Sprachvolk von Peter Wapnewski in der SZ vom 3. Dezember. „Wofern es der Obrigkeit einfiele, unsere Sprache zu verändern: in ihre Ausdrucksmöglichkeiten einzugreifen . . ., wäre Widerstand die erste Bürgerpflicht.“ Mit dem, was Peter Wapnewski fordert, hat er – ohne es zu wollen – ganz recht (geplante Schreibung: ganz Recht). Denn die sogenannte Rechtschreibreform ist weit tiefgreifender (geplante Schreibung: weit tief greifender), als er annimmt. Wer die Kleinschreibung der brieflichen Anrede „Du“ diktieren möchte, wer die Unterscheidung von schlechtmachen und schlecht machen, von fertig bringen und fertigbringen und zahlloser anderer Begriffe durch Getrenntschreibung vernichtet und damit auch die Aussprache verändert, wer Wörter wie dasein, sogenannt oder zuviel zerhackt und so aus unserem Wortschatz eliminiert (aus einigen Wörterbüchern sind sie schon entfernt) und vorschreiben möchte, daß Schüler „er tut ihr sehr Leid“ schreiben müssen, greift sehr wohl in die Sprache ein. Auch die geplante Verwirrung der Zeichensetzung (man studiere den Paragraphen 77) ist ein Eingriff, der schon jetzt zur Streichung zahlloser Kommata in den meisten neu gesetzten Büchern geführt hat. Wapnewski freilich meint offenbar, daß die mehr als 600 000 Unterschriften gegen die geplanten Veränderungen, unter ihnen die der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller und Germanisten, nur auf „einem der trübsten Gesetze öffentlichen Verhaltens: auf dem der Gewohnheit“ beruhen. Also wären auch Bundespräsident Herzog, Bundeskanzler Kohl, Kinkel, Klose, Scharping und Waigel, die sich alle gegen die Rechtschreibreform ausgesprochen haben (in kleiner Runde bezeichnete sie kürzlich auch eine Ministerpräsidentin als „Scheiß“), nur unbewegliche Gewohnheitstiere, zu faul zum Umlernen? Wapnewskis Reaktion auf die Kritik kommt uns längst bekannt vor. Statt auf ihre Argumente einzugehen, wirft man den Kritikern Bequemlichkeit, „fundamentalistisch sich gebärdendes Eifertum“ und/oder mangelnde Kompetenz vor (die man für sich selbst jederzeit in Anspruch nimmt). Immerhin fragt sogar Wapnewski sich, „ob das Umlernen notwendig war“. Sein Argument dafür ist, daß „schon drei Generationen von Schreibenden“ „unter dem Diktat“ des Duden „stöhnen“. Wenn das so wäre, sollten wir Sekretärinnen, Journalisten usw. Schmerzensgeld zahlen und Engländer und Franzosen wegen ihrer Orthographie Tag und Nacht bemitleiden. Wenn aber die Reform total überflüssig und inhaltlich mißlungen ist und zudem den Neudruck zahlloser Bücher nach sich ziehen und Milliarden kosten würde (dazu sagt Wapnewski wohlweislich kein Wort), dann ist Widerstand doch wohl angebracht. Herr Wapnewski jedoch weiß keine andere Begründung dafür als „die rührende Sorge von Eltern, es möchte ihr Kleines nun Schaden nehmen am Gemüt, weil der Schiffahrt ein drittes f hinzugefügt wird“. Sein billiger Hohn ist keine Antwort auf die Frage, wem das dritte „f“ bei „Schiffahrt“ etwas bringen soll. Es ist genauso überflüssig wie alles andere – und wird noch zusätzlich einiges kosten, zum Beispiel den mehr als 100 Schiffahrtslinien im deutschen Sprachraum (auch das Grundgesetz soll man wohl neu drucken, weil das Wort „Schiffahrt“ darin siebenmal vorkommt?). Wem nützt das alles? Der Jugend jedenfalls nicht. Und daran wird sich auch nichts ändern, wenn jetzt noch ein paar „Verbesserungen“ nachgeschoben werden. Überflüssig bleibt überflüssig, und milliardenteuer wäre auch eine reduzierte Schreibveränderung. Deshalb machen wir von unseren Rechten als Bürger Gebrauch und wehren uns in Niedersachsen, ebenso wie die Schleswig-Holsteiner, mit einem Volksbegehren gegen die geplante „Schlechtschreibung“. Prof. Dr. Carsten Ahrens Elsfleth SZ 10.12.1997: Demokratisches Recht Zu dem Artikel Der Buchstabe im Sprachvolk von Peter Wapnewski in der SZ vom 3. Dezember. Ein Erzeuger wolkiger Wissenschaftslyrik zeigt niedere Regungen – die Haltung gegen den sattsam bekannten Tatbestand bezeichnet Wapnewski als „rührende Sorge“ um „ihr Kleines“, womit er sowohl eine demokratische Selbstverständlichkeit vergackeiert als auch seinen Mangel an Empfindung für menschliche Emotionen bloßstellt. Günther Jakob, Coburg SZ 23.12.1997: Reform ist keine willfährige Einnahmequelle Zu dem Artikel Der Buchstabe im Sprachvolk von Peter Wapnewski in der SZ vom 3. Dezember Was die Zurückweisung der Änderungsversuche an der deutschen Schreibe so zwingend notwendig macht, ist neben dem inhaltlichen Unfug die Art und Weise der Entstehung und Präsentation der Vorschläge als neue Regeln. Wenn eine Kommission nach jahrzehntelanger Beraterei sich gezwungen sieht, jetzt endlich etwas Greifbares dem Publikum vorzuzeigen, ihr dabei die abartigsten Verhunzungen noch gerade unterbunden werden können, so ist das, was bleibt, nur Selbstzweck. Die deutsche Schreibe ist eben keine Grundlage zur Eigendarstellung von Gelehrten unter Ergebnisdruck und ebenso keine willfährige Einnahmequelle für Institute und Verlage. Eine Ablenkung vom Thema Schreibe durch Hinweis auf die zu Recht beklagten Verluste bei der deutschen Sprache ist völlig unpassend. Das ist eine ganz andere Auseinandersetzung. Auch mögen sich Schriftsteller und Lyriker zur Gestaltung ihrer Werke eigenwilliger Schreibweisen bedient haben; wir reden hier jedoch von der Schreibgrundlage für Millionen Menschen. Da ist kein Platz und Sinn für Spielereien. Das Ärgernis ist weiterhin die sogenannte „Reform“ und vor allem die Anmaßung, das Vorgeschlagene überhaupt so zu bezeichnen. Damit muß nun Schluß gemacht werden, und die deutsche Schreibe kann bewährt und unbezweifelt uns in das nächste Jahrhundert begleiten. Michael Zwengel, Neu-Ulm Wem es wirklich um die deutsche Sprache zu tun ist, der sollte Wapnewski dankbar für seine Hinweise auf ihre wirklichen „Verhunzer“ sein. Man muß weiß Gott kein Sprachchauvinist sein, um ihm aus vollem Herzen zuzustimmen. Winfried Heppner, Wertingen Wenn Wapnewski schreibt, die neuen Wörterbücher spiegelten „einen absurden Zirkus wider von Widerspüchen und verwirrenden Ungereimtheiten“ und das „chaotische Bild“ werde zu Recht mißbilligt, und ihm selbst seien die neuen Regeln gleichgültig, er werde sich nicht um sie scheren, wie kann er dann zugleich Eltern, denen sie eben nicht gleichgültig sind, mit seinem Spott überziehen und es bedauern, daß Gerichte damit behelligt werden? Wie kann Wapnewski, nach diesem Verdikt über die neuen Wörterbücher, den Widerstand dagegen als bloßes Beharrenwollen auf alter Gewohnheit („einem der trübsten Gesetze öffentlichen Verhaltens“) anprangern? Isolde Kestermann, München SZ 26.12.1997: Opfer des eigenen blinden Engagements Zu dem Artikel Der Buchstabe im Sprachvolk von Peter Wapnewski in der SZ vom 3. Dezember. Von Zeit zu Zeit überkommt Peter Wapnewski anscheinend das Bedürfnis, der Öffentlichkeit unbedingt mitteilen zu müssen, daß er sich zu den progressiven Geistern in diesem Lande zählt. Möglicherweise, weil man das bei einem angesehenen Vertreter der älteren Germanistik nicht zu vermuten scheint. So überraschte er vor rund 25 Jahren nicht nur die Fachwelt mit seinem Bekenntnis zu den – damals wegen ihrer Angriffe auf das Hochdeutsche genauso heftig wie heute die Rechtschreibreform umstrittenen – hessischen „Rahmenrichtlinien Sekundarstufe I Deutsch“. Und diesmal engagiert er sich, vermeintlich wider eine konservative, von Natur aus reformfeindlich gesonnene Gegnerschaft, ausgerechnet für die Rechtschreibreform der Kultusminister und Kultusbürokraten, obwohl er doch gerade den Reformgegnern als Etikett eine „Tendenz zu einer allgemeinen Verbeamtung des Bewußtseins“ anhängen will. Irgend etwas in seinem Freund-Feind-Bild scheint dabei nicht zu stimmen. Diesen angeblich besonders zur Trägheit und zum Festhalten an der Gewohnheit neigenden Wesen attestiert er nämlich an anderer Stelle nicht nur eine „absurde und gelegentlich an Hysterie grenzende Argumentation“, sondern erstaunlicherweise auch „ein hektisch um sich schlagendes Leben“ und ein schrilles, sich fundamentalistisch gebärdendes Eiferertum. Anscheinend zählen diese Aufgeregten doch nicht bloß zu den Trägen, die zu Hause liegen. Und in dieses etwas einfach gestrickte Erklärungsmodell paßt natürlich auch nicht hinein, daß ausgerechnet die Schriftsteller sich in dieser Sache „zur Verteidigung eines überkommenen Zustands rüsten“. Wenn Wapnewski darin „eine Situation von herber Komik“ sehen will, dann ist er nur ein Opfer seiner engagierten Blindheit und seiner fehlenden Sachkenntnis geworden. Er will nämlich nicht wahrhaben, daß der Streit um die neue Rechtschreibung keineswegs der Streit um des Kaisers Bart ist, und auch um keinen Preis zugeben, daß die von ihm verfochtene These – „Was jedoch die neuen Regeln vorschlagen, hat eine Veränderung der Sprache weder zur Absicht noch zur Folge“ – schlicht falsch ist. In dem von H.-W. Eroms und H. H. Munske herausgegebenen Diskussionsband „Pro und Kontra / Die Rechtschreibreform“ (Erich Schmidt Verlag, Berlin 1997) hätte er anderes in Erfahrung bringen können. Peter Eisenberg stellt zum Beispiel (auf Seite 49) fest: „Die Neuregelung der Orthographie greift ins grammatische System des Deutschen ein, ohne die Konsequenzen hinreichend zu reflektieren“ und beklagt, „daß ausgerechnet Germanisten versucht haben, sich am Deutschen zu vergreifen“. Und Horst Haider Munske kritisiert, daß sich die Reformdebatte viel zu sehr mit Neuschreibungen wie behände, belämmert, Stängel, Zierrat oder Rohheit befaßt, also ans Augenfällige hält und dabei „häufig die viel einschneidenderen Änderungen in den semantischen Grundstrukturen der Groß- und Kleinschreibung und der Getrennt- und Zusammenschreibung“ ignoriert (S. 147). Wenn Peter Wapnewski wirklich zu seiner Aussage steht: „Wofern es der Obrigkeit einfiele, unsere Sprache zu verändern: in ihre Formationen, Fügungen, ihre Struktur und Ausdrucksmöglichkeit einzugreifen mit Hilfe von Erlaß und Gesetz, wäre Widerstand die erste Bürgerpflicht“, dann dürfen wir ihn demnächst – nach der gründlichen Lektüre des Diskussionsbandes – in unseren Reihen willkommen heißen. Günter Loew Lehrerinitiative gegen die Rechtschreibreform Hessen Rodenbach SZ 30.12.1997: Zerstörung von leserfreundlichen Wortbildern Zu dem Artikel Der Buchstabe im Sprachvolk von Peter Wapnewski in der SZ vom 3. Dezember. Peter Wapnewski hebt hervor, daß deutsche Dichter und Denker eine „Sprache von Energie und Geschmeidigkeit, Leuchtkraft und Transparenz“ geschaffen haben, so daß sie „Träger und Instrument der subtilsten Gedanken, leidenschaftlichen Gefühle und zartesten Stimmungen werden konnte“. Aber die Art und Weise, in der sie geschrieben wurde, sei nichts als eine freundliche Beiläufigkeit. Die Orthographie sei nur eine Magd, meint Wapnewski dogmatisch. Das stimmt nicht. Die Reformer haben als Sprachtechnokraten nicht berücksichtigt, daß bei der geschriebenen Sprache sowohl die Augen als Sinnesorgane als auch die Psyche angesprochen werden. Noch im Mittelalter wurden Schriften kunstvoll, liebevoll gemalt, farblich gestaltet und prächtig ausgeschmückt. Die Schrift war ein Kunstwerk. Der optische Gesamteindruck von Wortbildern und die Schriftbildästhetik spielten eine wichtige Rolle. Jean-Marie Zemb weist darauf hin, daß sich die Schrift auch der Lautung annimmt und daß etliche Zeichen, insbesondere die Satzzeichen, das Bild vertonen können und daß ein „inneres Ohr“ den Stil der gestellten Schrift vernimmt (Jean-Marie Zemb, in: Eroms/Munske: Die Rechtschreibreform. Pro und Kontra, 1997, S. 255). Deshalb wird auch eine Zerstörung der leserfreundlichen Wortbildgestaltung von den meisten Bürgern abgelehnt, regt sich Widerstand zum Beispiel gegen die Dreifachkonsonantenschreibung oder die teilweise Abschaffung des „ß“. Widerstand ist die erste Bürgerpflicht, meint auch Wapnewski, wenn die Obrigkeit in die Struktur und Ausdrucksmöglichkeiten, ja in die mentale, emotionale und intellektuelle Substanz eingriffe. Wapnewski hat noch nicht erkannt, daß die Reformer in ihrem blinden Reformeifer gerade das getan haben: Mit ihren willkürlichen Regelkonstruktionen haben sie nicht nur in die Orthographie, sondern nach Metzgerart auch tief in die Grammatik, Semantik (zum Beispiel mit der Getrenntschreibung) und in die Interpunktion eingegriffen. Wie können aber zarte Stimmungen und Gefühle entstehen, wenn die Schrift und Schreibweise so leserunfreundlich verunstaltet sind, daß der Lesende sich ärgert und beim Vortrag ins Stocken gerät, weil er den Sinn nicht immer sofort, sondern erst nach mehrfachem Lesen erfaßt? Die Reform betrifft nur 0,8 Prozent unserer Wörter. Trotzdem sind das keine Bagatellen, nicht nur wegen der genannten Nachteile, sondern auch weil die Reform nicht die versprochene Vereinfachung bringt (die Rechtschreibfehlerquote sinkt keineswegs) und obendrein noch viel kostet. Wehret den Anfängen! Aus dem Vereinfachungswahn und dem Machbarkeitsirrglauben der Reformer soll kein Präzedenzfall als Einfallstor für eine weitere Veränderung und Vermarktung unserer Schriftsprache durch Verlags- und Software-Riesen werden! Manfred Riebe, Schwaig Es ist dankenswert, daß Wapnewski fast eine ganze Seite der SZ bekam, um zu zeigen, aus welchem Urwuchs der Sprache sich die Orthographie entwickelte, welch übertriebene Bedeutung ihr heute zugemessen wird und wieviel dringlicher es wäre, auf Veränderungen und Verunstaltungen der Sprache zu achten. Am Schluß seines Rundumblicks schießt er aber dann doch auf die arglosen Beerenpflücker statt auf bodenaufwühlende Wildsäue. Wenn eine „Reform“ kaum bemerkbar ist, nur 0,8 Prozent der Wörter ändert und insgesamt nichts bessert, dann ist es nicht Trägheit, sondern Vernunft, sie abzulehnen. Natürlich spürt auch Wapnewski, wieviel Sprengstoff in den unüberlegten Vorschlägen, zum Beispiel zur Getrenntschreibung, steckt (nicht nur für frischgebackene Germanisten!). Hätte er doch das Pulver seines Feuerwerks gebündelt, um die erschreckend geringe Sensibilität der Kommission aufs Korn zu nehmen und die Bereitschaft unserer Behörden, eine große Reform anzuordnen, nur weil jemand behauptet hat, damit würde alles einfach – wie einst bei der Mengenlehre! Peter Rauschmayer, München |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 30.06.2008 um 01.59 Uhr |
|
Der Artikel von Peter Wapnewski sprüht nur so von Arroganz: "Die rührende Sorge von Eltern, es möchte ihr Kleines nun Schaden nehmen am Gemüt, weil der Schiffahrt ein drittes f hinzugefügt wird und dem Bettuch ein drittes t, ..." Eltern sorgen sich doch nicht deshalb und klagen vor Gericht, weil sie glauben, ihre Kinder könnten etwas Vernünftiges nicht lernen. Sie ziehen vor Gericht, weil sie ihre Minder-"Jährigen" und damit die ganze Gesellschaft vor der "behänden" Rückentwicklung in die Zeit des "unterwerffen" (wie Wapnewski Schiller zitiert) bewahren möchten. Wapnewski: "Die Motive des Protestes sind simpler Natur. Der Widerstand resultiert aus einem der trübsten Gesetze öffentlichen Verhaltens: auf dem der Gewohnheit." Woher nimmt er diese Behauptung? Ich habe Reformgegner fragen hören: Welchen Vorteil bringen uns drei aufeinanderfolgende s, außer daß sie das Schriftbild verschandeln? Aber niemals habe ich gehört: Ich habe Schiffahrt schon immer mit zwei f geschrieben, basta!. Eines seiner Argumente ist mir ganz neu. Herr Wapnewski meint, die RSR komme nur wegen der "mangelhaften psychologischen Vorbereitung" schlecht an. Wenn ich das lese, fühle ich mich in den makabren Politunterricht aus meiner DDR-Wehrpflichtzeit zurückversetzt. Was sind das nur für Argumente? Warum äußern sich Leute wie "Kritikaster", der hier auch mitliest und gelegentlich behauptet, sachlich diskutieren zu wollen, nicht mal zu dieser Art der Argumentation? Oder zu einem ganz sachlichen Argument, z.B. diesem: Es gibt in der herkömmlichen Schreibweise dank der einfachen Dreikonsonantenregel (Vokal oder weiterer Konsonant folgt), dank tz, ck und ß, relativ wenige unschöne Zusammentreffen von 3 Konsonanten. Die Reform bringt uns nicht nur helllila Stillleben, sondern in Verbindung mit der neuen ss-ß-Regel den häufigsten Dreifachkonsonanten überhaupt, den es vorher gar nicht gab (Nussschale, Esssaal, ...). Angeblich soll das Stammprinzip gelten. So wie bei (m/fr/verg)essen – (m/fr/verg)aß, reißen – riss beißen – biss, sch..ßen – sch.ss, schießen – schoss? Welches sind wirklich die Vorteile der zwei bzw. drei ss? Ist das vielleicht nicht sachlich genug? Na gut, das Beispiel mit den Punkten nehme ich heraus. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 30.06.2008 um 18.47 Uhr |
|
Die Macht der Gewohnheit hatte immerhin bewirkt, daß Leute nach acht Klassen Volksschule ihr Leben lang ziemlich richtig schreiben konnten, ohne einen Auffrischungskurs zu benötigen, höchstens für neue Fremdwörter. Bei Wenigschreibern hat die für sie gedachte Reform nur zu mehr Fehlern geführt.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.07.2008 um 18.08 Uhr |
|
Wapnewski hat ja auch zu dem Sammelband "Deutsch Global" (hg. von Hilmar Hoffmann, Verlag Dumont 2000) einen denkwürdigen Aufsatz beigesteuert, ein unqualifiziertes Schimpfen auf den "Sprachverfall". Das ist seinerzeit auch in Rezensionen gebührend vermerkt worden. Es lohnt nicht, auf einen solchen Unsinn einzugehen, aber man kommt doch ins Nachdenken, was manche Leute sich erlauben zu können meinen.
|
