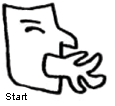


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
09.01.2016
Sprachverführtheit
Logisch-semantische Abwege
Bei Eisenberg zum Beispiel werden getauft und entdeckt zu den "absoluten Adjektiven" gerechnet. Dazu einige kritische Gedanken:
Bei getauft richtet sich die Analyse nach religiösen Vorgaben. Die Taufe „prägt“ nach christlicher Auffassung den Täufling, bringt ihm also eine Eigenschaft bei (character indelebilis) wie einer Münze. Aus der Sicht der Ungläubigen besteht das Getauftsein hingegen in der Einfügung in einen sozialen Zusammenhang: im Wissen anderer Personen, daß jemand dem Taufritual unterzogen worden ist. Dieses Wissen teilt der Getaufte meistens, aber nicht notwendigerweise und nicht im Säuglingsalter; es kann auch in schriftlichen Quellen niedergelegt sein.
Entdeckt zu werden kann für ein Land und dessen Bewohner Folgen haben, aber entdeckt zu sein ist keine Eigenschaft. Wenn eine Tierart entdeckt wird, dann wissen einige Menschen fortan, daß es diese Art gibt; sie verändern sich also durch die Entdeckung, auch wenn der Ausdruck suggeriert, daß die Tierart eine Eigenschaft hinzugewonnen habe. Ebenso verhält es sich mit „Bekanntheit“.
Die Adjektive entdeckt und bekannt werden zwar auch ohne nähere Bestimmung benutzt, aber es ist immer aus der Situation oder dem Kontext mitverstanden, durch wen etwas entdeckt oder wem es bekannt ist.
Diese Kritik läßt sich auf sehr viele Wörter anwenden, die unter dem Eindruck ihrer Grammatik logisch-semantisch gedeutet werden.
| Kommentare zu »Sprachverführtheit« |
| Kommentar schreiben | älteste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.11.2025 um 07.49 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1651#53068 Hans Hörmann strebte sogar nach einer „Theorie der Handlungsakte Meinen und Verstehen“ (S. 58) Das ist zweifellos Unsinn. Übrgens kann man sich zwar anstrengen, etwas zu verstehen, aber nicht etwas zu meinen. Daher auch: "Verstehen Sie mich doch!" Aber nicht: "Meinen Sie doch mal etwas anderes!" Meinen und Verstehen sind weder Handlungen, noch sind sie symmetrisch aufeinander bezogen. Hörmann hat seinerzeit die amerikanische Forschung in Deutschland bekannt gemacht, leider zu einem ungünstigen Zeitpunkt ("Chomskys grandiose Leistung", S. 497), aber gerade die populäre Schreibweise ("Meinen und Verstehen" erschien bei Suhrkamp) hat viel Schaden angerichtet. Der zaghafte Ansatz zur Kritik (weil Hörmann eben doch in europäischer Tradition stand) wurde wie bei Theo Herrmann gleich wieder zugeschüttet, weil er außerhalb der kognitivistischen Mode stand. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.09.2025 um 17.34 Uhr |
|
„Eines der charakteristischsten Merkmale natürlicher Sprachen (…) ist ihre Fähigkeit, sich auf sich selbst zu beziehen oder sich selbst zu beschreiben. Für dieses Merkmal oder Eigenschaft (!) der Sprache werden wir den Ausdruck ‚Reflexivität‘ benützen. Sprache kann sozusagen auf sich selbst zurückgewendet werden.“ (John Lyons: Semantik I. München 1980:19) Das ist in mehrfacher Hinsicht mißlich ausgedrückt. Beschreiben kann man nur durch Sprache, und das können Tiere nicht. Daß Sprache „sich selbst beschreiben“ kann, ist eine Mystifikation der banalen Tatsache, daß man alles beschreiben kann, folglich auch Sprache. Es ist nichts von „Zurückwendung auf sich selbst“ zu erkennen, wenn ich u. a. das Sprachverhalten untersuche. Das Bild ist irreführend. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.07.2025 um 08.15 Uhr |
|
Laut Dudengrammatik sind bewirken, verursachen, veranlassen "explizit kausative Vollverben". Nach dieser Logik wäre helfen ein Hilfsverb und kopulieren ein Kopulaverb. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.12.2024 um 08.10 Uhr |
|
In allem, was mir gefällt, muß es etwas Gemeinsames geben, das Mir-Gefallende an sich oder die Idee des Mir-Gefallens. Das ist die Widerlegung des Platonismus und mein Beitrag zum Universalienstreit. Eine andere Version hier: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1651#52118 |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.06.2024 um 17.50 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1651#53384 Bei anderen geschickten Bewegungen, etwa dem Kauen, Nähen, Radfahren würde man nicht nach etwas dem „Lexikon“ Entsprechenden suchen, nach einem „Schatz“ analog dem Wortschatz. Die ganze Speichermetaphorik ist nur vom „Wortschatz“ aus zu verstehen. Man sucht nicht nach einem Speicher für die Läufe, Triller, Kadenzen, Akkorde im Geist oder Hirn eines Pianisten. Sprache dient angeblich der „Externalisierung des Denkens“ (George A. Miller: Wörter. Streifzüge durch die Psycholinguistik. Frankfurt 1995:16). In Wirklichkeit dient Denken der Internalisierung des Sprechens. Natürlich kann Miller nicht sagen, wie man das macht, Gedanken externalisieren. Das Internalisieren lernen die Kinder früh: „Behalt es für dich!“ |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.06.2024 um 05.22 Uhr |
|
Psychologen, besonders die „kognitiven“, arbeiten gern mit Sprachmaterial, Selbstauskünften usw. Sprachliche Verhaltenseinheiten haben Vor- und Nachteile. Sie sind standardisiert und lassen sich jederzeit und überall replizieren, was die Versuchsanordnungen vereinfacht und vergleichbar hält (vgl. schon Ebbinghaus mit seinen Silben usw.). Andererseits ist Sprachverhalten „zu hoch“ für eine empirische Psychologie, zu komplex, zu kulturabhängig/historisch. Man weiß nicht recht, was vor sich geht, wenn der Proband Wörter oder Sätze „vergleicht“ usw. Es ist vom Drücken eines Knopfes (oder Picken auf eine Scheibe...) sehr weit entfernt. Darum wird Sprechen ja auch als „geistige Operation“ bezeichnet, was man vom Picken auf eine Scheibe nicht leicht sagen würde. So erklärt es sich, daß in psychologischen Standardwerken die Tiere nicht mehr vorkommen (z. B. auch in John R. Anderson: Kognitive Psychologie. Heidelberg 1989). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.06.2024 um 06.29 Uhr |
|
In den einflußreichen Werken von Philip N. Johnson-Laird kommt Chomsky viel öfter vor als etwa Skinner (dieser nur als Karikatur), und Tiere werden praktisch überhaupt nicht erwähnt, sehr im Gegensatz zu klassischen Lehrwerken der Psychologie. Niemand scheint sich darüber zu wundern. Das zeigt, wie weit der Kognitivismus (also die scholastische rationale Psychologie) die akademische Welt schon wieder beherrscht. Durch den Bezug auf die Computersimulation wird der reaktionäre Charakter des Geredes vom "Geist" verschleiert.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.06.2024 um 04.26 Uhr |
|
Was "Geist" und "mental" heißen, die auf jeder Seite vorkommen, wird bei Johnson-Laird nie definiert, es sind auch keine Stichwörter im Register. Der Behaviorismus habe den Geist geleugnet, aber inzwischen sei er rehabilitiert. Anscheinend hält Johnson-Laird die erfolgreiche Computer-Simulation des Verhaltens (des Denkens, wie er meint) für den Beweis, daß der Geist existiert. Er verhalte sich zum Gehirn wie das Programm zum Computer. Drei Ereignisse sollen den Behaviorismus erledigt haben (Philip N. Johnson-Laird: Der Computer im Kopf. München 1996): 1. Nach Lashley könne das Sprechen nicht das „Ergebnis einer einzigen Assoziationskette sein“. (29) 2. Chomsky habe bewiesen, daß Sprache nicht durch die von den Behavioristen angenommene Finite-state-Grammatik beschrieben werden könne. (349ff.) 3. Miller habe gezeigt, daß „hierarchische Planung im mentalen Geschehen eine zentrale Rolle spielt“. (29) Das populäre Buch von Miller/Galanter/Pribram wird angeführt. Zumindest Skinner hat sich in keiner der drei Unterstellungen wiedererkannt. Auch George Millers berühmte Rechnung wird wiedergegeben: 14 Wörter können auf eine Milliarde Arten kombiniert werden usw. (352f.) Auch das soll gegen Skinner sprechen. Der Leser wundert sich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.05.2024 um 07.47 Uhr |
|
Das Denken ist natürlich kein Gegenstand der Psychologie. Wir haben es am Leitfaden bestimmter Redeweisen konstruiert (erfunden), allgemein gesagt: der logischen. Logik ist die Ordnung bestimmter Typen von Sprachverhalten, nämlich der agonalen Dialoge des Behauptens und Rechthabens. Syllogismen sind Beweistechniken, nicht Denktechniken. Bei Platon und Aristoteles sieht man es ja noch, Ernst Kapp hat es wieder in Erinnerung gerufen und das tausendjährige Mißverständnis beseitigt. Solche Dialoge sind selbst eine kulturelle Erscheinung mit einer Geschichte und komplexen Bedingungen. Was geht im Kopf oder Geist eines Menschen vor, der vor einem Café auf jemanden wartet usw.? (Beispiel von Johnson-Laird) Das ist zur Zeit eine sinnlose Frage. Besser wäre: Was geht im Kopf eines Menschen vor, der seine Artikulationsorgane in einer bestimmten Weise bewegt, unter der Steuerung durch ungemein komplexe Bedingungen in der Umgebung und Vorgeschichte? Was zum Beispiel ein „Café“ ist, läßt sich nur durch weitausholende Darlegungen erklären. Cafés sind Teil einer speziellen Lebensform. Einem Besucher vom Mars könnte man es nicht leicht erklären, aber es gibt auch Erdenbewohner, die es nicht kennen, und auch ein Schimpanse könnte zwar lernen, sich zu bestimmten Zeiten in ein Café zu setzen, aber es hätte trotzdem keinen Platz in seinem Leben wie in unserem. Man kann naturlich Schalttafeln des Denkens anfertigen und in einen Kasten "Café" schreiben, aber damit entfernt man sich immer weiter von wirklicher Psychologie, und an eine physiologische Ratifizierung ist gar nicht zu denken. (Ich notiere das beim Wiederlesen von Johnson-Laird und drücke mich vielleicht arg undeutlich aus für jemanden, der solche ärgerlichen Texte nicht vor sich hat.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.05.2024 um 05.04 Uhr |
|
Philip N. Johnson-Laird nimmt die Rede von „self-awareness“, „self-reflection“, „self-understanding“ usw. wörtlich und postuliert im Geist bzw. Gehirn einen computationalen rekursiven Mechanismus, der das erklärt. Das Gehirn enthalte ein Modell seiner selbst, auf das es sich „bezieht“ (ein unerklärter Begriff aus der Alltagssprache). („A computational analysis of consciousness“ in Anthony J. Marcel/Edoardo Bisiach, Hg.: Consciousness in contemporary science. Oxford 1988:357-368) Nebenbei: Ich halte es außer der Sprachverführtheit durch das "selbst-" auch für einen Fehler, die logische Analyse eines Problems und seiner Lösung und die darauf aufbauende Computersimulation als Psychologie auszugeben. Aber das gehört zu einer umfassenden Kritik des Kognitivismus. Wenn die Simulation angeblich im Hirn ablaufender Prozesse dann auch noch mit so alltagsnahen Begriffen arbeitet wie angedeutet, müßte eigentlich jeder die Lächerlichkeit einsehen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.04.2024 um 07.08 Uhr |
|
Verständigung ist nur möglich, wenn der Hörer versteht, was der Sprecher meint. Daher die Illusion, es gebe ein für die Beteiligten identisches Drittes, eben das Gemeinte und Verstandene. Das ist aber nur eine Redeweise. In Wirklichkeit kann man das Gemeinte und das Verstandene gar nicht vergleichen. Meinen und Verstehen sind komplementär, nicht identisch. Sie haben für jeden Beteiligten eine spezifische Funktion. Nur so ist Verhaltenskoordination möglich. Der Sprecher verhält sich kommunikativ, und der Hörer reagiert darauf in konventioneller Weise situationsgerecht. Wir erfassen das erfolgreiche Zusammenspiel mit der Hilfskonstruktion „dasselbe meinen“. Das funktioniert gut, man darf nur nicht philosophierend mehr daraus machen, als drinsteckt. So sind gar manche Sachen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.04.2024 um 04.53 Uhr |
|
Für Hans Hörmann sind Meinen und Verstehen in phänomenologischer Tradition „Akte“ des Menschen (Meinen und Verstehen. Frankfurt 1976:9; ähnlich in Einführung in die Psycholinguistik. Darmstadt 1991:55); das ist offensichtlich verfehlt. Meinen ist kein Verhalten und erst recht keine Handlung. Diesen Fall von "illustrierter Grammatik" findet man oft. Die Deutung wird aus dem aktiven Verb herausgesponnen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.11.2023 um 05.23 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1651#38933 Daß die sprachliche Form oft die "logische Form" eines Satzes verdeckt (wie man später sagte), dürfte Skinner durch Russell gelernt haben, dessen "Philosophy" für den angehenden Psychologen Skinner der wichtigste Anstoß war, sich dem Behaviorismus zu verschreiben (noch mehr als Watson und Pawlow). So berichtet er es im zweiten Band der Autobiographie. Dort zitiert er auch aus einem Brief an Fred Keller von 1940 jene Unterhaltung mit Wolfgang Köhler: „I suddenly asked him if, when you looked at a familiar picture, the familiarity was part of the perceptual pattern. He got pretty flustered for a moment, then rallied and said yes. When I contended the familiarity could not be in the stimulus but was obviously related to the past experience of the observer, he said, in plain language that surprised me, that he didn’t care where the thing came from genetically (i.e., developmentally). If this is what they’ve been saying all along I’ve had the wrong idea.“ (The shaping of a behaviorist. New York 1979:246) Bekanntheit ist keine Eigenschaft, aber die Gestaltpsychologen sind wie die Phänomenologen kaum von ihrer Sprachverführtheit abzubringen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 11.08.2023 um 23.02 Uhr |
|
Ich denke, die beiden Beispiele sind unterschiedlich gebildet: Die Voraussetzung zwingt tatsächlich jemanden, etwas zu tun. Darum ist der Satz in Ordnung: eine zwingende Voraussetzung Aber das Zertifikat verpflichtet niemanden. Es ist das Gesetz, die Verordnung, die verpflichtet: ein verpflichtendes Gesetz (nicht Zertifikat) |
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 11.08.2023 um 22.57 Uhr |
|
Ein interessanter Fall. Im Niederländischen hieß das schon immer verplicht (Partizip II von verplichten = verpflichten). Das verplicht veld in einem Formular ist ein Pflichtfeld, und die verplicht nummer ist eine Pflichtübung. Ansonsten standen früher als Übersetzung vor allem vorgeschrieben und obligatorisch zur Verfügung. Irgendwann (vor zwanzig Jahren?) kam verpflichtend hinzu, aber anders als dem niederländischen verplicht haftet dem neuen deutschen Pendant im schwerfälligen Partizip I etwas Bürokratisches an. Doch egal ob Partizip I oder Partizip II, immer trifft die Pflicht nicht das Ding, sondern die Person.
|
Kommentar von Christof Schardt, verfaßt am 11.08.2023 um 19.08 Uhr |
|
Ein gültiges Zertifikat ist also zwingende Voraussetzung. Aber halt, da haben wir es schon wieder: "zwingende Voraussetzung". Im Prinzip dieselbe sprachlogische Umstimmigkeit, und doch geht es einem leicht von der Zunge, es ist klar, was gemeint ist, und eine korrekte Alternative ist gar nicht leicht zu finden. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 11.08.2023 um 18.36 Uhr |
|
"Bereits gestern wurde bekannt, daß dem Gebäude ein verpflichtendes Sicherheitszertifikat fehlte." (Sprecherin in "Brisant" im Ersten, 11.8.23) M. E. ist das ungrammatisch. Ein Gesetz zur Zertifizierung bzw. zum Zertifikat ist verpflichtend, aber nicht das Zertifikat, das Zertifikat verpflichtet niemanden und zu nichts. Eine Bekleidungsordnung ist verpflichtend, aber die Kleidung ist es nicht, sie verpflichtet nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.08.2023 um 05.56 Uhr |
|
Zum "character indelebilis" des Getauftseins (Haupteintrag) könnte man den Fall Edgardo Mortara heranziehen, den ich in einem anderen Zusammenhang schon erwähnt habe. Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Edgardo_Mortara
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.09.2022 um 07.41 Uhr |
|
„Bewußtseinszustände haben immer einen Inhalt.“ (John R. Searle: Die Wiederentdeckung des Geistes. München 1993:103) Was sind Zustände mit einem Inhalt? Außerdem sollen diese Zustände auf etwas gerichtet sein bzw. von uns auf etwas gerichtet werden: „Wir können einen Geisteszustand auf einen anderen richten...“ (ebd. 165) Das alles umschreibt nur den Gebrauch von transitiven Verben. Die philosophierende Überhöhung ist einfach Unsinn.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.03.2022 um 07.02 Uhr |
|
Homöopathie: Die Verdünnung D 400 bzw. C 200 „entspräche einem Molekül der Ausgangssubstanz im 10hoch320fachen des gesamten beobachtbaren Universums“. Geliefert wird aber auch D 1000. Die Leidenschaft für große Zahlen erinnert an hinduistische Konfabulationen. Nachdem man das Verdünnen zum Potenzieren umbenannt hat, kann man sich einbilden, es mache ein Heilmittel immer mächtiger. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.02.2022 um 13.58 Uhr |
|
Bei diesen terminologischen Festlegungen müßte man den theoretischen Hintergrund heranziehen. Ich habe hier nur referiert, ohne etwa Gallmanns Begriffe übernehmen zu wollen. Kernpunkt: kein Pronomen!
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 18.02.2022 um 13.45 Uhr |
|
Fokuspartikeln? Wie ändert oder bestimmt selbst denn den Fokus? Meines Erachtens gar nicht, der Fokus ist bereits vollständig festgelegt. Selbst und selber sind eigentlich immer redundant, sie dienen nur der besonderen Betonung. Mit der Bezeichnung als Gradpartikeln oder Betonungspartikeln könnte ich mich eher anfreunden. Nur als Erstglied von Zusammensetzungen sind sie nicht direkt redundant, aber trotzdem nicht notwendig, denn alle diese Zusammensetzungen hätten auch z. B. mit echten Pronomen o. a. gebildet werden können. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.02.2022 um 08.33 Uhr |
|
Noch einmal zu "Selbstgespräch": Alle Begriffe mit „selbst-“ sind problematisch, weil sie die Frage aufwerfen „wer wen/wem?“. Es gibt in den modernen Sprachen immer mehr solcher Ausdrücke, vor allem in der Populär- und Beratungspsychologie, dazu Anweisungen, was man alles mit sich selbst anstellen soll, um gesund, erfolgreich und glücklich zu werden. Die Wörterbücher führen Hunderte von Zusammensetzungen mit selbst- an, dazu kommen die Fremdwörter mit auto- (größtenteils unklassische Neubildungen). „Selbstkompetenz“ ist die Krone aller anderen „Kompetenzen“, die im Anschluß an Heinrich Roth das Bildungsziel der deutschen Schule geworden sind. Die Philosophie kennt den Begriff der „Reflexivität“, der ein Sondermerkmal des Menschen bezeichnen soll. Auch der Behaviorismus diskutiert immer wieder über die Möglichkeit der „Selbstverstärkung“ und kämpft mit dem begrifflichen Problem der „Selbststeuerung“, weil es schwierig oder unmöglich ist, diesen Begriff oder gar die Ansetzung verdeckten Verhaltens mit dem Standardmodell der Konditionierung zu vereinbaren. Man sollte sich jedoch von der Faszination des sprachlichen Elements selbst lösen und jeweils untersuchen, was wirklich vorliegt. Die Auskunft, Subjekt und Objekt eines Aktes seien in diesem Fall identisch, ist tautologische Wortemacherei. Zum Sprachlichen: Die erstarrte Genitivform selbs-t – um den Zungenlöselaut t erweitert und in der Nebenform selber – ist kein Pronomen, wie oft behauptet wird, sondern eine Identitätspartikel (mit anderer Betonung, nur in der Form selbst und meist in anderer Stellung auch Gradpartikel mit der Bedeutung ‚sogar‘). In der Dudengrammatik von 2005 stellt Peter Gallmann zu Recht fest: „Die Wortformen selbst und selber sind keine Pronomen, sondern Fokuspartikeln.“ (S. 298) Er widerspricht damit den Wörterbüchern aus dem gleichen Hause. In der Diskussion um die Rechtschreibreform hatte das Wort einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil die Reformer irrigerweise glaubten, etwas zu den beiden gleichbedeutenden, aber verschieden gebildeten Wörtern selbständig und selbstständig sagen zu müssen – einem alten Thema der Schulmeister, über deren pedantischen Streit schon das Deutsche Wörterbuch (Grimm) Auskunft gab. Das hatte mit Rechtschreibung nichts zu tun, sondern war eine Frage der Lemmatisierung beider Formen in normativen Wörterbüchern. Wie kann die „Reflexivität“ entmystifiziert werden? Das ist von Fall zu Fall durch eine unvereingenommene Bedeutungsanalyse zu entscheiden. Was heißt zum Beispiel sich selbst helfen? Es heißt nicht, daß ich mir selbst zu Hilfe komme, sondern daß ich ein Problem ohne fremde Hilfe löse. Wenn man es so formuliert, ist darin von einer Rückwendung meiner selbst auf mich selbst keine Spur mehr enthalten. Ein Problem, das durch bloße Umformulierung verschwindet, ist ein Scheinproblem; das sieht man auch an den folgenden Beispielen. Ein Autokrat oder Selbstherrscher nimmt nicht Bezug auf sich selbst und herrscht auch nicht über sich selbst, sondern herrscht allein, ohne andere. Selbstzahler heißen so, weil kein anderer für sie zahlt. Ein Selbstläufer schafft es allein, ohne fremde Hilfe. Was heißt über sich selbst nachdenken? Wenn man fragt, wer hier über wen nachdenkt, ist man schon ein Opfer der sprachverführten Fehldeutung. Ebenso sich selbst erkennen: Erkenne dich selbst! als Inschrift am Apollotempel in Delphi war eine Warnung vor gottloser Hybris. Auch die erwähnte „Selbstverstärkung“ in der behavioristischen Psychologie besteht darin, sich ohne Zutun eines anderen so zu verhalten, daß das gleiche Verhalten wahrscheinlicher wird. Daran ist nichts Reflexives. Was ich verstehe mich selbst (nicht mehr) bedeutet, würde eine ausführlichere Untersuchung erfordern; es ist aber sicherlich etwas anderes ist als das Verstehen oder Nichtverstehen einer Person, die man zufällig selbst ist. Selbstbeobachtung wird oft als Synonym von Introspektion gebraucht; beide Ausdrücke sind in gleicher Weise metaphorisch: Introspektive Berichte „über mich selbst“ sind in Wirklichkeit Aussagen, die nur ich und kein anderer machen kann. Selbstbetrug und Selbsttäuschung (vgl. er macht sich etwas vor) sind Irrtümer, für die man nach allgemeiner Auffassung selbst verantwortlich ist, kein anderer. Axel Hacke (SZ Magazin 18.2.22) macht sich über Redensarten wie „sich selbst besiegen“ lustig und erinnert daran, daß der vielgelobte Sieg über sich selbst ja immer auch eine Niederlage ist. Jeder weiß, was gemeint ist – nur die Philosophen nehmen es wörtlich und reden von „Reflexivität“. Wer sich selbst besiegt, läßt sich – ohne von anderen dazu gezwungen zu werden – von Motiven steuern, die als höherwertig anerkannt sind. Es ist nicht gleichgültig, ob man die volkstümliche Rede vom „Selbstgespräch“ aus ihrer gewöhnlichen Umgebung herauslöst und in gelehrten Worten zum „Mehrinstanzenkonzept der Person“ verfremdet, als gäbe es ein wohlgeordnetes System von „Instanzen“, dem sich die fragliche Selbstbezüglichkeit problemlos einfügen ließe. Man kann bezweifeln, daß hinter der Alltagsformel vom „Sprechen mit sich selbst“ überhaupt ein einheitliches Konzept steht. Solche Alltagsformeln, die wir als transgressive Übertragungen verstehen, dienen der Lösung lokaler Probleme, sind nie systematisiert worden und ergeben daher keine konsistente und definierbare Theorie. Was ein „Sprechen mit sich selbst“ alles einschließen würde, wenn man es wörtlich verstünde, ist kaum auszudenken: Die beiden „Instanzen“, zwei Seelen in einer Brust, müßten nicht nur numerisch verschieden sein – an sich schon eine gewagte Annahme, die an die obsolete medizinische Metaphorik der „multiplen Persönlichkeit“ und des „Spaltungsirreseins“ („Schizophrenie“) erinnert –, sondern sich auch wie richtige Personen unterscheiden: Wissensstand, Vorgeschichte, Interessen, Ansichten und Absichten müßten verschieden sein, damit überhaupt ein Gespräch in Gang kommt. Wenn zwei Personen einander so gleich wären, daß die eine immer schon wüßte, was die andere sagen wird (und wie), könnten sie sich nicht unterhalten. Wo kein wirklicher Partner vorhanden ist, dem wir mit Verständlichkeit und Überzeugungskraft entgegenkommen müssen, können wir uns die sonst üblichen grammatischen und rhetorischen Techniken sparen: funktionale Satzperspektive, Beweisstrategien (Logik) usw. Salopp gesagt: Von uns selbst wissen wir, was wir sagen wollen und daß wir recht haben. Das heißt nicht, daß wir bei Bedarf nicht ebenso elaboriert innerlich wie äußerlich sprechen würden. Ein Selbstgespräch im Wortsinn kann es aber nicht geben. Die Gründe unserer Ablehnung dieses Konzepts hängen nicht vom Appell an die eigene Erfahrung ab wie sonstige Evidenzbeweise aus der „Introspektion“. Wir reagieren auf unsere innere Rede, was immer man darunter versteht, keineswegs so wie auf die Rede anderer Personen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.05.2021 um 04.31 Uhr |
|
Die meisten Menschen sind doch immer noch in Familien eingebunden. Meine Frau, die mich auf diesen Aspekt gebracht hat, hat sich sehr darum bemüht, daß ihre Mutter möglichst bald geimpft wird, und die Anmeldung war mühsam genug (ich habe darüber berichtet). Warum sollte sie auf ihre Mutter neidisch sein? Über einen Impfdrängler könnte man sich ärgern, aber so viele davon gab es bestimmt nicht, und "Neid" wäre auch nicht der treffende Ausdruck. Es wäre nicht das erstemal, daß die Journalisten etwas seitenfüllend bekakeln, was es nur in ihrer Einbildung gibt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.05.2021 um 09.05 Uhr |
|
Es gibt das Wort Impfneid, aber ob es auch die Sache gibt, ist zweifelhaft. Immerhin, man kann ja mal ein paar Wochen lang über die Neiddebatte schreiben, die angeblich Deutschland bewegt. Da lobe ich mir den trefflichen Axel Hacke (SZ Magazin). Er hat von jemandem gehört, der von jemandem gehört hat, der schon geimpft ist: der hatte aber "irgendwie ganz tolle Vorerkrankungen". Wenn das kein Neid ist! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.02.2021 um 16.34 Uhr |
|
Im Mannheimer Modell von Herrmann/Grabowski, das ich vor einem Vierteljahrhundert kritisert habe, wird der Sachverhalt, daß eine Strumpfhose etwas kostet, als "Protoinput" so formuliert: HAT.EIN (STRUMPFHOSE, PREIS) Man scheint das also für eine "Haben-Beziehung" zu halten. In Wirklichkeit geht es darum, daß Menschen bereit sind, für eine Strumpfhose soundsoviel Geld auf den Tisch zu legen. So naiv ist das ganze Modell. Pseudoformalisierung unverstandener Gegenstände. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.09.2020 um 14.25 Uhr |
|
In den indogermanischen Sprachen (auf diese beschränken wir uns in dieser ganzen Untersuchung) kann eine Aussage drei verschiedene Formen haben, je nachdem, ob ein Verbum, ein Substantiv oder ein Adjektiv als Prädikat steht (wobei im Deutschen zum Substantiv und Adjektiv die sog. Kopula bin, bist, ist usw. hinzutritt): Der Löwe brüllt. Der Löwe (ist) ein Raubtier. Der Löwe (ist) gelb. Der Sinn dieser Aussagen ist dadurch verschieden, daß das eine Mal gesagt wird, was das Tier tut, das andere Mal, was es ist, das dritte Mal, was (für eine Eigenschaft) es hat. Es ist offenbar, da es außer Verbum, Substantiv und Adjektiv keine andere Wortform gibt, die im Prädikat stehen kann, daß wir einen Sachverhalt nur in diesen drei Formen beschreiben können: a wirkt b, a ist b, a hat b. Oder anders ausgedrückt: ein Sachverhalt ist für uns nur sinnvoll, insofern wir ihn in einer dieser drei Formen denken können. (Bruno Snell: Der Aufbau der Sprache. Hamburg 1952:15) Das wollen wir uns einmal genauer ansehen. „Der Löwe brüllt“ dürfte ohne Kontext wohl als aktuelle Aussage über das Verhalten eines Tiers, etwa im Zoo, verstanden werden. Daß er dabei etwas „wirke“, ist sonderbar ausgedrückt, aber lassen wir das auf sich beruhen, jedenfalls geht es um ein Tun. „Der Löwe ist ein Raubtier“ bezieht sich ebenfalls auf das Verhalten und sagt, daß Löwen (generisch) Wirbeltiere erbeuten und verzehren, weshalb sie auch Carnivoren heißen. (Ausnahmen sollen außer Betracht bleiben.) „Der Löwe ist gelb“ bezeichnet zwar eine Eigenschaft, die der Löwe „hat“, aber dieses Haben (das auch im Wort „Eigenschaft“ steckt) ist nur eine konventionelle Ausdrucksweise. Eigentlich geht es darum, daß der Löwe gelb IST. (In Wirklichkeit ist das keine treffende Farbcharakterisierung, wie wir schon bei Lewitscharoffs papiernem Blumenberg-Löwen gesehen haben.) Snells Einteilung überzeugt also ganz und gar nicht und ist als Grundlage der weiteren Überlegungen nicht geeignet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.08.2020 um 05.12 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1651#38783 usw. Es ist völlig unmöglich, aus den Lebensäußerungen, Texten, Redeweisen oder gar bloßen Sprachformen einer Gesellschaft deren „Weltbild“ oder „Menschenbild“ zu erschließen. Was wir sagen oder „denken“, sind lokale Problemlösungen, die wir nie zu einem konsistenten System zusammenbringen müssen oder auch nur könnten. Es ist ein Konglomerat aus religiösen Residuen verschiedener Zeiten, Schulwissen, Praxiskönnen usw. Das gleiche gilt selbstverständlich und erst recht für ferne und vergangene Gesellschaften, von denen wir nur Bruchstücke kennen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.04.2020 um 07.40 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1651#42939 Bei gleichgültig gibt es noch eine Besonderheit, auf die auch das Deutsche Wörterbuch hinweist: eine Verschiebung von die Sache ist mir gleichgültig zu ich bin der Sache gegenüber gleichgültig. Eigentlich unlogisch und schwer zu erklären. Aber doch auch wieder sinnvoll, denn die Gleichgültigkeit liegt eigentlich im Betrachter und nicht in der Sache. Beim Synonym egal ist das nicht so. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.02.2020 um 07.45 Uhr |
|
Zum Hinweis auf https://plato.stanford.edu/entries/intrinsic-extrinsic/ Ich nutze ja die SEP auch sehr oft, aber vieles, was dort steht, würde bei mir unter "Delirium" fallen. Zum Beispiel habe ich mich schon über den Eintrag "Intentionality" geäußert. Man sollte nicht von Wörtern ausgehen und dann fragen, was im Laufe der letzten dreitausend Jahre darunter verstanden worden ist. Freilich ist das für lexikonartigen Darstellungen wohl unvermeidlich. Kunstwörter wie "Intentionalität" oder noch besser das hochkünstliche "Aboutness" sind besser geeignet, zur Sache zu kommen. "Eigenschaft" ist weniger geeignet, schon die Übersetzung z. B. ins Altgriechische führt ins Unwegsame (wie "Ursache", über dessen vielfachen Sinn bei Aristoteles man viele langweilige Abhandlungen geschrieben hat). Das ist ja der Grund, warum ich die philosophischen Texte nicht mehr verstehe (nicht mehr verstehen will!). Erklären kann man sie freilich noch, wie Krankheiten... Kurzum, es kommt darauf an, Unterschiede zu entdecken. Bei Trost habe ich die scheinhafte Gleichmacherei kritisiert: Eigenschaftswörter bezeichnen Eigenschaften, und davon gibt es folgende Arten (usw.) – Das ist Unsinn. Ledig zu sein, ist keine Eigenschaft, sondern man muß ein bißchen ausholen und das Gesellschaftssystem beschreiben, in dem Personen in verschiedenen normierten Beziehungen zu einander und zum Ganzen stehen. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 13.02.2020 um 18.04 Uhr |
|
Um es kurz zusammenzufassen, Ickler sagt: So wie Trost »Eigenschaft« versteht, taugt das nichts. Darauf Panchenko: Aber Carnap z. B. versteht »Eigenschaft« auch so. Mag ja sein, aber das ist doch kein Gegenargument!
|
Kommentar von Ivan Panchenko, verfaßt am 13.02.2020 um 16.58 Uhr |
|
Na ja, ganz allgemein jemand, der Eigenschaft in einem engeren Sinne versteht, als es tatsächlich gemeint war. Ich nahm Bezug auf diese Bemerkung von Professor Ickler: „Zweitens ist es kein Merkmal des Gegenstandes, wenn er jemandem egal ist, sondern dies ist ein Ausdruck für die Gleichgültigkeit des Betreffenden gegenüber dem Gegenstand. Aber was kann man erwarten, wenn der Beitrag über das Adjektiv von Igor Trost ist!“ Ich würde Trost an dieser Stelle keine Sprachverführtheit vorwerfen (wie in #42936 erklärt), so wie ich jemandem, der von der leeren Menge spricht, nicht vorwerfen würde, er würde denken, da seien tatsächlich irgendwelche Elemente vermengt. Aber wir brauchen das nicht erschöpfend zu diskutieren. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 13.02.2020 um 15.08 Uhr |
|
Wer ist gemeint?
|
Kommentar von Ivan Panchenko, verfaßt am 13.02.2020 um 14.44 Uhr |
|
Umso schlimmer für denjenigen, der sich etwas hineininterpretiert, was nicht gesagt wurde.
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 13.02.2020 um 13.49 Uhr |
|
Was soll das jetzt heißen, bei Carnap ist das eben so – um so schlimmer für die Tatsachen?
|
Kommentar von Ivan Panchenko, verfaßt am 13.02.2020 um 12.30 Uhr |
|
Worauf ich hinauswill: Sprachverführtheit könnte man vorwerfen, wenn wirklich jemand behaupten würde, es würde für Papst Franziskus (und nicht nur für mich) einen direkten Unterschied machen, ob er mir egal ist, aber manche (siehe etwa Carnap) verwenden Eigenschaft einfach in einem sehr weiten Sinn. In Fachsprachen gibt es ja solche Kuriositäten, man denke an die leere Folge in der Mathematik, eine „Folge“, die kein einziges Glied enthält, wo also eigentlich kein Glied auf ein anderes folgt.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.02.2020 um 06.50 Uhr |
|
Es ist keine extrinsische Eigenschaft des abben Knopfes, daß er nicht mehr in physischer Verbindung mit dem Hemd steht. Die Mülltonne steht vor der Gartentür, das ist aber keine Eigenschaft der Tonne oder der Gartentür, auch keine extrinsische. Man sollte sich von dem irreführenden Namen „Eigenschaftswort“ verabschieden und hinsehen, wie die Wörter wirklich gebraucht werden. Ich erinnere noch einmal an http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1651#31276 |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.02.2020 um 04.43 Uhr |
|
Lieber Herr Panchenko, in meinem vorigen Eintrag habe ich gerade diesen Unterschied zu umschreiben versucht: Eigenschaft vs. Beziehung. Ich habe natürlich auch den klassischen Fall im Kopf, der mit Locke und anderen verbunden ist, und weiß, daß "Eigenschaften" wie Gewicht, Farbe, Wert ganz unterschiedlich definiert werden müssen. Aber so hoch wollte ich das Problem gar nicht hängen. Ein vielgelesenes Buch kann richtig zerlesen und zerfleddert sein, aber wenn viele es gelesen haben und folglich kennen, dann hat sich etwas in ihren Köpfen verändert und nicht im Buch. Ein kürzlich entdeckter Asteroid hat die Entdecker verändert, nicht sich selbst. Nur unsere Sprache gaukelt uns das Gegenteil vor und läßt uns die Asteroiden in entdeckte und unentdeckte einteilen. Das ist praktisch, darum tun wir es. Daß man Beziehungen als Eigenschaften ausdrückt, ist alltäglich. Ich hatte wohl schon ledig erwähnt, das die Linguisten auch als Eigenschaftswort auffassen. Ein gutes Beispiel ist auch gleichgültig anstelle von Trosts egal. Will wirklich jemand behaupten, daß die Gegenstände in zwei Klassen zerfallen, solche, die mir (aber nicht dir...) gleichgültig sind, und die anderen? Es liegt doch auf der Hand, daß der Unterschied in uns liegt: Wir interessieren uns für die einen, aber nicht für die anderen. Mit intrinsisch/extrinsisch kommen wir hier nicht weiter. Es scheint mir doch abwegig zu sagen: Es ist eine extrinsische Eigenschaft von Papst Franziskus, daß ich mich nicht für ihn interessiere. Sprachverführte Vernebelung der wirklichen Verhältnisse. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 13.02.2020 um 00.03 Uhr |
|
zu #42935: Stimmt, ich habe irrtümlich gelesen als nicht attributiv verwendbar angesehen. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 12.02.2020 um 20.49 Uhr |
|
Wenn ein Buch von vielen gelesen wird, bekommt es tatsächlich die Eigenschaft "viel gelesen".
|
Kommentar von Ivan Panchenko, verfaßt am 12.02.2020 um 15.19 Uhr |
|
Hm, Sie scheinen Eigenschaft für intrinsische Eigenschaft zu verwenden, für mich ist Das Buch hat die Eigenschaft, mir bekannt zu sein dagegen einfach nur eine andere Ausdrucksweise für Das Buch ist mir bekannt – ich unterstelle damit NICHT etwa, durch das Mir-bekannt-Werden habe sich die materielle Beschaffenheit des Buches verändert. Igor Trost verwendet Merkmal vielleicht auch in so einem weiten Sinn. https://plato.stanford.edu/entries/intrinsic-extrinsic/ |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.02.2020 um 11.06 Uhr |
|
Sicher nicht. "gelesen" und das schon besprochene "bekannt" sind Gegenbeispiele. (Wenn ich Sie richtig verstanden habe.) Man könnte höchstens sagen: Wenn ein Politiker mir bekannt wird, dann gewinnt er zwar keine Eigenschaft hinzu (während ich mich wirklich verändere, denn ich kenne ihn nun), aber er tritt in eine neue Beziehung ein, nämlich mir in irgendeiner Weise begegnet zu sein. Geschieht es dadurch, daß ich ein Foto von ihm sehe, so muß er Licht in eine Kamera reflektiert haben usw. Geschieht es durch Lektüre, so muß der Verfasser in einer wenn auch noch so komplizierten Beziehung zu ihm gestanden haben (z. B. durch eine Kette von Berichterstattern, deren erster in einer physischen Beziehung zu ihm gestanden hat...) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 12.02.2020 um 10.16 Uhr |
|
Die beiden Beispiele ergeben nur Sinn bei prädikativer Verwendung. Kann man immer dann von wirklichen Eigenschaften sprechen, wenn die Adjektive auch attributiv verwendbar sind, oder ist auch das nicht regelmäßig?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.02.2020 um 06.51 Uhr |
|
Auch in diesen Faden gehört, was ich anderswo angeführt habe (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1044#42928): Etwas ist mir egal. – Damit soll diesem Gegenstand eine "Eigenschaft" zugeschrieben sein, nämlich jemandem egal zu sein. Ein besonders krasses Beispiel von Sprachverführtheit, an dem sich daher der Fehler auch besonders einleuchtend aufdecken läßt. Bei Karl Valentins "gelesenem Buch" war es ein Witz, hier ist es vollkommen ernst, und man findet es durch die Bank bei allen jüngeren Germanisten und darüber hinaus. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.01.2020 um 09.43 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1651#39937 Als Mitbegründer der deutschen Politikwissenschaft äußerte sich Sternberger auch zu seiner eigenen Auffassung, was das Politische ausmache. So gilt vor allem Sternbergers „Heidelberger Antrittsvorlesung“ als primäres Dokument zu diesem Thema. Er sagte: „Der Gegenstand und das Ziel der Politik ist der Friede. Das Politische müssen und wollen wir zu begreifen versuchen als den Bereich der Bestrebungen, Frieden herzustellen, Frieden zu bewahren, zu gewährleisten, zu schützen und freilich auch zu verteidigen. Oder, anders ausgedrückt: Der Friede ist die politische Kategorie schlechthin. Oder, noch einmal anders ausgedrückt: Der Friede ist der Grund und das Merkmal und die Norm des Politischen, dies alles zugleich.“ (Wikipedia Sternberger) Carl Schmitt, Machiavelli, Kautilya, Platon, Kant, Marx – jeder definiert es anders. Dem Gebildeten fallen noch ein Dutzend weitere ein. Was soll’s? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.06.2019 um 05.22 Uhr |
|
Kurioser Nachtrag: Auf dem Rückendeckel des Nachdrucks von Hermann Walter: Hathayogapradipika (1893/2007) teilt der Verlag Olms mit: „Das vorliegende Buch enthält eine vor mehr 90 Jahren verfaßte Übersetzung aus dem Sanskrit. Die Einleitung des Autors zeigt seine kritische Auseinandersetzung mit dem von ihm übersetzten Text mit sorgfältigen Interpretationen und Vergleichen unter Zuhilfenahme anderer Übersetzungen. Die wissenschaftliche Betrachtungsweise war für die damalige Zeit ungewöhnlich, da Yoga noch nicht als ein Gegenstand der Wissenschaft galt. Gerade heute gewinnt dieses Buch an Aktualität, weil sich die moderne Psychologie und Psychotherapie mit wissenschaftlichen Methoden dem Yoga nähern und ihm wertvolle Anregungen verdanken. Dieses Werk ist als Grundlagenliteratur für die Unterrichtspraxis und für die in der Ausbildung stehenden Yogalehrer unverzichtbar; in kaum einem anderen Buch, das sich mit Hatha-Yoga befaßt, ist seiner klassischen Form so rein zu begegnen.“ In Wirklichkeit distanziert sich Walter deutlich von der abstrusen medizinischen Lehre der unwissenden alten Inder. Aber es ist heute Mode, sich mit der vermeintlichen östlichen Weisheit zu befassen. Es wimmelt von Therapeuten, die auch unvereinbare Lehren aus aller Welt zusammenmischen. Alles geht (und verkauft sich gut). (Ziemlich schief ist auch die wissenschaftsgeschichtliche Einordnung von Walters Dissertation.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.06.2019 um 16.59 Uhr |
|
Die Inder (Yoga-Schulen; Beispiel Hathayogapradipika) nahmen an, daß zwischen Nabel und Geschlechtsteil ein Knoten (kanda) sitzt und darüber die Kundali (Kundalini, Shakti usw., viele Synonyme), die meistens schläft und durch verschiedene Praktiken geweckt werden kann. Die Adern, diverse Röhrensysteme, transportieren die Atemluft, die Carotis setzt die Luftröhre fort. („Wenn also der indische Mediziner den Puls des Patienten fühlte, so wollte er untersuchen, ob die Luft normal sich durch den Körper bewege. Unter anderm wurden zu diesem Zweck auch die beiden Halsschlagadern befühlt.“ (Hermann Walter: Hathayogapradipika. 1893, Nachdr. Hildesheim 1984:IX)) Bekannt ist die phantastische Lehre von den „Chakren“. Die Zungenbeweglichkeit wird trainiert, aber weit überschätzt – kurz, eine Anatomie und Physiologie fast ohne reale Grundlage. Mit diesen Vorstellungen arbeiten dann die Yogapraktiken, und zwar durchaus erfolgreich, was die erreichten körperlichen Zustände und dazugehörigen „Erlebnisse“ betrifft. Damit ist der Ausbau unserer gewohnten folk psychology vergleichbar, die Innenausstattung der „Seele“ (des Geistes usw.). An den exotischen Beispielen kann man das Funktionieren von nichtwissenschaftlichen Konstrukten am besten studieren. (Wie ja auch die Religion an Systemen, an die man nicht selbst glaubt.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.05.2019 um 16.22 Uhr |
|
Daß es den "inneren Sinn" gibt, ist für Kant selbstverständlich und für seine KdrV unentbehrlich (Stellen bei Eisler). Die Linearität, also die Zeit als einzige Dimension des inneren Sinns, ist aus der Linearität der Rede abgeleitet: immer ein Wort und ein Satz nach dem anderen, daher eine „Vorstellung“ nach der anderen. Der fiktionale Charakter dieses Konstrukts ist Kant nicht bewußt.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.03.2019 um 09.24 Uhr |
|
Ce n’était ni vrai ni faux, c’était vécu. (André Malraux über sein Leben.)
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.02.2019 um 15.14 Uhr |
|
Wie soll denn das zusammenhängen? Man braucht doch nicht dieselbe Wurzel, um ein Übersetzungsäquivalent zu bilden.
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 28.02.2019 um 13.20 Uhr |
|
Betr.: "Erlebnis" Daß es im Englischen kein Wort für "er-leben" gibt, liegt wohl daran, daß es im Alt- und Neugriechischen und im Alt- und Neulateinischen dafür kein Wort mit der Wurzel "leben" gibt, im Gegensatz zu den germanischen und den slawischen Sprachen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.02.2019 um 15.44 Uhr |
|
Besonders auch education, wie meine Frau gerade bemerkt, die viel damit zu tun hatte. Das kann auch "Bildungserlebnis" bedeuten. Die Herkunft spielt natürlich eine Rolle, andererseits sind gerade die abstrakten Begriffe durch das jahrhundertelange Hin- und Herübersetzen einander stark angegelichen worden, was man erst bemerkt, wenn man wirklich ganz andere Kulturen kennenlernt. Abstrakta sind deshalb besonders "anfällig" für semantische Angleichung, weil sich unter den Konkreta viele "Nationalbegriffe" befinden, vgl. etwa Brot – pain usw. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 25.02.2019 um 10.42 Uhr |
|
Es gibt auch keine eindeutige Entsprechung zu Erkenntnis. Solche Abstracta sind im Englischen im allgemeinen aus dem Französischen übernommen und nicht aus germanischen Quellen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.02.2019 um 09.20 Uhr |
|
Vielleicht haben wir schon einmal darüber gesprochen: Mir fällt immer wieder auf, daß das nicht sehr alte deutsche Wort Erlebnis keine Entsprechung zum Beispiel im Englischen hat. Es wird meistens mit experience wiedergegeben, so in Übersetzungen der phänomenologischen Literatur. Dessen Anwendungsbreich ist aber viel größer, so daß man hier oft ein Unbehagen empfindet (bzw. "erlebt"). In der Marketing-Literatur ist viel von customer experience die Rede, wo sich im Deutschen dann Kundenerlebnis einstellt. In den deutschen Wörterbüchern wird die emphatische Verwendung das war ein Erlebnis verzeichnet, dem bezeichnenderweise quite an experience entspricht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.02.2019 um 07.45 Uhr |
|
Wenn die Phänomenologen zur Wesensschau ansetzen, dann schauen sie frei von Vorurteilen das Wesen der Dinge, gern auch das eigenste und sogar ureigenste Wesen (viele tausend Belege!). Es ist klar, daß dabei mangels anderer Erkenntnisquellen nur die eigenen Klischeevorstellungen und Vorurteile zutage treten können – was denn sonst? Im besten Falle eine synonymische Differenzierung wie bei den "Werten" (Scheler, Hartmann, Reinach...). Wenn zum Beispiel das ureigenste Wesen der Frau geschaut wird, kommt dasselbe heraus wie bei den Naturrechtlern, die es ja ebenfalls aus den tiefsten Tiefen der eigenen Intuition hervorholen. Auch das eigenste Wesen des jüdischen Menschen hat man schon geschaut, nicht unbedingt zu dessen Vorteil.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.11.2018 um 11.41 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1651#38783 Ganz wie Scheler, dem er viel verdankt, schreibt auch Erich Rothacker: Was „Denken“ im strengen Sinne heißt, wußte kein lebender Mensch vor den Griechen. Wer nicht irgendwie durch ihre Schule ging, weiß heute noch nicht, was theoretisches Denken eigentlich besagt. Er spricht davon wie die Kuh vom Tanzen. (Erich Rothacker: Die Schichten der Persönlichkeit. Bonn 1952:129) Das braucht man heute nicht mehr zu kommentieren. Das Werk, aus dessen 5. Auflage ich zitiere, galt in Deutschland mal als bedeutender Beitrag zur Psychologie. Eickstedt und andere Rassenforscher sind immer noch erwähnt. (Zu Rothackers Doktoranden gehörten übrigens Habermas und der Spökenkieker Hans Bender.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.10.2018 um 06.13 Uhr |
|
Die Substantivierung das Politische hat mir immer Unbehagen bereitet. Aus einer behaupteten Unterscheidung von der Politik hat man neuerdings eine "politische Differenz" herausgesponnen (https://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Differenz), aber ich sehe nur ein unnützes Herumschieben von Wörtern. Verführerischer Platonismus.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.08.2018 um 12.29 Uhr |
|
Nur der Morgenstern hat die Eigenschaft, von Hammurabi für etwas gehalten zu werden, was manchmal am Morgenhimmel leuchtet, der Abendstern nicht. (http://www.information-philosophie.de/?a=1&t=4107&n=2&y=1&c=50) Das ist vom selben Kaliber wie Karl Valentins "schon gelesenes Buch". Dem Morgenstern ist es schnurzegal, ob jemand ihn für etwas hält – eine Eigenschaft ist es jedenfalls nicht. – Übrigens ebd.: Internationales Symposium 2018 der Schweizerischen Philosophischen Gesellschaft 6.–8. September 2018, Universität Basel Die Frage „Was ist Geist?“ gehört zu den Grundfragen der Philosophie. Sie betrifft das Selbstverständnis unseres bewussten Lebens. Wir bezeichnen unser Denken, Wahrnehmen und Empfinden als „geistige Zustände“. Wir rätseln über die Stellung des Geistes im Kosmos und in der Evolution der Natur. Wir sehen in den Institutionen des Handelns einen bestimmten Geist verwirklicht: sprechen mit Montesquieu vom „Geist der Gesetze“, mit Hegel vom „objektiven Geist“ des Staates, mit Max Weber von der „protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus“ – oder sind vom „neuen Geist des Kapitalismus“ (Luc Boltanski/Éve Chiapello) unserer Zeit verstört. Wir sagen mit Kant, dass ein Kunstwerk nicht nur gewissen Regeln gemäß ist, sondern auch „Geist hat“, oder suchen mit Kandinsky nach dem „Geistigen in der Kunst“. Wir begegnen in den Religionen der Auffassung eines „Heiligen Geistes“ und eines „Schöpfer Geistes“. Was aber ist Geist? Na, dann philosophiert mal schön! Für das nächste Symposium bleibt sicher auch noch was übrig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.07.2018 um 12.23 Uhr |
|
Daß ausgerechnet die sprachverführten Phänomenologen den normalen Menschen in seiner Lebenswelt „naiv“ nennen, setzt dem grotesken Unternehmen der Phänomenologie die Krone auf.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.06.2018 um 17.52 Uhr |
|
Schon die einfachste Überlegung zeigt, daß "Bekanntheit" kein Merkmal des bekannten Objekts ist. Skinner erzählt, wie er den Gestaltpsychologen Wolfgang Köhler in Verlegenheit brachte: Dieser hatte behauptet, man sehe unmittelbar etwas in den Gegenständen, was nach Skinner nur gelernt sein konnte. Er fragte Köhler, ob auch die „Bekanntheit” im Gegenstand selbst stecke. Offenbar ist sie ja erlernt, eigentlich eine Veränderung im Betrachter, nicht eine Eigenschaft des Betrachteten. Köhler sagte dann, es sei ihm egal, woher die wahrgenommene Eigenschaft stamme. So kann man sich von der Sprache irreführen lassen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.05.2018 um 04.09 Uhr |
|
Psychologen haben immer wieder versucht, Gefühle ("Emotionen") als Verbindung einer Grundstimmung mit einem "kognitiven" Gehalt zu verstehen. Die Grundstimmung ist eher körperlich und durch Medikamente und Drogen beeinflußbar. Man wacht morgens auf und könnte Bäume ausreißen oder schleppt sich matt zur Toilette usw. Aber wie schon gesagt: Man wacht nicht auf und ist verlegen oder schämt sich. Dazu muß man sich erst bestimmte Situationen oder Vorfälle vorgestellt haben, die eben die "kognitive" Färbung liefern, eine Deutung der Stimmung. Die genannten japanischen Begriffe, die ich nur zitiert habe, aber mangels Fachkenntnis nicht kommentieren will, wären solche kulturspezifischen Deutungen. (Anna Wierzbicka ist wohl die bedeutendste Forscherin auf diesem Gebiet.) Man braucht viele Worte, um etwa Heimweh oder Wehmut zu erklären. Freud hat ja Romain Rollands "ozeanisches Gefühl" als vermeintliche Grundlage der Religion kommentiert, während die Religiösen selbst dieser Stimmung natürlich eine andere Deutung geben. Das wäre ein bekannter Fall aus der Literatur. Die Kulturabhängigkeit und Geschichtlichkeit dieses Teilwortschatzes ist unbestritten, die universalen Aspekte sind es nicht. Könnte es sein, daß auch die Geschlechter grundsätzlich verschiedene Deutungen für "dieselben" Grundstimmungen finden? Das "semantische Differential" (Osgood, Hofstätter) ist ein beliebtes Instrument, solche Unterschiede nachzuweisen, allerdings paßt es nicht gut zu jenem Modell aus Stimmung und Deutung, und was die Faktorenanalyse als die drei Dimensionen herauspräpariert, ist im Grunde etwas anderes und nicht gut verstanden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.05.2018 um 03.45 Uhr |
|
Zum vorigen: Beipiele für die "Randzone", in der auch einzelne die alltagspsychologischen Konstrukte erweitern und vermehren können, wären natürlich die Psychoanalyse, aber auch Takeo Doi, der das japanische Vokabular um amae bereichert hat. Ich weiß aber nicht, ob dies nicht mehr außerhalb Japans eingeschlagen hat als im Lande selbst. Das Ostasien-Institut gibt als japanische Schlüsselbegriffe an: Aizuchi, Amae, „Gesicht“, Gibun, Guanxi, Honne, Tatemae, Ja, Nunchi. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.05.2018 um 06.29 Uhr |
|
Zur "Persönlichkeitsforschung" (traditionell auch "Charakterkunde", "Temperamentenlehre"): Nach Cattell (Personality 1950) liegt die Weisheit der Sprache darin, daß im Laufe der Zeit „jeder mögliche Aspekt menschlichen Verhaltens mit einem Symbol belegt worden sei“ (nach Theo Herrmann: Lb. der emp. Persönlichkeitsforschung. Göttingen 1974:95). Die Charakterkunde schöpft daher aus der Alltagssprache. Die Alltagspsychologie ist in der Tat jederzeit vollständig, aber nicht weil die Menschen im Laufe der Zeit alle Möglichkeiten ausgeschöpft hätten, sondern weil die Alltagspsychologie durch die jeweils vorhandenen sprachlichen Konstrukte definiert ist. Das ist nur ein anderer Aspekt der Inkommensurabilität verschiedener folk psychologies. Andere Persönlichkeitsmerkmale, als die fp vorsieht, gibt es nicht. Nur in einer Randzone gibt es Veränderungen und Ausbau (auch Abbau). Ich vergleiche das Konstrukt noch einmal mit einem Märchen. „Rotkäppchen“ ist vollständig, jeder belächelt Versuche, über den Text hinauszugehen („Die Wahrheit über Rotkäppchen“). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.05.2018 um 09.25 Uhr |
|
Physiker zum Beispiel können ihre Begriffe ("Kernspin") kreativ definieren, und damit ist die Sache klar. Nicht so andererseits zum Beispiel die Juristen, die sich nie allzu weit vom allgemeinen Sprachgebrauch entfernen dürfen: Die Habgier spielt eine besondere Rolle im deutschen Strafrecht als Tatbestandsmerkmal des Mordes (§ 211 StGB) und ist eines der Merkmale, das eine Tötung als Mord qualifiziert. Habgier wird von der Rechtswissenschaft als „rücksichtsloses Streben nach Gewinn um jeden Preis“ definiert. Sie gehört zum subjektiven Tatbestand (Mordmerkmal der ersten Gruppe). Damit das Vorliegen der Habgier bejaht werden kann, muss sie nicht das einzige Motiv der Tötung sein, aber tatbeherrschend und/oder „bewusstseinsdominant“. Es genügt nach – insbesondere auch in der Rechtsprechung vorherrschender – Auffassung, wenn der Täter durch die Tötung lediglich Aufwendungen ersparen will (z. B. Unterhaltszahlungen oder die Rückzahlung eines Darlehens). Der Täter muss also durch die Tat sein Vermögen objektiv wie auch aus seiner Sicht unmittelbar vermehren wollen, wobei der Entfall von „Passiva“ ausreicht (beim Versuch ist beim Ausbleiben des Erfolges auf die Wahrscheinlichkeit abzustellen). (Wikipedia) Das ist immerhin schon eine Erweiterung gegenüber dem Sprachgebrauch. Aber insgesamt bleibt man bei dem, was die Leute so denken, dem Ergebnis einer Bestimmungsleistung der Gruppe. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.05.2018 um 08.31 Uhr |
|
Die folkpsychologischen Konstrukte sind Bestimmungsleistungen von Gruppen (im Sinne Hofstätters). Sie können nicht durch Expertenmeinungen ersetzt werden, und sie sind untereinander inkommensurabel, d.h. nicht Punkt für Punkt in einander übersetzbar, obwohl sie jeweils als ganze den gleichen oder sehr ähnlichen Verständigungszwecken dienen. Da sie zu den Bräuchen gehören, sind sie wandelbar. Auch Einzelpersonen können dazu beitragen, zum Beispiel Schriftsteller: "Es gibt in jeder Sprache einen schlecht und recht brauchbaren Wortschatz für das Ausdrücken und Mitteilen der privaten Erlebnisse des Einzelmenschen. (...) Der Ehrgeiz des literarischen Künstlers ist es, vom Unaussprechlichen zu sprechen, in Wörtern das mitzuteilen, zu dessen Übermittlung Wörter nie bestimmt waren." (Aldous Huxley in Helmut Kreuzer (Hg.): Die zwei Kulturen. München 1987:169f.) Ob solche Vorstöße an den Grenzen bisheriger Bräuche aber Erfolg haben, also von der Gemeinschaft – sei es auch in abgewandelter Form – übernommen werden, läßt sich nie vorhersagen. Wir neigen nun verständlicherweise dazu, die Pseudo-Denotate unserer heute geltenden psychologischen Redeweise für die Sache selbst zu halten und die Benennungsleistungen anderer, vor allem auch vergangener Gruppen daran zu messen. So kommt es zu naiven Urteilen wie dem folgenden: "Die Antike und das Mittelalter, die keinen eigenen Namen für das Gefühl hatten, bezeichneten sowohl Gemütszustände (Lust und Unlust) als auch Gemütsbewegungen (Liebe, Haß, Freude, Furcht usw.) griechisch mit pathos und lateinisch mit ´passio´ (...)" (Hist. Wb. d. Philosophie s.v. Gefühl, Sp. 82) Man sieht hier den naiven Gebrauch einer jetzt weithin akzeptierten Modellierung des Psychischen, die als scheinbar sachgerechterer Maßstab einer früheren aufgefaßt wird. Das Gefühl selbst scheint als Objekt zu existieren, nur wurde es in der Antike nicht richtig abgegrenzt und benannt. "Bei Homer finden wir ein reiches Vokabular der Bewußtseinzustände. Aber wir sehen auch, daß das Vokabular Erfahrungskategorien durcheinanderbringt, deren Unterschiedenheit wir für selbstverständlich halten (beispielsweise werden Wahrnehmungsakte mit Erkenntnisakten vermengt und Gefühl mit Erkenntnis). Man kann in der homerischen Sprache nicht über das Denken denken." (Paul Henle (Hg.): Sprache, Denken, Kultur. Frankfurt 1969:69) "Ich bin sogar der Meinung, daß die gesamte indische Kultur die spezifisch griechische und abendländische Kategorie des ´Geistes´ nicht besaß." (Max Scheler: Die Stellung des Menschen im Kosmos. München 1949:61) Bei Bruno Snell ist das Konstruktive der transgressiven Metapher recht gut ausgedrückt: "Das Entdecken des Geistes ist ein anderes, als wenn wir sagen, Kolumbus habe Amerika „entdeckt": Amerika existierte auch vor der Entdeckung, der europäische Geist aber ist erst geworden, indem er entdeckt wurde; er existiert im Bewußtsein des Menschen von sich selbst. Trotzdem gebrauchen wir das Wort „entdecken" hier zu Recht. Der Geist wird nicht nur „erfunden", wie der Mensch sich ein Werkzeug zur Verbesserung seiner körperlichen Organe oder eine Methode erfindet, um bestimmten Problemen beizukommen. Er ist nichts, das willkürlich ausgedacht wäre oder das man ausgestalten könnte, wie man Erfindungen ihrem Zweck besser anpaßt, ist überhaupt nicht wie eine Erfindung auf Zwecke ausgerichtet, ja, „war" sogar in bestimmtem Sinn, bevor er entdeckt wurde: nur in anderer Form, nicht „als" Geist. Zwei terminologische Schwierigkeiten tun sich hier auf. Die eine geht auf ein philosophisches Problem: Wenn wir davon sprechen, daß die Griechen den Geist entdecken, und doch meinen, daß der Geist dadurch erst wird (grammatisch gesprochen: daß „Geist" nicht nur affiziertes, sondern auch effiziertes Objekt ist), so zeigt sich, daß es nur eine Metapher ist, die wir gebrauchen — aber es ist eine notwendige Metapher und der richtige sprachliche Ausdruck für das, was wir meinen; anders als metaphorisch können wir vom Geist nicht reden." (Die Entdeckung des Geistes. 9. Aufl. Göttingen 2011:7f.) Snell hat allerdings keinen Standpunkt außerhalb dieser Tradition, von dem aus er ihre Entstehung objektiv darstellen könnte. Man sieht dann, wie er mit der Erfassung solcher Konstrukte ringt. Richtig auch (schon zitiert): „Der Versuchung, indische Psychologie im Hinblick auf westliche Parallelen und verwandte Weiterentwicklungen zu betrachten, mußte durchaus widerstanden werden, und so wurde es auch gänzlich vermieden, ihre Lehren ins Gewand abendländischer Terminologie zu kleiden. Ein wirkliches Verständnis indischer Seelenlehre wie indischer Philosophie kann nur auf Grund der Originalausdrücke gewonnen werden, die größtenteils unübersetzbar bleiben, weil ihnen im griechisch-abendländischen Denken nichts genau entspricht, so daß ihre Wiedergabe durch die unseren notwendig zu einer Verfälschung des indischen Gedankens führt.“ (Emil Abegg: Einführung in die indische Psychologie. Zürich 1945:9) Ein aktuelles Beispiel: Vor Jahren hat jemand den Begriff "Grundversorgung" inoffiziell in das Rundfunkrecht eingeführt, um die besondere Art der Finanzierung zu rechtfertigen. Seither hat sich dieser Begriff ausgebreitet, es ist aber hochumstritten, was darunterfällt (seine "Extension"). Immerhin übt sein bloßes Vorhandensein einen gewissen Sog aus. Es muß doch so etwas geben... ("Denn eben wo Begriffe fehlen...") |
Kommentar von R. M., verfaßt am 16.02.2018 um 16.34 Uhr |
|
Na ja, wenn es Pastafarier gibt, wird es wohl irgendwo auch Solipsisten geben. Daß man nicht viel von ihnen hört, liegt ja in der Natur der Sache.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.02.2018 um 08.44 Uhr |
|
Warum das ein Problem ist – i. a. ist es natürlich keins, nur um die Frage "Gibt es überhaupt Solipsisten?" zu beantworten. Es muß keine geben, damit es Solipsismus gibt.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.02.2018 um 08.01 Uhr |
|
Eine empirische und durchaus wichtige Frage lautet,ob jemand etwas nur geträumt oder wirklich erlebt hat. Halluzinationen müssen und können von wirklichen Wahrnehmungen unterschieden werden. Sinnlos wird es, wenn man fragt, ob wir alles immer nur träumen usw. – Das verträgt sich nicht mit dem Sprachspiel, in dem allein solche Ausdrücke ihren guten Sinn haben. Träumen gibt es nur, wo es auch Nicht-Träumen gibt, das ist eine logisch-begriffliche Angelegenheit. Wie analytische Philosophen sagen: Es muß einen Grund zum Zweifeln geben. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 15.02.2018 um 21.58 Uhr |
|
Warum soll das ein Problem sein?
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 15.02.2018 um 21.27 Uhr |
|
Das Problem nicht nur bei eventuellen Solipsisten, sondern bei allen Philosophen ist, sagen sie, was sie wirklich glauben, oder erklären sie uns nur mögliche Anschauungen? So werden solipsistische Theorien vielleicht sehr oft nicht aus voller Überzeugung, sondern eher nur der Vollständigkeit halber genannt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.02.2018 um 18.27 Uhr |
|
Dem kann ich nur zustimmen.
|
Kommentar von Klaus Achenbach, verfaßt am 15.02.2018 um 18.23 Uhr |
|
Gibt es überhaupt Solipsisten? Mir ist noch keiner über den Weg gelaufen. Aber die Frage "Woher weiß ich, ob ich in diesem Augenblick wache oder träume?" und die Einsicht, daß es nicht möglich scheint, das eine oder andere – in welchem Sinne auch immer – zu "beweisen", ist doch ein Einstieg in philosophisches Denken, etwa über die Fragen, was ein Beweis oder was Erkenntnis eigentlich ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.02.2018 um 18.10 Uhr |
|
Auch Selbstgespräche sind Gespräche – in einer Sprache, einer gemeinschaftlichen nämlich. Ich muß aber gestehen, daß ich den Solipsismus nur aus Bücnern kenne und noch nie mit einem Solipsisten gesprochen habe. Das stelle ich mir auch ziemlich schwer vor. Der eigentliche Problem hatte ich ja anderswo aufgegabelt. Es geht um die Behauptung, daß der Mensch primär nur von sich selbst eine unmittelbare Kenntnis hat und die Innenwelt der anderen erst erschließen muß. Das Kind soll die Entdeckung des anderen Selbst mit acht bis zehn Monaten machen. Ich bestreite das rundweg, aber begriffskritisch, nicht empirisch. Die introspektive Redeweise, also die "Transgression" im oft besprochenen Sinne, ist ein gemeinschaftliches Unternehmen wie die Sprache selbst, zu deren "Grammatik" es gehört. "Ich stelle mir vor" ist nicht ursprünglicher als "Du stellst dir vor". Vgl. auch http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#37765 |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 15.02.2018 um 13.03 Uhr |
|
Der Solipsist führt aus seiner Sicht Selbstgespräche. Er fühlt sich dabei in eine bestimmte geistige Form gezwungen, der er nicht entweichen kann. Auch die geistigen Regungen unterliegen seiner Ansicht nach bestimmten Gesetzen. Sieht er sich selbst etwas tun, ist das nur eine andere Art geistiger Regung. Für ihn ist es kein Widerspruch, mit einer anderen Person zu streiten.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.02.2018 um 12.47 Uhr |
|
Dazu kann ich nicht viel sagen. Ich will auch auf philosophische Wortemacherei, wozu ich den Solipsismus rechne, nicht zu viel Zeit und Mühe verwenden. Man nennt es ja wohl einen pragmatischen Widerspruch, wenn jemand sagt: "Ich kann nicht sprechen" oder "Ich bin gerade nicht bei Bewußtsein" usw. Der Solipsist, falls es einen gibt (und nicht nur Schwätzer in einer gefälligen Pose), will mir sagen, daß es möglicherweise nur ihn gibt – setzt aber eben damit praktisch voraus, daß es sowohl mich als auch die Sprachgemeinschaft gibt, von der er die Worte gelernt hat.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 15.02.2018 um 12.40 Uhr |
|
Alle idealistischen Weltanschauungen, z. B. die Vorstellung, daß da draußen ein Gott mit seiner geistigen Kraft die Welt erschaffen hat und nach seinem Gutdünken in das hiesige materielle und geistige Geschehen eingreift, erscheinen mir kein bißchen sinnvoller als der Glaube, ich selbst sei dieser Gott und die ganze Welt um mich herum einschl. meines eigenen Körpers nur Produkt meiner nach bestimmten Regeln, die ich nicht kenne und nicht willentlich beeinflussen kann, ablaufenden Phantasien. Das alles ist für mich der gleiche Unsinn. Komischerweise halten aber andere Menschen das eine für mehr, das andere für weniger Unsinn. Wer bestimmt nun, was einen Beweis nötig hat und was sich ohne solchen erledigt? Eigentlich sind day alles Glaubensfragen. Meiner Ansicht nach meinen Solipsisten, wenn sie sagen, der Solipsismus sei nicht widerlegbar, auch nur die rein logische Widerlegung. Wenn ich von einem materialistischen Standpunkt ausgehend auf Fragen der Ewigkeit und Unendlichkeit treffe, kommen mir ebenso Zweifel an der Schlüssigkeit des ganzen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.02.2018 um 05.01 Uhr |
|
Lieber Herr Riemer, vielleicht verstehe ich Sie nicht richtig. Ich habe keine Widerlegung versucht, die meiner Ansicht nach mit logischen Mitteln nicht möglich ist, aber auch nicht nötig, denn Unsinn kann und muß man nicht widerlegen. Sollte jemand mir gegenüber an seiner oder meiner Existenz zweifeln, so wüßte ich nicht, was seine Rede bedeutet. Anders und ganz kindlich gesagt: Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, kann ich nicht gleichzeitig bezweifeln, daß es ihn gibt. Er hätte vollkommen recht, wenn er sich mit einem "Spinn weiter!" abwendete. Und, ja, auch Spott: Noch nie hat ein Solipsist an der Realität seines Bankkontos gezweifelt; das sollte auch zu denken geben. Etwas ernsthafter: "existieren", "es gibt" usw. bedeutet: mit mir und dir zum selben Bestandssystem gehören (der Welt nämlich). |
Kommentar von Pt, verfaßt am 14.02.2018 um 19.22 Uhr |
|
Hier mal ein anderer Aspekt von Solipsism: Mark Passio On The Mental Illness Of Solipsism https://www.youtube.com/watch?v=fTFV4Q1OAdQ Mark Passio Solipsism Is A Mental Illness https://www.youtube.com/watch?v=f8wj7HyxkkE |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 14.02.2018 um 18.39 Uhr |
|
Lieber Prof. Ickler, auf die These, der Solipsismus sei nicht zu widerlegen, antworten Sie, "Wer so etwas ernst nimmt, dem ist nicht zu helfen." Aber, Entschuldigung, das ist doch keine Widerlegung. Ich bin kein Anhänger des Solipsismus, orientiere mich lieber an praktischen Anschauungen, aber deswegen ist er für mich noch lange nicht erledigt. Erledigt wäre er, wenn ich ihn widerlegen könnte. Haben Sie denn eine Idee, wie das gehen könnte? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.02.2018 um 09.44 Uhr |
|
zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1651#37414 Vom Staat recht großzügig besoldete Philosophieprofessoren tragen uns (wem bitte?) vor, der Solipsismus sei nicht zu widerlegen. Vielleicht gibt es mich gar nicht? "I cried all the way to my bank." Wer so etwas ernst nimmt, dem ist nicht zu helfen. Gilt auch für die Phänomenologen. Man sollte sie einfach auslachen. (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587#37415) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.01.2018 um 07.44 Uhr |
|
Aus einer praxisfernen Fehldeutung von Verben wie wollen hat man früher Handlungstypen herausgesponnen, hier also eine "Wollung" oder ganz gelehrt einen "actus volendi". Aristoteles lag mit seiner "Prohaireis" richtiger, weil das "Vorziehen" einer Option von vornherein auf eine Wahl gegründet ist, vgl. meine "Naturalisierung der Intentionalität". („Prohairesis“ ist übrigens sowohl in der englischen als auch in der deutschen Wikipedia sehr dürftig erklärt, außerdem ganz verschieden: engl. vor allem Epiktet, dt. Hannah Arendt – was soll das?). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.01.2018 um 07.40 Uhr |
|
Es gibt Sätze, die auf den ersten Blick sinnvoll aussehen, auf den zweiten nicht mehr. Ich vergleiche das gern mit Bildern von Escher. Wenn man den Konstruktionsfehler durchschaut hat, ist der Fall "erledigt". Es gibt Sätze, für die sich keine Anwendung denken läßt. Man kann also nicht sagen, was der Fall sein müßte, wenn sie wahr oder falsch wären. Das ist banal. Interessant ist die Frage, wie es dazu kommt. Wie kommt es, daß jemand Aussagesätze konstruiert (oder eben "unmögliche" Gegenstände zeichnet), die sich als sinnlos erweisen. Ryle, Hacker u. a. haben sich damit beschäftigt, es ist "Sprachkritik". Ich selbst arbeite an der Rekonstruktion der Redeweise von einem "Inneren", also den transgressiven Übertragungen (wie Wittgenstein und Skinner jeder auf seine Weise getan haben). Das folkpsychologische Vokabular und seine enorme Verführungskraft. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 31.12.2017 um 01.44 Uhr |
|
Kann man berechtigterweise etwas als erledigt betrachten, das weder widerlegt noch bewiesen ist? (Es mag natürlich noch Unentscheidbares geben, aber auch die Unentscheidbarkeit müßte erst bewiesen werden.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 29.12.2017 um 20.59 Uhr |
|
Das Ich ist das einzig Existierende. Das Gespräch zwischem dem Ich und dem Gegenüber, aus dessen Sicht zwischen ihm selbst ("Wem"?) und dem Du, findet auf einer anderen Ebene statt, und zwar in der vom Ich geschaffenen Welt. Wie könnte dieses fiktive Gespräch also eine Widerlegung oder eine Erledigung des Solipsismus sein? Was ist überhaupt gemeint mit der Unterscheidung zwischen Widerlegung und Erledigung? M. E. kann man den Solipsismus genauso wenig beweisen oder widerlegen (erledigen?), wie man Gott beweisen oder widerlegen kann. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.12.2017 um 17.36 Uhr |
|
Es gibt nur mich. Wem sagst du das?! Damit ist der Solipsismus nicht widerlegt, sondern erledigt. Die Sache hat aber ein weiterreichende Bedeutung: Die Phänomenologen fangen ja auch in eingebildeter Ursprünglichkeit und gespielter Naivität so an: "Ich bin mir bewußt..." usw. und erklären es dann für ein Problem, wie man zur Existenz anderer kommt ("Fremdseelisches"). Aber ihre Worte sind von Anfang an die der uns allen gemeinsamen Sprache. Also setzte sie praktisch die Gemeinschaft voraus und wollen ja auch von ihr gelesen (und ernährt) werden. Das kann man alles vergessen, es ist zu langweilig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.10.2016 um 04.55 Uhr |
|
Wenn jemand ein Schlagwort erfindet, bildet sich bald eine Gemeinde, die von der Existenz des zugehörigen Gegenstandes überzeugt ist, und dann kann man ein paar Jahre lange Texte darüber verfassen, bis die Mode sich etwas anderem zuwendet. Ein Beispiel sind die vielen "Generationen ..." Stoße gerade auf die Generation Y, die "Millenials". Treffende Kritik wird mitreferiert: https://de.wikipedia.org/wiki/Generation_Y Im Marketing wird all das für bare Münze genommen. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 19.01.2016 um 23.51 Uhr |
|
Wenn man wirklich wissen will, was Definitionen und Klassifizierungen leisten und welche Probleme sie aufwerfen, muß man sich ja nur in der Biologie oder Medizin umsehen. Aber wie mühsam wäre das! Also doch lieber über die Tischhaftigkeit des Tisches philosophieren.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.01.2016 um 17.29 Uhr |
|
Hierher könnte man auch die sogenannte Phänomenologie stellen, die sprachabhängig ist wie kaum eine andere philosophische Richtung (von Wittgenstein klar erkannt). Alfred Schütz erläutert die eidetische Reduktion, die das Wesen (eidos) eines Gegenstandes herausschälen soll, so: "Angenommen, ich hätte auf diesem Schreibtisch, von einer Lampe beleuchtet, einen roten hölzernen Würfel von einem Zoll Kantenlänge vor mir. ( ... ) Ich kann ... ungehindert diesen wahrgenommenen Gegenstand in meiner phantasierenden Vorstellung verändern, indem ich nacheinander seine Merkmale variiere – seine Farbe, seine Grösse, das Material, aus dem er gefertigt ist, seine Beleuchtung, seine Umgebung und seinen Hintergrund, die Perspektive, in der er erscheint, und so fort. So kann ich mir eine unendliche Zahl verschiedener Würfel vorstellen. – Aber diese Variationen lassen eine Gruppe von Merkmalen unberührt, die allen vorstellbaren Würfeln gemeinsam ist, z.B. ihre Rechtwinkligkeit, ihre Begrenzung in sechs Quadraten, ihre Körperlichkeit. Dies in allen vorstellbaren Transformationen des konkreten wahrgenommenen Dinges unveränderliche Gruppe von Merkmalen – sozusagen der Kern aller vorstellbaren Würfel – wird man als die wesentliche Charakteristik des Würfels bezeichnen, bzw. mit dem griechischen Begriff, als sein eidos. Es ist kein Würfel denkbar, der nicht diese wesentlichen Merkmale hätte. Alle anderen Qualitäten und Merkmale des beobachteten konkreten Gegenstandes sind nicht wesentlich." Natürlich könnte ich auch die Rechtwinkligkeit und alles andere in meiner Vorstellung verändern, bis zum Beispiel alle Punkte der Oberfläche gleich weit von einem Mittelpunkt entfernt wären. Dann würde man es eben Kugel nennen und nicht mehr Würfel. Der ganze Zauber beruht darauf, daß man die bekannten definierenden Merkmale eines Würfels vorab hineinsteckt und dann wieder heraus-"reduziert". Es ist kaum mehr als ein Kalauer, wird aber viel bestaunt. Soviel zur "Wesensschau". Was die Phänomenologen seit Husserl alles erschaut zu haben behaupten, füllt ganze Bibliotheken, aber irgendeinen Wert kann ich darin nicht erkennen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.01.2016 um 15.20 Uhr |
|
Zu diesem Thema gehören auch verstreute Beobachtungen, von denen ich nur diese angeben will: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=261#28887 |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.01.2016 um 15.16 Uhr |
|
Zu "systematisch irreführenden Ausdrücken" vgl. Ryle (unter diesem Titel). Natürlich hat auch Skinner den Irrtum durchschaut: „Viele Ausdrücke, die scheinbar die Eigenschaften von Dingen beschreiben, müssen so verstanden werden, daß sie zumindest teilweise durch private Reize gesteuert werden. Bekannt ist ein gutes Beispiel. Ein bekannter Platz ist nicht durch irgendwelche physischen Eigenschaften ausgezeichnet. Er ist nur demjenigen bekannt, der ihn oder etwas Ähnliches schon zuvor einmal gesehen hat. Jeder Platz, den man öfters sieht, wird einem bekannt. Die Reaktion Sein Gesicht ist bekannt läßt sich nicht auf dieselbe Weise interpretieren wie Sein Gesicht ist rot. Die Bedingung, die für bekannt verantwortlich ist, liegt nicht im Reiz, sondern in der Geschichte des Sprechers. Nachdem der Sprecher die Reaktion im Hinblick auf diese Eigenschaft erworben hat, kann er sie in Gegenwart anderer oft wahrgenommener Gegenstände hervorbringen. Hat er sie in bezug auf zuvor gesehene visuelle Reize erworben, kann er sie in bezug auf früher gehörte Töne, einen früher wahrgenommenen Geschmack usw. hervorbringen. Man kann solche Reaktionen nur dann in vollem Umfang verstehen, wenn man annimmt, daß das Individuum auf gewisse Züge seines eigenen Verhaltens reagiert, die mit dem Ergebnis wiederholter Reizung zusammenhängen.“ (VB 136) |
