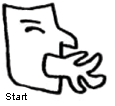


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
22.05.2011
Naturvolk
Fabelhaftes über Indianer
Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung hat Chris Sinha herausgefunden, daß die Amundawa (nur noch 150 Leute) keine Zeitbegriffe haben.
Weiter braucht man nicht zu lesen, es kann nur Unsinn sein. Die Whorfschen Hopis sind ja noch unvergessen.
Hübsch ist aber das beigegebene Foto. Dort sieht man rund 10 Prozent der Gesamtpopulation, einen Häuptling nebst drei Frauen in vollem Ethno-Outfit, Baströckchen, Federschmuck, Speer usw. Komischerweise sieht man über den bloßen Brüsten der Frauen die hellen Streifen, die von den Spaghetti-Trägern der sonst wohl getragenen Sommerkleidchen zurückgeblieben sind. Und die Kinder und jungen Männer im Hintergrund tragen sowieso C&A-Hemden und Hosen (made in China), genau wie wir. Zeitbegriffe haben sie nicht, aber wo man günstig einkauft, wissen sie offenbar recht gut.
| Kommentare zu »Naturvolk« |
| Kommentar schreiben | neueste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.03.2013 um 06.13 Uhr |
|
Man stelle sich eine Sprache vor, in der es kaum Nebensätze und überhaupt keine indirekte Rede gibt. Primitiv, nicht wahr? Nun, ich denke an das klassische Sanskrit. Was die indirekte Rede betrifft, so sind viele von uns durch die Schule des Lateinischen gegangen und nehmen es mit einiger Überraschung (und Erleichterung) zur Kenntnis, daß die Griechen da ziemlich kurzen Prozeß machen und so bald wie möglich in die direkte Rede zurückfallen. Gern setzen sie einen gesprochenen Doppelpunkt (hoti = daß), der ungefähr dem allerdings nachgestellten iti (= so) der Inder entspricht. Manche versuchen, die lateinische indirekte Rede auch dem Deutschen aufzuzwingen, natürlich vergeblich. Der krasse Nominalstil des Sanskrit kommt uns papieren vor, die Vorliebe für das Passiv (beides in den neuindischen Sprachen fortgesetzt, also doch irgendwie volkssprachlich, man nimmt Substrateinfluß an) erst recht, aber die klassischen indischen Dichter fanden es süß und lieblich. Das zeigt, daß wir uns immer noch zu wenig in diese Sprache hineingelebt haben. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 16.03.2013 um 13.05 Uhr |
|
Ich habe den Eindruck, daß die deutsche Sprache besonders viele geschachtelte Nebensatzkonstruktionen enthält, während die anderen indogermanischen Sprachen mehr Partizipialkonstruktionen benutzen. Unpersönliche Partizipialkonstruktionen gelten im Deutschen irgendwie als schlechter Stil.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.06.2013 um 13.19 Uhr |
|
Fremde Sprachen werden durch vermeintlich "wörtliche" Übersetzung noch mehr verfremdet – ein methodischer Fehler, der eigentlich schon lange durchschaut ist und beispielsweise durch Georg von der Gabelentz kritisiert wurde. Whorf war ihm verfallen. Aber was geschieht denn, wenn wir die Wendungen unserer guten alten deutschen Sprache in dieser Weise wörtlich und etymologisch zu verstehen versuchen? Das sagt zum Beispiel die Mutter: Ab ins Bett mit dir! Wer geht denn da zusammen ins Bett? Was sind das für komische Sitten! (Solche Sätze sind als "verblose Direktive" kürzlich mehrmals behandelt worden.) Die Erklärung gibt Hermann Paul in seinem Deutschen Wörterbuch: „In einer Aufforderung wie weg mit ihm ist eigentl. eine Person (oder mehrere) angeredet, die mit jemandem weggehen, ihn wegschaffen soll; dabei ist aber jetzt nur noch die Vorstellung lebendig, daß jemand (bzw. eine Sache) auf irgendeine Weise weggeschafft werden soll; ähnlich hinaus, hervor, her m. usw.; vgl. auch in Stücken mit dem Andreas Schi.“ (Paul s. v. mit) (Das Zitat ist aus dem Fiesco.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.08.2013 um 09.09 Uhr |
|
„Nichts ist gefährlicher, als wenn man eine fremde Sprache unter dem Prisma zwischenzeiliger Übersetzungen und Analysen betrachtet. Beim besten Wille kleidet man doch den fremden Körper in das eigene Gewand, zieht ihm wohl unversehens den linken Stiefel an den rechten Fuss und hat dann billig spotten und tadeln. Es ist ein summarisches Verfahren, dessen vorübergehenden Werth für den Lehrzweck Niemand bestreiten wird, das aber für die Abschätzung einer fremden Sprache geradezu verhängnisvoll werden kann. Man darf kühnlich annehmen, dass nicht zwei grammatische Formmittel verschiedener Sprachen einander in ihrer Bedeutung vollständig decken.“ (Georg von der Gabelentz: Die Sprachwissenschaft. Tübingen 1901/1972:405 ) „Ein wa ga sakura wo miru 'mein Kirschblüten Sehen' verrät schon durch die Übersetzung, daß es nicht so aktivisch ist wie ein 'ich sehe Kirschblüten' (...)“ (Peter Hartmann: Einige Grundzüge des japanischen Sprachbaues. Heidelberg 1952) „In einem baskischen Verbalsatz heißt es 'Der Stein ist ein von mir geworfener', wo wir sagen 'Ich werfe den Stein', oder es sei an das bekannte japanische Beispiel 'Mein Kirschblütensehen' statt 'Ich sehe Kirschblüten' erinnert.“ (Kurt Stegmann von Pritzwald: „Zur Leistung der lateinischen Grammatik für die kategoriale Denkschulung“. Der altsprachliche Unterricht 1961:106-122, S. 119) „Wenn ein Japaner beispielsweise Kirschblüten sieht, dann würde er nicht sagen: Ich sehe Kirschblüten, sondern: Mein Kirschblüten-Sehen.“ (Paul Grebe in Dudengrammatik, 1. Aufl.:414) Das würde bedeuten, daß die Japaner nicht einmal richtige Sätze bilden. Erst übersetzt man falsch, und dann folgert man daraus die linguistische Relativität. Das sieht auch Roger Hart so. Er bespricht das Beispiel der Euklid-Übersetzung ins Chinesische: „Martzloff's translations convey the radical otherness of classical Chinese by employing techniques of defamiliarization similar to those used elsewhere to demonstrate (again, in English) the purported awkwardness of Chinese monosyllabism: „King speak: Sage! not far thousand mile and come; also will have use gain me realm, hey?“ Indeed, Martzloff argues against "more elegant, more grammatical" renderings, stating that "English grammaticality tends to obliterate the structure of the Chinese and the connotation of the specialised terms." (...) „The differences Martzloff presents are the artifacts of these choices he makes in his translation.“ (...) „First, he insists on an extreme literalism in his selections of possible equivalents, for example „straight strings“ for xian and „flat ground“ for pingdi, with the latter marked by sic to emphasize the inappropriateness of what was, after all, his own choice. He marks articles with brackets. However, Martzloff's most jarring technique is his omission of the copula in English, a language in which the copula is denoted lexically.“ (Roger Hart: Translating the Untranslatable: From Copula to Incommensurable Worlds) So hat man auch die geläufige Übersetzung eines Sokrates-Ausspruchs „Ich weiß, daß ich nichts weiß“ kritisiert und ihm die „wörtliche“ Übersetzung „Ich weiß als Nichtwissender“ gegenübergestellt. (Der Satz kommt so in Platons „Apologie“ nicht vor, aber darum soll es hier nicht gehen.) Das ist jedoch nur scheinbar genauer: oida ouk eidos ist eine typisch altgriechische Konstruktion mit dem Partizip als Ergänzung gewisser Verben. Während „ich weiß“ in der vermeintlich wörtlichen Übersetzung ergänzungslos erscheint, ist das im Original durchaus nicht der Fall. Man könnte also genauer übersetzen: „Ich weiß, daß ich nicht (statt ‚nichts‘) weiß“, es läuft aber auf dasselbe hinaus, denn Sokrates sagt ja an mehreren Stellen deutlich genug, was er meint: emauto gar synede ouden epistameno hos epos eipein. (Sprachkundige werden gebeten, die Vokallängen und diakritischen Zeichen zu ergänzen.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.08.2013 um 11.42 Uhr |
|
Ich will noch nachtragen, daß ich nicht ohne Anlaß auf das Thema der "wörtlichen Übersetzung" und besonders auf Sokrates gekommen bin. Vielleicht hat mich der Fall Mollath (ein bayerischer Justizskandal) darauf gebracht, das alte Buch "Philosoph in Haar" noch einmal zur Hand zu nehmen. Es handelt sich um das "Tagebuch über mein Vierteljahr in einer Irrenanstalt" von Hermann K. A. Döll. Das ist das Pseudonym des (bald darauf verstorbenen) Göttinger Philosophieprofessors Hermann Wein. Der Verfasser macht einiges Aufheben von "ich weiß nicht-wissend", also einen sprachlichen Irrtum, den ich ja schon diskutiert habe. Wein ist heute ziemlich vergessen. Er war Schüler von Nicolai Hartmann, Lehrer von Jan Knopf und einigen anderen Leuten und seinerzeit recht bekannt. Ich kann mit seiner Philosophie nichts anfangen, aber das ist nichts Besonderes, weil ich inzwischen mit Philosophie sowieso nichts mehr anfangen kann und will. Man darf nicht erwarten, daß der Professor sozusagen durch einen Irrtum in die (in München und Umgebung sehr bekannte) Anstalt gekommen ist und dann, wie im Film, gegen eine bürokratisch-medizynische Maschinerie ankämpft, um wieder herauszukommen. Vielmehr war Wein durch einen "entgleisten" Diabetes kurzzeitig verwirrt und aggressiv geworden und blieb so lange in der offenen Abteilung, bis er eben wieder einigermaßen stabilisiert war. Er charakterisiert das Personal, lernt täglich dazu, jammert und triumphiert, kehrt den Professor heraus und weiß zugleich, daß er im Grund ein armes Würstchen ist. Die Lektüre ist nicht unbedingt angenehm, aber trotzdem kann man nicht aufhören. Übrigens blickt Wein zwar auf seine Ruhmestaten zurück (um seine Selbstachtung nicht ganz zu verlieren, wie er auch ganz genau weiß), verschweigt aber, was er nach dem Dritten Reich gegen jedermann verschwiegen hat: seine Tätigkeit im Amt Rosenberg. Plessner hat ihn unterstützt und fiel aus allen Wolken, als er durch Gadamer von der Vergangenheit seines Schützlings erfuhr. Mit diesem Wissen liest man das "Tagebuch" noch einmal anders. (An einer Stelle berichtet er, wie er sich einem Pfleger vorstellt: "Wein wie Bier" – unfreiwillig seinen Klarnamen preisgebend.) Ich breche hier ab, kann das Buch aber empfehlen, weil es so vielschichtig ist, und wer weiß, was uns selbst alles noch passieren kann! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.02.2016 um 08.21 Uhr |
|
„Wir finden bei den primitiven Feuerländern Ausdrücke, die holophrastisch viel umfassender sind als irgendwelche vergleichbare Sprachformen (...) der westlichen Kultur. So bedeutet der Ausdruck mamichlapinatapi ungefähr: 'Einander anblickend hofft jeder, daß der andere anbieten wird, etwas zu tun, was beide wünschen, aber zögern zu unternehmen.' (Heinz Werner: Einführung in die Entwicklungspsychologie. 4. Aufl. München 1959:231) Hier wird eine Interpretation als Übersetzungsäquivalent geboten, was auch bei vielen deutschen Wörtern zu sehr umfangreichen Ausdrücken führen würde. Ein weiteres Beispiel für die verfehlte Methode. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.06.2017 um 13.43 Uhr |
|
Helmut Gipper war einer der bekanntesten Vertreter des "linguistischen Relativitätsprinzips" im Sinne Weisgerbers und (soweit zutreffend) Humboldts. Er glaubte aber, man könne die Weltansicht am besten in einer Sprache aufspüren, die man am besten beherrscht, also am ehesten in der Muttersprache. Aber selbst wenn man einige weniger gut beherrschte Fremdsprachen zum Vergleich heranzieht – wie könnte das gelingen? Man sieht ja die anderen, so die These, durch die Brille der eigenen, und die eigene sieht man gar nicht, wie es eben bei Brillen so zu sein pflegt. Konfabulationen von Deutschen über das Weltbild der deutschen Sprache gibt es viele, aber sie sind zu Recht vergessen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.12.2018 um 17.25 Uhr |
|
Sprachforscher Nikolaus Himmelmann hat ja recht, wenn er im Gespräch mit der FAZ (3.12.18) das Aussterben von Sprachen bedauert. Zur Begründung führt er an: „Jede Sprache ist ein Wissensspeicher.“ Er erwähnt die volkstümlichen Taxonomien von Pflanzen etwa in Südamerika. Aber das „indigene Wissen über Pflanzen“, das die pharmakologische Forschung nutzbar machen könnte, steckt nicht in den Sprachen, sondern in den Köpfen ihrer Sprecher. Die hustenlindernde Wirkung von Huflattich könnte man aus dem Namen Tussilago erschließen, aber die Deutschen mit ihrem Huflattich waren darauf nicht angewiesen. Sprachen mit Evidenzmarkern, die er erwähnt, machen ihre Sprecher nicht schlauer. Und als Beispiel für den Relativismus führt Himmelmann die allbekannte Nichtunterscheidung von blau und grün in manchen Sprachen an. Allerdings schränkt er die starken Thesen der Relativitätstheoretiker mit Recht ein. Sprachen sind keine Wissensspeicher, sondern sehr komplexe Verständigungstechniken. Gelehrte und Dummköpfe sprechen dieselbe Sprache, bei unwesentlichen Unterschieden in Wortschatz und Register. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.12.2018 um 06.13 Uhr |
|
Friedrich Blatz hätte in seiner immer noch wertvollen deutschen Grammatik darauf verzichten können, aber er macht in zeittypischer Weise Aussagen wie diese: Die einsilbigen chinesischen Worte sind nicht verwitterte Überreste eines früheren mehrsilbigen Sprachbaues, wie es zum Teil im Englischen der Fall ist, sondern ursprüngliche unentwickelte Wurzeln. Dann ähnlich die Humboldt: Diese Sprachklasse steht offenbar auf der niedrigsten Stufe der Entwickelung; denn sie bezeichnet den ganzen Hergang des Denkens, die Begriffe selbst und ihre Beziehung zu einander nicht in bestimmten Wortgestalten, sondern nur andeutungsweise. Chinesisch soll daher der Ursprache nahestehen. Die agglutinierenden Sprachen stehen schon höher, aber: Die flektierenden Sprachen sind die vollkommensten, die der menschliche Geist gestaltet hat, und alle Völker, die bis jetzt in der Geschichte als die Träger der Kultur aufgetreten sind, gehören der flektierenden Sprachklasse an. Die chinesische Kultur zählt also gar nicht. Die Verundeutlichung durch Verschmelzung gegenüber den klareren, aber oft „unförmigen“ Formen der agglutinierenden Sprachen bewertet Blatz positiv als „Abrundung“. Große Gelehrsamkeit und Scharfsinn können mit ebenso großer Blindheit einhergehen. Wer weiß, was Spätere kopfschüttelnd bei uns feststellen werden? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.12.2018 um 06.23 Uhr |
|
Zum vorigen Eintrag: Jede Sprachgemeinschaft arbeitet buchstäblich von morgens bis abends daran, sich einander verständlich zu machen. Die Annahme, daß die jeweils vorhandenen sprachlichen Mittel (eigentlich Verfahren) das übrige Verhalten beschränken, so daß es gar nichts Neues mitzuteilen gäbe, kann man wohl als überholt beiseite lassen. Dann ist es aber von vornherein äußerst unwahrscheinlich, daß Milliarden Chinesen sich jahrtausendelang erfolglos mit ihrer unzulänglichen Sprache herumgeschlagen hätten, ohne über "Andeutungen" des jeweils Gemeinten hinauszukommen. Mit dieser Frage hat sich schon Humboldt geplagt, Blatz stellt sie sich gar nicht erst. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.01.2019 um 05.48 Uhr |
|
Die chinesische Sprache und damit die chinesische Weltansicht sind so verschieden von unserer, daß die Chinesen niemals eine Rakete zum Mond werden schießen können. (Sie haben zwar die Rakete erfunden, aber nur zur Feuerwerksspielerei.) Auch Eisenbahnen zu betreiben werden sie nie verstehen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.02.2019 um 04.39 Uhr |
|
Die Forderung, dasselbe (= formal identische) Wort immer mit demselben zielsprachlichen Wort zu übersetzen, geht an einer grundlegenden Einsicht vorbei. Beispiel: gesund. Wenn es eine Definition gäbe, die auch nur die beiden Hauptverwendungen von gesund (sanus, saluber) deckte, wäre sie so allgemein, daß man sie nicht gebrauchen könnte, aber auch geradezu falsch, denn die Deutschen selbst würden nicht gesunden Spinat und gesunde Kinder in einer einzigen Aufzählung unterbringen. Die Forderung ist von so bedeutenden Sprachwissenschaftlern wie Paul Thieme erhoben worden, der u. a. aus dem Rigveda und den Upanishaden (Reclam) übersetzte. Es liefe, konsequent befolgt, darauf hinaus, mit deutschen Wörtern einen Teil des altindischen Sprachsystems nachzubilden. Das ist aber keine Übersetzung mehr. Natürlich fragt sich, ob aus fremden Kulturen überhaupt übersetzt werden kann, und „fremd“ in diesem Sinne ist auch der liebe Nachbar, der zwar ebenfalls Biodeutscher ist und deutsch spricht, aber z. B. irgendwie „spirituell“ ist, also lauter Wörter gebraucht, die ich nicht „verstehe“, auch wenn ich ihren Gebrauch kenne. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.02.2022 um 04.37 Uhr |
|
Die moderne Sprachwissenschaft hat aber gezeigt, dass alle aktuell existierenden Sprachen über eine ähnlich komplexe Grammatik, ähnlich große Wortschätze etc. verfügen. Sie alle sind in dem Sinne gleichwertig, als sie ihren Sprechern ermöglichen, miteinander zu kommunizieren und sie alle besitzen ein ähnlich komplexes Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten. Es gibt keine logischeren oder (objektiv) ästhetischeren Sprachen. https://www.klett.de/alias/1004174 (Infoblatt Sprachen) So besitzen beispielsweise die Sprachen der Inuit (Eigenbezeichnung der "Eskimos") zahlreiche unterschiedliche Begriffe für verschiedene Arten und Zustände von Schnee – er spielt in ihrer Umwelt schließlich eine ausgesprochen wichtige Rolle. Gleichzeitig existieren australische Aborigine-Sprachen, die nur eins, zwei und viele als Zahlwörter kennen. Unterschiede werden dann benannt, wenn sie relevant sind. Aber wenn man in einer Sprache nicht zählen kann, ist sie eben nicht „gleichwertig“. Ein australischer Ureinwohner, der Englisch lernt, begreift die dort verwendeten Zahlworte problemlos, ebenso wie ein Deutscher, der Inuit lernt, sich die vielen Begriffe für Schnee aneignen kann. Eben: Man muß erst Englisch lernen, um zählen zu können. Es geht also bei der „Gleichwertigkeit“ um die Menschen und ihre Lebensweisen, nicht um ihre Sprachen. Übrigens möchten viele Naturvölker die Segnungen der Zivilisation genießen, umgekehrt eher nicht. Man kann den „Ureinwohnern“ schwerlich einreden, ihr Leben samt angepaßter Sprache sei gleichwertig mit dem eines wohlhabenden Amerikaners. Die Gleichwertigkeit wird über die Köpfe der Betroffenen hinweg beschlossen und verkündet. Eine ausgebaute Sprache ist in einem definierbaren Sinn besser. Ein Messer ist im gleichen Sinn besser als ein Stein oder Faustkeil, eine Schußwaffe besser als ein Wurfgeschoß. Niemand möchte zurück. Der edle Wilde mit seinem beneidenswert einfachen Leben ist eine Kopfgeburt verwöhnter Europäer. Man muß sich blind stellen, um das nicht zu sehen. |
Kommentar von TheodorIckler, verfaßt am 01.08.2022 um 18.39 Uhr |
|
Können ganze Völker, die das individuelle Urheberrecht nicht kennen, Urheberrechte an ihrer Kultur (z. B. am Stil ihrer Textilien) geltend machen? Auch wenn die Türken in Mozarts Türkischem Marsch nicht Türkisches erkennen mögen – könnten sie nicht die Absicht für die Tat nehmen und hier wie auch sonst an „Janitscharenmusik“ Rechte geltend machen und Entschädigung verlangen? Was ist von den vielen Folklorismen zu halten, mit denen die „Indigenen“ (oder die sich dafür halten) die zahlenden Touristen erfreuen? Es gibt lustige Fotos wie hier erwähnt: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1453 – Soll man ihnen gerichtlich verbieten lassen, sich selbst zum Affen zu machen? |