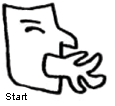


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
30.01.2011
Stilistische Pracht
Nachtrag zur Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung
Man fragt sich ja nicht als einziger, wie die DASD auf Mosebach hereinfallen konnte. Zur Begründung des Büchner-Preises rühmte die Akademie ihm "stilistische Pracht" nach, was ja eigentlich ein Todesurteil ist.
Bei Mosebach (auch in seinem neuesten Roman) spürt man ja in jeder Zeile, wie er sich über seine eigene Prächtigkeit freut. Pracht ist Fassade, Unwahrheit. Auch die ebenfalls gerühmte "Eleganz" gehört dazu.
Freude am Gelingen gibt es bei jedem großen Schriftsteller, bei Thomas Mann wie bei Franz Kafka. Mosebach schreibt "wie" ein großer Schriftsteller, ist aber keiner, und er verrät sich natürlich, wie jeder Fälscher. Das ist inzwischen so oft nachgewiesen worden, daß ich mir Einzelheiten sparen kann. Ich wollte aber doch noch mal auf das Ideal der "stilistischen Pracht" hingewiesen haben, weil es das genaue Gegenteil dessen ist, was wir heute gut gebrauchen könnten. Dazu müßte man aber erst einmal die kindlich-kindische Freude am Prächtigen überwinden. Die DASD wird es wohl nicht schaffen. Falls ihr jemand angehört, der mal mit der Faust auf den Tisch schlagen und den Kitsch Kitsch nennen könnte, geht er nicht zu den Versammlungen. Deshalb haben wir von dort auch wenig zu erhoffen.
| Kommentare zu »Stilistische Pracht« |
| Kommentar schreiben | neueste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von R. M., verfaßt am 30.01.2011 um 17.30 Uhr |
|
Muß man in der sprachlichen Stilistik an dem Dogma festhalten, daß Ornament Verbrechen sei? Das Gewählte und Preziöse ist ja nicht unbedingt falsch und ein schlichter Stil nicht notwendigerweise Ausdruck künstlerischer oder intellektueller Redlichkeit. Unwahrheiten lassen sich auch schmucklos vortragen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.01.2011 um 17.52 Uhr |
|
Kleines Gedankenexperiment: Mosebach erzählt seinen Enkeln: "Damals habe ich wegen meiner stilistischen Pracht den Büchnerpreis bekommen." Das wäre ja nur als Distanzierung denkbar ("so verrückt war man damals").
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 30.01.2011 um 18.57 Uhr |
|
Für den Wortlaut der Verleihungsbegründung kann man Mosebach nicht verantwortlich machen; dafür müßte schon Reichert seinen Kopf hinhalten. Oder soll man mutmaßen, der Text sei gemeinsam beim Apfelwein ausgeheckt worden?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.01.2011 um 10.42 Uhr |
|
Aber das Prädikat trifft zu! Das ist ja gerade das Fatale. Über Mosebachs eigene schiefe Formulierungen haben wir doch schon gesprochen. Sie sind allesamt im Drang zum Höheren begründet. Andere Schriftsteller würden "stilistische Pracht" als üble Nachrede empfinden, Mosebach nicht.
Ich weiß nicht, ob es auch nur Pointenhascherei ("intellektuelle Brillanz") ist, aber wenn Mosebach im Zusammenhang mit der Kinderschändung an Klosterschulen usw. von "Mißbrauchsopfer" spricht, denkt wohl jeder zuerst an die vergewaltigten jungen Menschen. Nicht so Mosebach, er meint damit seine katholische Kirche.
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 31.01.2011 um 12.04 Uhr |
|
»Mißbrauchsopfer« – das ist eher dürftig als prächtig. Die einzige Prächtigkeit, die Mosebach hier bisher vorgehalten wurde, war, wenn der Suchfunktion vertraut werden kann, seine Titulierung Henscheids als »der unversöhnliche Thersitide von Amberg«. Ausgerechnet anläßlich der Verleihung des Jean-Paul-Preises muß so etwas aber erlaubt sein, und treffend ist es eigentlich doch auch. Vielleicht hat der so Titulierte bis heute nicht begriffen, daß die Bezeichnung keineswegs schmeichelhaft ist – na und?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.01.2011 um 17.04 Uhr |
|
Das sollte natürlich auch kein Beispiel für Prächtigkeit sein, ich hätte einen Absatz machen sollen. Der "altmeisterliche" Stil mitsamt den grammatischen Schnitzern ist anderswo hinreichend ausgebreitet und kommentiert worden. Wenn es nötig sein sollte und wenn ich Zeit finde, werde ich aber gern noch ein bißchen nachliefern. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.02.2011 um 17.14 Uhr |
|
Auch wenn man nicht in allen Einzelheiten zustimmt, ist die Stilblütensammlung von Peter Dierlich doch eindrucksvoll genug und steht noch im Netz: http://jungle-world.com/artikel/2008/05/21117.html Ich habe im Augenblick keine Zeit, mich ausführlicher über Mosebachs Stil zu verbreiten. Wer es nicht Seite für Seite spürt, wird es wohl ohnehin nicht weiter schlimm finden. Ich will ja auch niemandem sein Vergnügen schmälern. |
Kommentar von Romantiker 2.1, verfaßt am 02.02.2011 um 23.06 Uhr |
|
Martin Mosebachs reiste wiederholt zu Nicolas Gomez Davila nach Südamerika. Aus diesen Begegnungen heraus schrieb er einen knappen Essay (ich würde von einer kleinen, wunderbaren Geschichte reden), der als Einleitung im Band Notas von Matthes & Seitz gedruckt wurde. Es gibt niemanden, der Davila so herzlich, so nah beschrieben hätte. Sechs Buchseiten – und es öffnen sich Türen. Die prächtigen Gründerzeithäuser, vor denen ich jeden Tag auf die Tram warte, mögen dekadent anmuten, sie bilden aber das Herz der Stadt, von den spießig reduzierten Glasbetonkuben kann man das beileibe nicht sagen. Sie sind halt Kulisse, für einen Spaziergang (19. Jahrhundert) oder fürs Phantasieren schätze ich sie. Sie enstammen dem Bürgertum. Lieber altmeisterlich herumgeschnitzt, als vereinnahmend hingeklotzt. "Vielleicht hat der so Titulierte bis heute nicht begriffen, daß die Bezeichnung keineswegs schmeichelhaft ist – na und?" Vielleicht ist er ja auch nur ein feiner Mensch und übergeht das stillschweigend. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 03.02.2011 um 02.01 Uhr |
|
Uff – das war hart, vieles mußte ich mehrmals lesen, um zu verstehen, warum es eigentlich nicht zu verstehen ist. Ehrlich gesagt, stilistische Pracht hatte ich mir anders vorgestellt, und auch der "Thersitide" hat mich auf die falsche Spur geführt. Also, tut mir leid, den Essay über Davila kenne ich nicht, und auch sonst nichts von Mosebach, nur jetzt diese von P. Dierlich gesammelten Zitate. Immerhin, zumindest am Anfang war die Lektüre ganz amüsant. Dann empfand ich eine Zeitlang nur noch Mitleid für diesen Autor. Seit dem Ende glaube ich aber, daß das alles nicht sein kann. Das hat ja nichts mehr mit Stil zu tun. Da macht sich einfach ein genialer Komiker einen Jux. Das ist doch nichts anderes als das kerkelingsche "Hurz"! Ich frage mich jetzt nur, schließlich ist der Büchnerpreis kein Karnevalsorden, was sind das für Leute, die so etwas für preiswürdig befinden? |
Kommentar von Romantiker 2.1, verfaßt am 03.02.2011 um 11.43 Uhr |
|
Schulmeister Peter Dierlich weiß natürlich, wie man ihn schreibt: den Weltroman - drunter geht nichts. Möchte wissen, wer diesem Prüfkatalog standhält. Er könnte ja mal die Georg-Büchner-Preisträgerliste durchexerzieren. Überschneidungen oder Vorlieben der Akademie lassen sich sicherlich finden. Mosebach reiht sich da meines erachtens prächtig ein. Mosebach (bis auf genannten Essay) habe ich wie die meisten anderen Preisträger auch nicht gelesen. Darüber verlier ich keine großen Worte. Warum so viel Geschrei?! Kitsch ist allzu menschlich, Umständlichkeit ebenso. Wen interessiert der Zinnober der Akademie? Die Kritiker, die Marge-Buchsellers, die Anwärter. Und so genießen die Kunden den Schinken, andere schneiden ihn in dünnste Scheiben, legen diese unters Mikroskop und finden Trichinen. – Dieses Peterchen schürt mächtig angst, ich spür schon, wie er hinter mir steht – |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.02.2011 um 12.10 Uhr |
|
Die Liste der Büchnerpreisträger – nun ja, das ist wie mit den Literaturnobelpreisträgern. Das Argument macht mir keinen Eindruck. Vor Jahrzehnten wunderte sich der junge Karlheinz Deschner schon mal lautstark darüber, daß die rein sprachliche Qualität bei der Beurteilung der Literatur so eine geringe Rolle spielte. Mosebachs ständig spürbare Bemühung um den gediegenen Ausdruck, eine Altmeisterlichkeit aus zweiter oder dritter Hand gewissermaßen, ist das eine, seine sprachlichen Schnitzer sind das andere. Aber die meisten Literaturkritiker fallen drauf rein. Dierlich, der mich sonst nicht weiter interessiert, hat mit seinem bösen Blick die Schwachstellen erkannt und gesammelt. Das ist ungerecht, aber die Sachen stehen ja wirklich da. Sehen Sie sich die Leseproben im Internet an! "Der Mond und das Mädchen": Da hat der Held die Frau vor ein paar Tagen geheiratet und läßt zehn Zeilen später die ersten Wochen der Ehe vor seinem geistigen Auge vorbeiziehen. Aber alles hübsch gedrechselt formuliert. Und die dicken Grammatikfehler, die lassen sich mit der schönsten Interpretationskunst nicht wegzaubern. Andere Preisträger machen auch solche Fehler – ja und? Was nutzt die ungewöhnlichste Interpretation einer Klaviersonate, wenn der Pianist die Technik nicht beherrscht, aber dafür den Fuß gar nicht vom Pedal nimmt? Eigentlich interessieren mich Romane nicht besonders. Mir geht es um, nun ja, ein gewisses Ethos des Umgangs mit der Sprache. Die Ablehnung des Ornaments ist nur ein winziger Teil davon. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 03.02.2011 um 15.13 Uhr |
|
"Wirkliche Kälte hat etwas mit vollständiger Gerechtigkeit gemeinsam. Sie vermag sogar als Stärke erscheinen und dämpft zunächst auch die Empörung der anderen." (Mosebach, Der Mond und das Mädchen, Seite 8) |
Kommentar von Romantiker 2.1, verfaßt am 04.02.2011 um 12.22 Uhr |
|
Lieber Herr Riemer, Herr Ickler, ja, das sehe ich auch so, mir ging halt dieser Dierlich auf die Nerven. Ich mag Romane übrigens auch nichts sonders ;-) aber Ornamente scheinen mir aus einem Bedürfnis heraus zu entstehen. – Selbst Klavierstars beherrschen viel nicht, man muß es nicht; und die, die es allzu gut können, wirken eben oft sehr steif. Brillanz ensteht nur, wenn man selbst bei einer Etüde nie die Musikalität vergißt, sonst "drischt" man, das schleicht sich ein und setzt sich fest. – Und wer macht schon einen anschaulichen Grammatikunterricht?! Mosebach ist schon "Extremist". Ich bekomme das nicht zusammen. Wie kann jemand so einen Stuß schreiben, der eben auch dieses Portrait Davilas schrieb?! Es mag, so vermute ich mal, daran liegen, daß letzteres aus einer für ihn wichtigen Erfahrung heraus über die Jahre hin in ihm gewachsen ist. Es sozusagen direkt mit ihm zu tun hat, mit seiner Entwicklung, mit seiner Freundschaft zum Philosoph. Seine Romane rühren da scheint es aus einem gänzlich anderen Beweggrund her; auch hatte er, wie ich jetzt durch Dierlich erfahren habe, früh Erfolg, das verpflichtet und überfordert manchen. Letztlich finde ich seine Unbeholfenheit in der "professionellen Klasse" nun irgendwie drollig, sozusagen als Vertreter des Altväterlichen oder Schusseligen. So unter den ganzen Gestrengen eine gewisse Auflockerung. Es gibt – in diesem Zusammenhang nicht uninteressant – ein Phänomen bei musikalischen Aufführungen: Unter bestimmten Voraussetzungen der Räumlichkeit hört man nicht, ob mal eine Note ausgelassen, verschleppt oder verzogen wird. Oft erledigen Obertöne das für einen (und das Pedal tut da natürlich auch seine Dienste). Und – Obacht: Die Zuhörer sind kreativ, sie füllen die Lücken. In Seminaren waren wir immer wieder völlig von den Socken, daß wir Dinge beim Zuhören gehört haben, die nie gespielt oder eben anders und lückenhaft gespielt wurden. Es gibt viele solcher "Rätsel". Natürlich hört man einen Patzer, man muß aber vor allem nur lernen, diesen gut hinzukriegen. Ich glaube, hinsichtlich dessen kann es viel dankbarer sein, einem Text zu lauschen als vor einem Blatt mit sieben Siegeln zu brüten, – es walten ähnliche "Phänomene". Was machen wir nicht alle Fehler beim Sprechen, wir überhören es! Aber geschrieben sticht es einen sofort ins Auge – oder man "sieht darüber hinweg", auch eine Kunst. Das alles entschuldigt nicht Mosebachs Stilblüten. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 04.02.2011 um 13.55 Uhr |
|
Henscheid ein »feiner Mensch«? Das hat wohl noch keiner gemutmaßt. – Gegen Mosebach spricht neben der langen Mängelliste zweifellos auch, daß er, wie es heißt, von Golo Mann »entdeckt« worden sei.
|
Kommentar von WL, verfaßt am 04.02.2011 um 14.26 Uhr |
|
???
Golo Mann muß ja ein ganz übler Stümper sein!
|
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 07.02.2011 um 09.32 Uhr |
|
Ich habe als Junge gern Micky Maus gelesen. Deshalb schätze ich besonders Mosebachs Bemühen um originelle, beziehungsreiche Namen seiner Figuren. Sein Bankier Batzenberg beispielsweise ist eine köstliche Erfindung und erinnert fast an den großartigen Daniel Düsentrieb. Man fragt sich, warum Erika Fuchs nie den Büchnerpreis bekommen hat.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.05.2011 um 13.14 Uhr |
|
F. C. Delius ist anscheinend der erste Büchnerpreisträger, der in Reformschreibung gedruckt wird. Vielleicht meint er, das sei fortschrittlich, oder er denkt wie Rowohlt schon an die Gymnasien. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat eine Laudatio in fürchterlicher Klappentext-Prosa veröffentlicht: http://www.deutscheakademie.de/aktuell3.htm Zuletzt ringt sie sich noch folgenden Satz ab: Das Jubiläum ist mit einer Höherdotierung des Preisgeldes von ehemals 40.000 auf 50.000 Euro verbunden. Ein Fall von schiefem Attribut. Die ZEIT macht daraus: Das Jubiläum ist mit einem höheren Preisgeld von ehemals 40.000 auf 50.000 Euro verbunden. |
Kommentar von Oliver Höher, verfaßt am 18.05.2011 um 13.35 Uhr |
|
Das ist leider richtig, Herr Ickler. Mindestens seine beiden letzten Bücher sind in Reformschrieb gedruckt worden. Seine Internetseite hat über seine Bücher hinausgehend "Biografisches". Stolz listet er dort auch die vielen Sprachen auf, in die seine Bücher übersetzt wurden, und sogar die Sprachen, die demnächst noch folgen werden: http://www.fcdelius.de/ |
Kommentar von Oliver Höher, verfaßt am 18.05.2011 um 13.53 Uhr |
|
Noch ein unterhaltsamer Nachtrag zur orthographischen Gleichschaltung Delius': Aus dem Jahr 2003 stammt sein Buch "Warum ich schon immer Recht hatte – und andere Irrtümer". Würde Delius nicht dieser albernen Mode von vorgestern nachlaufen, wäre der Buchtitel (nicht der Inhalt!) heute immer noch zeitgemäß. So ist es ein unterhaltsames Dokument von der Verirrung eines deutschen Schriftstellers. Siehe hier: www.rowohlt.de |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.05.2011 um 15.00 Uhr |
|
Delius hat sich schon 1997 von Grass distanziert, was dessen Ablehnung der Rechtschreibreform betraf: „Auch ich habe seinen Ansichten nicht immer folgen können – zuletzt in der Debatte um die deutsche Vereinigung und um die Rechtschreibreform.“ (Der Tagesspiegel, 16.10.1997) |
Kommentar von Oliver Höher, verfaßt am 19.05.2011 um 10.01 Uhr |
|
"Vielleicht hat es mit der werkimmanenten Zurückhaltung dieses Schriftstellers zu tun, dass keine rechte Begeisterung über die Ehrung aufkommen will, mit welcher die Akademie nun eines ihrer langjährigen Mitglieder bedenkt. Fünf Jahre, von 2003 bis 2008, gehörte Delius übrigens selbst zu jenem inner circle, der über die Vergabe entscheidet. Ihm aber jetzt als Preisträger die Einfallslosigkeit der Akademie zur Last zu legen wäre ungerecht. Seine Wahl ist eine vernünftige, achtbare, aber etwas flaue Entscheidung. Die Akademie ist auf gutem Weg, ihre höchste Auszeichnung von einem Preis zu einer Personalie zu machen." So schreibt Felicitas von Lovenberg heute in der FAZ. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.05.2011 um 08.31 Uhr |
|
Namen wie Delius begleiten unsereinen ja über die Jahrzehnte, auch wenn wir nie eine Zeile von ihnen gelesen haben. Nun war ich wegen der Rechtschreibung doch mal neugierig und habe gestern "Bildnis der Mutter als junge Frau" gelesen. Das Bändchen ist also in Reformschreibung: übermorgen Abend, Recht haben, aber auch im allgemeinen, floß, des öfteren. Stellen aus Briefen stehen in herkömmlicher Rechtschreibung, was den dokumentarischen Charakter unterstreicht. Grammatisch etwas unsicher: was die Lehrerin ihnen eiligst verbat und: das war verboten zu denken, sie verbat sich das (verbot ist auch hier gemeint). Koppel (Ledergürtel) ist eigentlich neutrum, nicht femininum (nur im Österreichischen). Die Typographie (Komma als einziges Satzzeichen über 120 Seiten, seltsame Absatzschaltung) soll dem Text etwas Avantgardistisches geben, auch die Seitenzahlen sind unzweckmäßigerweise allesamt unten links, auf den rechten Seiten also im Falz. Dem widerspricht die konventionelle Psychologie. Die Hauptperson ist aus der Innenperspektive und trotzdem ohne Hintergründe dargestellt, naiv und brav. Auch wenn es die eigene Mutter sein soll – ein so flaches Menschenbild ist doch recht altmodisch, entgegen dem modernistischen Layout usw. Für Romreisende hat es bestimmt einen beträchtlichen Wiedererkennungswert. Ich verstehe aber die Vorbehalte der Literaturkritiker. Nicht schlecht, aber auch nicht gerade aufregend. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.12.2011 um 12.07 Uhr |
|
Da Karl Heinz Bohrer gerade die Herausgeberschaft des "Merkur" abgibt, ist es vielleicht an dieser Stelle angezeigt, an die sprachliche Pracht zu erinnern, mit der er das Feuilleton bereichert hat. Nach dem Tod Elvis Presleys schrieb er in der FAZ: In seinen Liedern und in seiner äußeren Erscheinungsform verkörperte sich zum ersten Mal der in seinen Folgen noch unabsehbare Überfall des Vital-Ungeistigen, Dubios-Ordinären, Hermaphroditisch-Klassenlosen auf eine primär intellektuell-akademische, privilegiert männliche, klassenspezifische Zivilisation. Aber ich gebe zu, ich habe gemogelt. In Wirklichkeit schrieb er: In seinen Liedern und in seiner äußeren Erscheinungsform verkörperte sich zum ersten Mal der in seinen Folgen noch unabsehbare Überfall des Vital-Ordinären, Dubios-Hermaphroditischen, Ungeistig-Klassenlosen auf eine primär intellektuell-akademische, privilegiert männliche, klassenspezifische Zivilisation. Oder vielmehr: In seinen Liedern und in seiner äußeren Erscheinungsform verkörperte sich zum ersten Mal der in seinen Folgen noch unabsehbare Überfall des Vital-Ordinären, Dubios-Ungeistigen, Hermaphroditisch-Klassenlosen auf eine primär intellektuell-akademische, privilegiert männliche, klassenspezifische Zivilisation. Oder war es dies: In seinen Liedern und in seiner äußeren Erscheinungsform verkörperte sich zum ersten Mal der in seinen Folgen noch unabsehbare Überfall des Vital-Hermaphroditischen, Dubios-Ungeistigen, Klassenlos-Ordinären auf eine primär intellektuell-akademische, privilegiert männliche, klassenspezifische Zivilisation. Oder dies: In seinen Liedern und in seiner äußeren Erscheinungsform verkörperte sich zum ersten Mal der in seinen Folgen noch unabsehbare Überfall des Vital-Ordinären, Dubios-Klassenlosen, Hermaphroditisch-Ungeistigen auf eine primär intellektuell-privilegierte, männlich akademische, klassenspezifische Zivilisation. Permutieren Sie ruhig weiter, es kommt immer ein echter Bohrer heraus! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.12.2011 um 11.48 Uhr |
|
Das Wort rasend wird meist mit schnell verbunden, und das paßt ja auch. Nun habe ich schon mehrmals von unserer rasend abstrakten Welt gelesen (Assheuer in der ZEIT, Poschardt in der Weltwoche). Darunter kann ich mir nichts vorstellen. Warum schreibt einer so etwas?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.03.2012 um 12.00 Uhr |
|
Nach der Pause spielte Sokolov Brahms. Das kann aber der Musikkritiker nicht schreiben, es wäre viel zu einfach. Also schreibt er: Und es beginnt das unsichtbare Theater des Grigori Lipmanowitsch Sokolow, eines Besessenen am Klavier, der sich jenseits von Moden und Schulen nur von einem leiten lässt: der eigenen Idee. Die zielt, um es klar zu sagen, an diesem Abend deutlich in Richtung Brahms. (Badische Zeitung 28.3.12) Überschrift: Mythos und Ikone am Klavier: Grigory Sokolov |
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 01.04.2012 um 08.05 Uhr |
|
Die Einleitung des Wikipedia-Artikels Mittellatein schließt mit folgendem Satz ab: Ausgehend von der Literatursprache der spätantiken Kaiserzeit, der Sprache der Jurisprudenz und der Kirchenväter, zuweilen, jedoch keineswegs durchgängig, beeinflusst von den romanischen Sprachen oder der jeweiligen Muttersprache des Autors, aber entgegen verbreiteten Vorurteilen („Küchenlatein“) immer wieder auch im Kontakt mit der antiken Literatur der klassischen Periode, insbesondere der Dichtung, entstand ein äußerst heterogenes Sprachmaterial, das die ganze Spannbreite von umgangssprachlicher, kolloquialer, pragmatischer Diktion bis zu hochrhetorischer oder dichterischer Stilisierung auf höchstem Niveau umfasst und in seinen Spitzenerzeugnissen den Vergleich mit der antiken, viel stärker durch die Selektion des Überlieferungsprozesses gefilterten Literaturproduktion genauso wenig zu scheuen braucht wie den mit der gleichzeitigen oder späteren volkssprachigen Literaturproduktion. Es wäre natürlich unerträglich, einen solchen Stil durchgängig lesen zu müssen, aber mitten in die nüchterne Lexikonsprache von Wikipedia plötzlich einen Thomas Mann einzustreuen, das finde ich prächtig. PS: Stutzig macht mich, daß ich dem vorhergehenden Satz von Assotiationen die Rede ist. Das will nicht zum sonstigen Niveau des Artikels passen. Assotiation ist sozusagen eine mittellateinische Schreibweise. Im Abschnitt "Graphie und Aussprache (Phonologie)" heißt es dazu: "[...] Da t und c vor halbvokalischem i [in der Aussprache] zusammengefallen war, werden sie auch in der Schrift sehr oft vertauscht, z. B. tercius für tertius, Gretia für Græcia." Vor lauter Beschäftigung mit Mittellatein hat der Verfasser womöglich Schwierigkeiten bekommen, klassisches Latein und Mittellatein auseinanderzuhalten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.07.2012 um 11.42 Uhr |
|
Mosebach ist anscheinend immer noch Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland. Seine Forderung nach religiöser Zensur, und zwar nach lebensbedrohlicher wie im Fall Salman Rushdie, widerspricht der Satzung, in der es heißt: "Das PEN-Zentrum Deutschland wirkt im Sinne der Charta des Internationalen PEN. Es setzt sich für politisch, rassisch, religiös oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft Verfolgte ein, insbesondere für Schriftsteller, Übersetzer, Herausgeber, Journalisten und Publizisten in aller Welt, die wegen freier Meinungsäußerung bedroht und verfolgt werden." Er sollte ausgeschlossen werden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.01.2013 um 05.27 Uhr |
|
Mosebach hat den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung bekommen. Prof. Michael Braun von der Stiftung begründet es. Er schreibt: Sein Plädoyer für ein „Blasphemieverbot“ in der „Frankfurter Rundschau“ vom 18. Juni 2012 ließ Kritiker vom „Gotteskrieger im Tweedjackett“ („Der Spiegel“) und „Deutschlands Religionspolizei“ („Cicero“) sprechen. Mosebach fand aber auch Zustimmung, wie der Autor im Dezember 2012 bei einer Veranstaltung im Belgischen Haus in Köln sagte: bei dem Philosophen Robert Spaemann und beim Bamberger Erzbischof Ludwig Schick. Wieso „aber“? Und was bedeutet die Forderung nach Todesstrafe für Gotteslästerung denn nun wirklich? Kann man darüber einfach hinweggehen und dem rabiaten Schöngeist den nächsten Preis verleihen? Was die Kritik an Mosebachs Romanen immer wieder hervorhebt, ist das „Vertrauen in die groteske Wendung und das Auge fürs sprechende Detail“ (Felicitas von Lovenberg), ist die Satzbaukunst, die von „formvollendetem Stil“ zeuge (Andrea Köhler), sind die „federnd wohlgefügten Satzperioden“ (Ijoma Mangold). Diese Stilkunst, die durch Eleganz, geistreiche Ironie, Anmut und Kühnheit überzeugt, ist freilich keine artistische Selbstfeier. Jedes Wort, welches das Gewöhnliche ins Kostbare zieht, dient der Durchleuchtung einer sprachverwahrlosten Gegenwart. Sprachliche Nachlässigkeit ist für Mosebach eine Untugend, weil der Schriftsteller sein Wortmaterial nicht beherrschen darf, sondern interpretieren muss. Ja, wenn man nicht so genau hinsieht, kann man das meinen. In dem Artikel ist übrigens viel von Bürgerlichkeit, Krawatten und guten Manieren die Rede. Bei Thomas Mann paßte das noch, hundert Jahre später wirkt es wie eine Verkleidung. |
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 31.01.2013 um 20.58 Uhr |
|
"Jedes Wort, welches das Gewöhnliche ins Kostbare zieht, dient der Durchleuchtung einer sprachverwahrlosten Gegenwart." Da kann man schon feuchte Augen bekommen. Aber das ist noch gar nichts. Das "Dschungelcamp" ist für den Grimmepreis nominiert. "Bernd das Brot" hat ihn schon. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.06.2013 um 18.14 Uhr |
|
Von Lewitscharoff hatte ich bisher nichts gelesen, außer Leseproben im Internet, wegen der Rechtschreibung, dann aber mit dem Ergebnis, daß ich weiter nichts lesen wollte. Nun bringt der ebenfalls sehr selbstverliebte Georg Diez im SPIEGEL einen schlecht geschriebenen Verriß, der aber immerhin einige Sätze von Lewitscharoff zitiert, und da muß man schon erschrecken. Schon wieder stilistische Pracht. Also nee, ehrlich!
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.10.2013 um 06.39 Uhr |
|
Ursula März lobte in ihrer Laudatio auf Lewitscharoff tatsächlich deren „ästhetische und sprachliche Pracht“. Lewitscharoffs Dankrede (von der FAZ am 28.10.13 in Reformschreibung wiedergegeben) war so belanglos, daß die FAZ sie im Vergleich zu anderen Reden wie Celans „Meridian“ als „etwas kurios“ bezeichnen zu müssen glaubte. Lewitscharoff erlaubte sich einen Seitenhieb auf die „grauenhafte Grammatikschändung“ durch den Feminismus und schrak auch nicht vor dem billigen Scherz zurück: „Professorin Heinrich Detering, willkommen in der weichen Welt des neuen deutschen Frauentums!“ |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.11.2013 um 07.22 Uhr |
|
"Sprachliche Pracht" deutet meist auf kunstgewerbliche Anstrengung. Das ist natürlich kein Verbrechen. Vor undenklichen Zeiten las ich zusammen mit einer taiwanesischen Studentin chinesische Gedichte, und dabei erklärte sie mir auch Wort für Wort eines von Xin Qiji (12. Jahrhundert), das in China jeder Gebildete kennt. Bevor ich mich an einer eigenen Übersetzung versuche, bringe ich lieber Wolfgang Kubins Fassung (es sind aber viele andere möglich!): In jungen Jahren kannte ich keine Schwermut, Gern stieg ich auf den Söller. Gern stieg ich auf den Söller, Für ein neues Lied mußte ich zur Schwermut mich zwingen. Heute kenne ich Schwermut zur Genüge, Ich möchte sie benennen, doch breche ab. Ich möchte sie benennen, doch breche ab, Und sage nur, welch schöner Herbst unter kühlem Himmel. (Die Knappheit der klassischen Schriftsprache kann einen zur Verzweiflung treiben, aber für die Lyrik ist sie ein Segen. Der "Söller" – das "obere Stockwerk" – kommt in vielen Texten vor und hat wie alles andere eine verdichtete symbolische Bedeutung.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 06.11.2013 um 14.19 Uhr |
|
Diese Übersetzung gefällt mir gut, weil sie dicht am Original bleibt. Sie enthält kaum Wörter, die nicht im Original stehen, außer ganz wenige wie ich oder Artikel, das Bindewort und sowie welch, unter. Das sind Wörter, die nur dazu dienen, grammatisch korrekte Sätze im Deutschen zu formulieren, damit wird aber kein neuer Sinn hineinübersetzt, den das Original gar nicht hatte. So bleibt die unvergleichlich schöne Knappheit und Klarheit der chinesischen Lyrik einigermaßen erhalten. Das Gegenteil davon sind einige Übersetzungsbeispiele von "Nachtgedanken" auf der Seite über Li Bai (de.wikipedia.org/wiki/Li_Bai). Davon gibt es auch noch schlimmere. Warum nur muß man dieses schöne, schlichte Gedicht teilweise so "prächtig" überladen? |
Kommentar von Oliver Höher, verfaßt am 06.11.2013 um 15.34 Uhr |
|
Inzwischen hat das Darmstädter Dornröschenschloß die beiden Reden zur Verfügung gestellt. Die Laudatio von Ursula März ist in Reformschrieb gehalten (vgl. hier: PDF-Datei) und die Dankesrede von Lewitscharoff in herkömmlicher Orthographie (vgl. hier: PDF-Datei). Außerdem ist mir aufgefallen, daß Dornröschen – wo sie schon mal wach war – die Typographie der Reden geändert hat. Zu diesem Thema hatte ich mich ja schon einmal geäußert. Es mag an meinem Adobe-Reader liegen, aber lesefreundlicher scheint mir die neue Gestalt nicht zu sein. Bei mir verschwimmen die Buchstaben zu einem seltsamen und wohl so nicht gewollten Fettdruck. In "auch ein wenig beschämt" in der ersten Zeile bilden das "i" und das folgende "n" eine breiige Einheit. Vielleicht hätte Dornröschen doch lieber mal Herrn Forssman gefragt, wie man so etwas macht. Und was die "sprachliche Pracht" betrifft, so möchte die Laudatorin (statt 'Lobrednerin' möchte ich eigentlich viel lieber 'Lobhudlerin' schreiben) offensichtlich nicht in der zweiten Reihe stehen: Die adjektivische Trias "groß, gelb, atmend" signalisiert poetische Prominenz, sie wird kurz danach wiederholt und sprachlich exquisit variiert; "Habhaft, fellhaft, gelb".Sie alle kennen das Zitat, es ist fast schon ein geflügeltes Wort unserer Literatur. (Laudatio, S. 1–2) Tatsächlich? In meinem Exemplar von "Blumenberg" steckt das Lesezeichen noch irgendwo bei Seite 20. Als ich die Laudatio von Ursula März gelesen hatte, habe ich das Buch erst einmal in die hinterste Ecke des Bücheregals verbannt. Oder hätte ich es gleich neben den Büchmann stellen sollen? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.11.2013 um 18.57 Uhr |
|
Das Zitat ist gut gewählt, schon wegen "exquisit".
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.11.2013 um 18.52 Uhr |
|
Mal im Ernst: Die adjektivische Trias signalisiert poetische Prominenz usw. – was ist da passiert? Diese Frage stelle ich mir seit meiner Schulzeit. Schon damals habe ich fleißig Stellen gesammelt, um dem sprachlichen Entgleisen auf die Spur zu kommen. All diese Leute sind doch auch mal kleine Jungen und Mädchen gewesen und haben wie du und ich gesprochen. Frau März hat unser hiesiges humanistisches Gymnasium besucht. Ob da schon die Anfangsgründe der Imponiersprache gelegt worden sind? Das kann ich mir nicht vorstellen, ich kenne einige Schüler, Eltern, Lehrer, habe dort auch mal über die Rechtschreibreform referiert, ziemlich normale Menschen. Es dürfte im Studium gewesen sein, wo dieser Jargon belohnt wird. Und dann ist es nie zu einer Korrektur gekommen, die ja auch die ganze Person betreffen müßte. Eduard Engel hat es dargestellt. Dem faulen Zauber abzuschwören: die Trias signalisiert poetische Prominenz, du meine Güte! (Gestern hat meine jüngste Tochter in der Anatomievorlesung kichern müssen, weil der Professor von einem "prominenten Höcker" hinter dem Ohr sprach. Sie ist aber noch sehr jung.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.11.2013 um 06.32 Uhr |
|
Schriftsteller und Theologen lieben „bedeutsame“ Wörter. Die Sachprosa verwendet die Wörter nur als Hilfsmittel, die man wegwirft, wenn man verstanden hat. Erkenntnisse werden in Termini verfestigt, die bedeutungsvoll, aber nicht bedeutsam sind. Man hängt daher nicht an Zitaten, sondern formuliert alles selbst in rasch wechselnden Ausdrücken. Eine wissenschaftliche Vorlesung ist oft flüchtig formuliert, besonders bei Naturwissenschaftlern, wenn – wie C. F. von Weizsäcker mal gesagt hat – das Wesentliche sich an der Tafel abspielt. Termini bedeuten genau das, was die Definition ihnen beilegt, nicht mehr. Sie sind wertvoll, aber nicht kostbar.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.11.2013 um 08.45 Uhr |
|
Zu www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1416#19258 Das Kunstgeschwätz des zwielichtigen Werner Spies ist natürlich auch schon von der leicht zu beeindruckenden Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung durch einen Preis gewürdigt worden. Übrigens bescheinigt Wikipedia, die im übrigen den Spies-Skandal durchaus nicht verschweigt, dem Meister eine „tiefe Freundschaft“ mit Max Ernst. Das geht meiner Ansicht nach über einen Lexikonartikel hinaus, denn Außenstehende können nicht wissen, wie tief eine Freundschaft ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.11.2013 um 09.22 Uhr |
|
Mosebach wird meist in der Form zitiert Nur wer auf Knien glaubt kann glauben. Ich weiß nicht, woher diese Formulierung stammt; in meiner Ausgabe der "Häresie der Formlosigkeit" (2007 bei Hanser, nicht mehr Karolinger) heißt es: Wir glauben mit den Knien oder wir glauben überhaupt nicht. Wahrscheinlich hat er beides geschrieben. Der Unterschied ist aber doch sehr groß: Wenn man "mit" den Knien glaubt, dann sind die Knie ähnlich den zusammengelegten Händen das Werkzeug, mit dem der Glaube ausgeführt wird. Die Geste selbst ist schon das Glauben, und das ist ja auch der wesentliche Inhalt von Mosebachs Buch, in dem das Ritual gefeiert wird. Wer nur "auf" den Knien glaubt, der glaubt mit dem, nun ja, Herzen, nicht wahr? Aber Formlosigkeit ist "Häresie" ... Mosebach ist gewissermaßen der Gegenpol von Garry Wills (abgesehen vom Niveauunterschied). In dem Häresie-Buch (die Forderung nach Wiedereinführung der Todesstrafe für Gotteslästerung hat er erst später erhoben) schwelgt Mosebach wieder in "besitzen" (anstelle von "haben"): Man "besitzt" also einen Instinkt, einen Geist, ein höheres Gewicht usw. – es ist geradezu ein Erkennungszeichen Mosebachscher Prosa. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.12.2013 um 09.06 Uhr |
|
Frank Kelleter gilt als weltweit bekanntester deutscher Nordamerikanist seiner Generation. (http://www.idw-online.de/pages/de/news542583) Gilt er auch weltweit als weltweit bekanntester deutscher Nordamerikanist, und weiß man das auch weltweit? Und muß man den Mund so voll nehmen? |
Kommentar von R. M., verfaßt am 04.12.2013 um 11.36 Uhr |
|
Noch zu Mosebach: Spielt er vielleicht auf Beuys an, der ja behauptete, mit dem Knie (Singular!) zu denken?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.12.2013 um 07.43 Uhr |
|
Für uns Sprachinteressierte sollte in einem Jahresrückblick die Erinnerung an den famosen südafrikanischen "Gebärdendolmetscher", nicht fehlen, vgl. etwa hier (gleich mit Erläuterungen): https://www.youtube.com/watch?v=zb_njr0zLmc Irgendwo stand, daß er sich geschlagene vier Stunden produziert habe, völlig ungehindert. Der Anblick ist fast so komisch wie die Bündnerfleischepisode von Minister Merz. Aber das Lachen bleibt einem im Halse stecken, wenn man sich erinnert, daß ein großer Teil der Fachliteratur auch nicht besser ist. Siehe Sokal-Hoax. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.12.2013 um 08.13 Uhr |
|
Nicht so umnebelt wie viele hat seinerzeit Peter Körte in der FAS Lewitscharoffs "Blumenberg" besprochen. Er stellt die vernichtende Frage, was habhaft, fellhaft, gelb bedeuten soll. Man könnte die Laudatorin mal danach fragen. Vielleicht findet sie ja eine Antwort, aber ich glaube es eher nicht. Ein fellhafter Löwe ist ein Löwe, der ein Fell hat, wie alle Löwen; den sonderbaren Ausdruck könnte man als expressionistisch rechtfertigen. Ein habhafter Löwe ist entweder überhaupt nicht zu erklären oder sehr leicht: als Ergebnis des krampfhaften Bemühens, "Literaturpreisliteratur" (Körte) vorzulegen. Gelb sind Löwen auch nicht - außer in Bilderbüchern für Kinder. Vor einigen Jahrzehnten hatte ich viel mit der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung zu tun, war oft in Darmstadt, habe Büchnerpreisverleihungen beigewohnt und das Getriebe der gegenseitigen Beweihräucherung bis zum Ekel kennengelernt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.01.2014 um 06.45 Uhr |
|
Ergänzend zu 1407#24348: Im Wikipedia-Eintrag zu Ursula März heißt es: März ging in Erlangen zur Schule. Dort legte sie am humanistischen Gymnasium Friedericianum das Abitur ab. (http://de.wikipedia.org/wiki/Ursula_M%C3%A4rz) Wie man sich denken kann, nennen die Humanisten ihre Schule aber Fridericianum. Man könnte die eindeutschende Schreibweise auch unter "Lectio facilior" verbuchen. |
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 24.01.2014 um 12.40 Uhr |
|
Übrigens gibt es von Peter von Matt ein Buch mit dem Titel: Die verdächtige Pracht. Über Dichter und Gedichte (1998). Der Hinweis paßt leider nur halb zum Thema, weil der Interpret in seinem vielgerühmten Buch eine Auswahl aus jenen kostbaren Gedichten vorstellt, die kein Beispiel für falsche Pracht sind. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.01.2014 um 07.38 Uhr |
|
Mosebachs neuer Roman erscheint bei Hanser in herkömmlicher Rechtschreibung. Das muß man schon mal loben.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.02.2014 um 06.20 Uhr |
|
In einem Leserbrief an die FAZ (11.2.14) kritisiert ein Juraprofessor den Schriftsteller Mosebach, weil er "das Mädchen" manchmal mit dem neutralen "es" wiederaufnimmt. Da muß man Mosebach in Schutz nehmen. Ihm unterlaufen zwar grammatische Schnitzer, aber dies ist keiner.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.03.2014 um 18.39 Uhr |
|
Lewitscharoff ist für ihre Dresdner Rede verdientermaßen abgewatscht worden. Im Interview mit Hubert Spiegel (FAZ) legt sie noch einmal nach, es läuft eigentlich darauf hinaus, daß jeder das Recht haben muß, dummes Zeug zu reden, und das hat er ja auch. Aber was hatten denn die Leute von L. überhaupt erwartet? War nicht die Preiskrönerei auch schon ein Irrtum gewesen? Ob den Darmstädtern jetzt ein Licht aufgeht? Ich mische mich noch mal ein, weil wir hier in Erlangen von den Tiraden gegen IVF ja irgendwie betroffen sind. Hier wurde das erste abartige Halbwesen Deutschlands zusammenpervertiert, und ich selbst habe die Bezeichnung IVF-Kind dazu erfunden, weil ich von der "Retorte" wegkommen wollte. Frau Lewitscharoff hat keine Kinder und wollte auch keine, wie sie sagt. Wir sind es gewohnt, daß ehe- und kinderlose alte Männer sich mit den Einzelheiten der menschlichen Reproduktion beschäftigen und Normen dazu aufs pedantischste festlegen. Frau Lewitscharoff gruselt es, wenn sie sich vorstellt, daß ein Mann, wenn es anders nicht klappt, "onanieren" muß, wo doch Onan gerade die Zeugung vermeiden wollte. Was würde Blumenberg dazu sagen? Oder sein Löwe? Aber der kann ja nicht sprechen, und wir könnten ihn sowieso nicht verstehen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.03.2014 um 09.40 Uhr |
|
Im "Zauberberg" gibt es ja die kleine Szene, wo einer dieser verwöhnten jungen Männer die letzten Zügel abwirft und die emsige kleinwüchsige Bedienstete Emerentia, die "Zwergin", anschreit: "Verfluchter Krüppel!" Diesen Augenblick hat Thomas Mann sehr gut erfaßt, und ich habe jahrzehntelang immer wieder daran denken müssen. Wir erleben ja immer wieder ähnliche Ausbrüche, und manchmal schiebt der Entgleiste ein lahmes "Man wird doch noch sagen dürfen..." oder so etwas hinterher. Zurücknehmen kann man es nicht, es ist heraus und verrät einen; man kann nur noch auf gnädiges Vergessen hoffen. Wir haben alle miteinander unsere schwarzen Abgründe; Zivilisiertheit besteht darin, sie niemanden sehen zu lassen. |
Kommentar von Matthias Künzer, verfaßt am 07.03.2014 um 15.55 Uhr |
|
Mosebach kannte ich nur aus der Persiflage aus Titanic 03/2014. Nach Durchblättern einiger Seiten in der Amazon-Vorschau zu "Das Blutbuchenfest" meine ich, daß in diesem Buch viel atmet und riecht. > Auch die ebenfalls gerühmte "Eleganz" gehört dazu. Verstehe ich nicht. Elegant im Sinne von knapp und deutlich ist doch stilistisch gut. Nur, trotz alter Rechtschreibung - ist sein barocker Stil denn elegant? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.03.2014 um 16.34 Uhr |
|
Ich unterscheide zwischen Eleganz und "Eleganz". Aber weder das eine noch das andere gehört zu meinem aktiven Wortschatz.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.03.2014 um 07.13 Uhr |
|
Etwas verspätet und entsprechend abgeklärt meldet sich auch Peter von Becker im "Tagesspiegel" noch zu Wort: Lewitscharoff hatte in ihrer Rede zu dem Affekt gegen retortengezeugte Kinder ausdrücklich eingeräumt, dass ihre „Abscheu in solchen Fällen stärker ist als die Vernunft“. Das immerhin verweist auf einen möglichen Unterschied zwischen Äußerungen von Dichtern und denen von Politikern oder Publizisten à la Thilo Sarrazin oder der Ex-Moderatorin Eva Herman. Tatsächlich ist alle Kunst auch Ausdruck eines tieferen Widerstreits zwischen den emotionalen, triebhaften, vor-vernünftigen Abgründen und dem Licht des aufgeklärten Verstandes. Nietzsche nannte es das Gegeneinander von Dionysischem und Apollinischem, Freud sah jedes Subjekt gefangen zwischen unterbewusstem Es und besserwisserischem Über-Ich. Dostojewski sprach vom Kampf mit seinen inneren Dämonen – die komplexer wirken, als es sich die Verfechter einer Political Correctness je träumen lassen. Deshalb können Dichter, Komponisten oder bildende Künstler bei politischen Äußerungen (oder im privaten Leben) krausköpfig oder grässlich erscheinen und in ihren Werken überwirklich groß. Die Reihe reicht da von Wagner bis Stockhausen, von Hamsun und Céline bis zu, sagen wir: Walser, Handke, Grass. Auch wird man Lewis Carroll, dem Schöpfer von „Alice im Wunderland“, oder Vladimir Nabokov, dem Autor der „Lolita“, nicht gerecht, wenn man sie allein im Licht etwa der aktuellen Pädophilie-Debatte betrachtet. Usw. - immer schön aus dem Zettelkasten des Gebildeten. Komplexe Dämonen, dionysisch-apollinisch, große Namen ... Wäre Lewitscharoff nicht erwähnt, wüßte man gar nicht, auf welchen Fall die Suada nicht ebensogut passen könnte. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.03.2014 um 08.42 Uhr |
|
SPIEGEL-Kolumnistin Sibylle Berg schreibt zum Fall Lewitscharoff: "Das Wunderbare an unserer Demokratie ist ja, dass jeder alles sagen kann, sei der Stuss auch noch so gequirlt (solange die Menschenrechte nicht angegriffen werden, was hier zu prüfen wäre)." Was heißt "angreifen"? Kritisieren kann man die Menschenrechte sehr wohl, das tun z. B. die katholische Kirche und andere Religionsgesellschaften und dürfen es. Verletzen darf man die Menschenrechte nicht, aber das tut ja ein Schriftsteller oder ein anderer Privatmann auch nicht, mag er sich noch so kraß äußern. Ich habe mal bei Wikipedia nachgesehen, wer Sibylle Berg ist: "Ihre ersten beiden Bücher erfüllten nicht ihre eigenen Ansprüche und so versuchte sie gar nicht, die Texte zu veröffentlichen." Ein fast untrügliches Zeichen, daß sie den Eintrag selbst verfaßt hat. Gibt es denn Schriftsteller, die vor ihrer ersten Veröffentlichung nicht schon manches geschrieben haben, was ihren Ansprüchen nicht genügte? |
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 10.03.2014 um 10.07 Uhr |
|
Gerade weil mich die Vermutung angesprochen hat, habe ich mal in der Versionsgeschichte nachgesehen, ob sich daran die Herkunft erkennen läßt. Die Passage wurde am 9. Juli 2012 um 9:20 vom Benutzer H-stt eingefügt. Dieser gibt auf seiner Benutzerseite sogar seine Identität preis: https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:H-stt Laut Bearbeitungskommentar beruht seine Änderung auf Cicero, Ausgabe Juli 2012. In diesem Fall hat also vermutlich ein Autor der Zeitschrift die Formulierung gefunden – oder Henning Schlottmann. |
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 11.03.2014 um 19.48 Uhr |
|
PS: Übrigens wird die Vermutung von Professor Ickler dadurch nur teilweise widerlegt, wenn überhaupt. "Ihre ersten beiden Bücher erfüllten nicht ihre eigenen Ansprüche und so versuchte sie gar nicht, die Texte zu veröffentlichen." Wenn ein Autor von Cicero das so schreibt, woher will er das wissen? Das kann er eigentlich nur von Sibylle Berg haben, ob mündlich oder schriftlich. Die modifizierte Vermutung müßte nun lauten, daß Sibylle Berg es geschafft hat, ihre Selbstdarstellung über zwei Banden in Wikipedia einzulochen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.03.2014 um 05.24 Uhr |
|
Genau das wollte ich antworten, lieber Herr Wrase, und hatte es mit fast denselben Worten auch schon geschrieben, als ich mir dachte: Das wird sich jeder schon selbst denken, also lasse ich es lieber. Danke, daß Sie es noch interpoliert haben! Bei Wikipedia mische ich nicht mit, das würde mich zuviel Zeit kosten, aber ein Hauptmangel sind wohl die verkappten Selbstdarstellungen in den Biographien. Bei amazon besprechen und empfehlen manche Leute unter Pseudonym ihre eigenen Bücher, das merkt man ebenfalls an gewissen schwer zu definierenden Eigenheiten, über die sie dann doch keine Macht haben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.03.2014 um 05.06 Uhr |
|
Aichinger ist die Patriarchin unter den deutschsprachigen Lyrikern. (Ruth Klüger in FAZ 15.3.14) Ich übersetze: Ilse Aichinger ist 93 Jahre alt. (Klügers Satz muß auch Feministen entzücken.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.03.2014 um 06.10 Uhr |
|
In einem Geburtstagsartikel feiert die FAZ den Philosophen Bernhard Waldenfels als "Meister wissenschaftlicher Prosa". Vor längerer Zeit hat dieselbe Zeitung in einem Kasten kommentarlos folgendes Zitat aus den "Deutsch-Französischen Gedankengängen" (Suhrkamp 1995) gebracht: Das, worauf wir antworten, wie auch immer wir es tun, erweist sich als das Außerordentliche, ohne das es nichts zu sagen und zu tun gäbe, abgesehen von dem, was scheinbar immer schon gesagt und getan wurde oder immer wieder gesagt und getan wird. Demgegenüber würde der Versuch einer unendlichen Selbstergänzung oder einer letzten Selbstbegründung in purer Selbsterhaltung enden, in einer Selbsterhaltung funktionstüchtiger Ordnungen, die sich um sich selbst drehen. Auf diesen Ton ist auch der Geburtstagsbeitrag gestimmt, der die "unfassbare Fülle an neuen Einsichten" rühmt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.03.2014 um 05.31 Uhr |
|
Ein Theologe hat sich immer wieder mit "dem Bösen" beschäftigt. Eines seiner Bücher hat den Titel: Malum: theologische Hermeneutik des Bösen So was Feines! (Das Buch ist übrigens laut Werbung auch für die Examensvorbereitung geeignet, so daß Studenten mit ihrem Wissen über das Böse eine gute Note bekommen.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.03.2014 um 05.09 Uhr |
|
Einer der prächtigsten Wikipedia-Einträge gilt dem Prachtautor Diedrich Diederichsen. Auch darin wird auf ungehobene Schätze hingewiesen: "Die akademische Promotion (über Luis Buñuel) brach Diedrich Diederichsen zugunsten einer journalistischen Karriere ab." Ein solcher Mann zieht nicht einfach nach Berlin um, sondern: Ende der 1990er Jahre verlegte Diedrich Diederichsen seinen Wohnsitz von Köln nach Berlin. Und: Mit seinen Schriften tritt Diedrich Diederichsen als Autor auf. Dieser umfangreiche Text scheint mir auch vom Gefeierten selbst verfaßt oder wenigstens inspiriert zu sein. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.03.2014 um 06.37 Uhr |
|
Noch zu Lewitscharoff: Sie selbst hält sich bei dem ganzen Thema übrigens für nicht ganz unvorbelastet: Ihr Vater war Gynäkologe, "auch keine ganz einfache Hypothek für eine Tochter", wenn man wisse, dass der eigene Vater von Berufs wegen da unten habe herumfuhrwerken müssen. Sie selbst hat keine Kinder. (Welt 20.03.14) Das ist nun nicht sehr prächtig und kaum unter "Sprachvirtuosität" (ebd.) zu bringen. Enno Stahl hat den naheliegenden Verdacht geäußert, daß da etwas rausmuß und die Rollenprosa ihrer erfolgreichen Bücher vielleicht gar keine ist. (Jungle World 20.3.14) Wenn ich L. recht verstehe, führt sie auch die Frauenrechtsbewegung auf die Nazis zurück. Ich lese zufällig gerade Anthony Heilbuts Buch über Thomas Mann, dessen Schwiegergroßmutter ja Hedwig Dohm war, die nicht in diese Ahnenreihe gehört. (Sie war auch nicht begeistert, als die begabte Enkelin ihr Mathematikstudium aufgab zugunsten der Ehe mit dem Taugenichts.) Unter den meist ablehnenden Leserbriefen zu L.sind auch einige, die ihr zustimmen, oft nach dem Muster: Wenn Gott will, daß ein Paar keine Kinder hat, dann muß man sich eben fügen usw. Ich will nicht die freilich berechtigte Frage stellen, ob dann nicht die gesamte Heilkunst des Teufels sei, sondern mich auf die bemerkenswerte Lücke in Lewitscharoffs Tiraden beschränken: Was hat sie denn zum Kaiserschnitt zu sagen? Sollte man nicht Mutter und Kind sterben lassen, statt da unten rumzufuhrwerken? Als 1982 eine schönere Bezeichnung für "Retortenbaby" gesucht wurde, fand Wunschkind am meisten Zustimmung, aber es war natürlich anderweitig belegt und auch sonst nicht gut möglich. Immerhin brachte es die öffentliche Meinung ganz gut zum Ausdruck, und da wir zur selben Zeit gerade wieder ein - übrigens ganz normal erzeugtes - Töchterchen bekommen hatten, fühlten wir uns in Übereinstimmung mit der damals noch selbstverständlichen Ansicht, daß Kinder was Wunderbares sind. Der fröhliche bis rotzige Zynismus, mit dem heute manche Zeitungsschreiber beifallssicher über das Kinderkriegen herziehen, kommt wir wie ein neuer Ton vor. Vielleicht irre ich mich, aber ich möchte für alle Fälle diese Beobachtung festhalten. Sind das die letzten Tabus: Bloß keine Kinder! und: Bloß nicht fotografieren!? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.04.2014 um 06.59 Uhr |
|
Jürgen Kaube bespricht den neuesten Roman von Sibylle Lewitscharoff (FAZ 3.4.12). Die wenigen zitierten Sätze beweisen, daß L. nicht schreiben kann, vom Rest ganz zu schweigen. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ist einem Blendwerk aufgesessen, denn man hätte das alles schon vorher merken können und müssen. Der Wille zur Literatur in Verbindung mit einer gewissen Hemmungslosigkeit macht noch keinen bedeutenden Schriftsteller. Künftige Büchner-Preisträger werden sich überlegen müssen, in welcher Ecke sie mit einer solchen Auszeichnung stehen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.04.2014 um 04.24 Uhr |
|
Noch zur "Patriarchin" (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1407#25381). So hieß auch eine österreichische Fernsehserie, ich weiß aber nicht, was das für eine sonderbare Vaterherrscherin sein sollte. Duden online erklärt die Herkunft von "Patriarchin" so: "französisch théine, zu: thé = Tee" Man lernt nie aus. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.04.2014 um 18.50 Uhr |
|
Man hat (wir haben es auch hier schon gesehen) immer wieder mal Lewitscharoff und Sarrazin zusammen genannt. Das ist abwegig. Lewitscharoff und Mosebach gehören zusammen; sie sind übrigens derselben Meinung, loben ja einander auch über den grünen Klee. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.05.2014 um 09.14 Uhr |
|
Im SPIEGEL (vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1503#25341) ist auch schon mehrmals eine Anekdote erzählt worden: Der junge Carl Friedrich von Weizsäcker war von einer Vorlesung Heideggers fasziniert: „Das ist Philosophie. Ich verstehe kein Wort. Aber das ist Philosophie.“ Adorno (die Extreme berühren einander) sprach auch gern von "großer Philosophie", worunter er natürlich nicht Heidegger verstand, sondern Hegel und sich selbst. Die Verehrung des Unverständlichen ist oder war wohl typisch deutsch, inzwischen sind die Franzosen auch im Club. Alles Weitere steht bei Sokal. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.05.2014 um 06.59 Uhr |
|
Derridas kategorischer Satz, „dass es nichts jenseits der écriture gibt“, erweist sich als unhintergehbar. (FAZ 3.5.14, aus einer Rezension zu einem Buch über Liebesbriefe) Die Rezensentin deutet an, daß écriture nicht übersetzt werden kann, sonst hätte sie es ja getan. Derrida verwendet bekannte französische Wörter in einem angeblich neuen Sinn, bildet auch neue dazu. Die Ecriture ist also unhintergehbar, und dieser Satz ist ebenfalls unhintergehbar. Was wissen wir nun, was wir vorher nicht wußten? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.05.2014 um 05.31 Uhr |
|
Noch zu: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1407#24455 Vielleicht hatte ich es schon einmal erwähnt: Das geschwollene Synonym besitzen statt haben paßt zum gewollt gediegenen Stil Mosebachs, aber manchmal merkt er etwas. So schrieb er einmal: Hans Joachim besaß keinerlei Bedeutung. In einer Neubearbeitung ist das geändert: hatte keinerlei Bedeutung. Aber die meisten besitzen sind stehen geblieben. In einem neuen Text, einer Laudatio in "aviso", kann man lesen: denn das Falsche besitzt einen geringeren Grad von Wirklichkeit und jeder Zustand besitzt sein eigenes Recht. Wie kann man so etwas schreiben? Gerade weil er offenbar keine Kontrolle darüber hat, ist es ein Markenzeichen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.07.2014 um 05.25 Uhr |
|
Das Spiel ist in einem ausgezeichneten Sinne Selbstdarstellung. (Hans Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Tübingen 1960:103) Es wird nicht gesagt, wie der ausgezeichnete Sinn von Selbstdarstellung sich vom gewöhnlichen Sinn unterscheidet. Beim Leser kommt nur an, daß der Verfasser noch tiefer denkt, als er spricht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.08.2014 um 04.26 Uhr |
|
„Wie groß muß unsere Lust am unbegreiflichen Unsinn sein!“ (Friedrich Nietzsche: Morgenröte II, 142) Mein täglicher Seufzer. Gewiß bringen wir allem, was wir hören oder lesen, einen grundsätzlichen Vertrauensvorschuß entgegen, in der oft bewährten Erwartung, daß sich der Sinn schon noch erschließen werde, daß es also erst einmal an uns liegt, wenn wir nichts verstehen. Aber es ist doch noch ein großer Sprung zu jener Begeisterung für das Unverständliche. "Sie weiß nicht, was die Schleiche singt, sie hört nur, daß es lieblich klingt." (Morgenstern) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.09.2014 um 06.54 Uhr |
|
„Ich denke, nur wer sich mit dem metaphysischen, religiösen, theologischen Paradigma auseinandersetzt, erhält wirklich Zugang zur gegenwärtigen auch politischen Situation.“ (Giorgio Agamben) Damit bewirbt der Verlag der Weltreligionen sein Programm und hat das Zitat auch seinem Almanach vorangestellt. Was wissen wir, wenn wir es gelesen haben? Was ist das für ein Paradigma (nur eines?), und worin besteht die „gegenwärtige auch politische Situation“? Ich übersetze: „Was ich mache, ist wichtig.“ |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.10.2014 um 06.29 Uhr |
|
Wenn ich lese, was ich vor längerer Zeit geschrieben habe, stoße ich auf Ausdrucksweisen, die ich bei zunehmender Empfindlichkeit heute nicht mehr verwenden würde. Gerade fällt mir auf, wie oft in unseren Zeitungen die Wendung ein Ding der Unmöglichkeit vorkommt, die in jedem Fall nur ein aufgebauschtes unmöglich ist (nein, nicht "darstellt", wie ich einen Augenblick noch zu schreiben versucht war). Wie doof! Ich habe es auch schon verwendet, sogar hier. Aber man braucht sich nicht zu genieren, wenn man auf dem richtigen Weg ist. Writing is rewriting oder so ähnlich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.10.2014 um 04.31 Uhr |
|
Man sollte alles weglassen, was dem Leser eine bestimmte Reaktion auf das Mitgeteilte aufzunötigen versucht, also "Es ist interessant, daß..." usw. Wenn es nicht interessant wäre, brauchte man es ja nicht zu sagen. Man soll so schreiben, daß es interessant ist. Es ist vor diesem Hintergrund eine sowohl frappierende wie provokante Einsicht, dass es der Nationalsozialismus gewesen ist, der im faschistischen Formexperiment die einzige Epoche war, in der im 20. Jahrhundert in Deutschland ein Stil versucht wurde, der an eine große Form angelehnt war, wobei das Bauhaus die Gegenfigur darstellte. (Karl Heinz Bohrer, Dankrede zur Verleihung des Deutschen Sprachpreises) (Ich habe dies anderswo schon mal als Beispiel eines schlecht gebauten Satzes angeführt und hier auch die Bereicherung der Feuilletonsprache durch Bohrers Wortschwall zum Tod Elvis Presleys vorgeführt.) Wenn der Leser sich durch eine Einsicht frappiert und provoziert fühlt, dann ergibt sich das vielleicht so, aber man kann es doch nicht vorab verordnen. Bohrers Jugenderinnerungen ("Granatsplitter". München 2012) sind übrigens in einer Mischorthographie erschienen, also Heyse, jedes Mal, zum erstenmal, zum ersten Mal (mehrmals wechselnd), rauhe Lieder, greulich. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 12.11.2014 um 01.27 Uhr |
|
Ich stelle meine Frage mal hier herein, denn das folgende Zitat paßt auch ganz gut zur stilistischen Pracht. Aber eigentlich dachte ich, daß Ihre Kommentare, lieber Prof. Ickler, zum vorangestellten Genitivattribut hier enthalten sind. Ich kann sie leider nirgends finden. Die FAZ hatte gestern (11.11.2014) auf Seite 10 folgende Überschrift: Schönheit am Ende eines langen Tages Reise in die Nacht Was es im groben bedeuten soll, ist wohl auch ohne den weiteren Text klar, es geht um das Ende der/einer Reise eines langen Tages. Abgesehen vom Stil: Ist diese Überschrift grammatisch akzeptabel? Für mein Gefühl klingt das schief, ich finde, es fehlt ein Artikel im Genitiv. Dieser wird durch das vorangestellte Attribut unmöglich. Aber dann kann man eben das Genitivattribut hier nicht voranstellen. Oder? |
Kommentar von R. M., verfaßt am 12.11.2014 um 02.01 Uhr |
|
Der Überschriftenautor wollte den Wortlaut des zitierten Titels nicht antasten, obwohl die Anspielung auch bei einer Umstellung durchaus noch verständlich gewesen wäre. Unter sozusagen normalen Umständen würde niemand so schreiben.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 12.11.2014 um 11.19 Uhr |
|
Danke! Ich kannte das Theaterstück "Eines langen Tages Reise in die Nacht" nicht, es wird auch in dem FAZ-Artikel sonst nicht erwähnt. Na ja, vielleicht ist es eine Marotte aufgrund meines Berufes, daß ich immer alles ganz genau wissen will. Oder ist es unentscheidbar? Das wäre mir auch noch klar genug. Nur, daß normalerweise niemand so schreiben würde, reicht mir irgendwie nicht. Ich wüßte gern, ist die Überschrift der FAZ nun grammatisch in Ordnung oder grammatisch falsch? Dem Wort "Reise" sieht man leider nicht an, ob es ein Nominativ oder Genitiv ist. Aber es könnte ja ein Genitiv sein, also in Ordnung? Aber m. E. geht das so nicht, der Genitiv muß zwingend eindeutig gekennzeichnet sein, z. B. durch einen Artikel, oder sei es auch nur durch eine Präposition. Zum Beispiel Wegen eines langen Tages Reise bin ich jetzt müde käme mir nicht so verkehrt vor. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.11.2014 um 12.42 Uhr |
|
Sie haben vollkommen recht. Beim Sprecher entsteht wohl durch andere vorangestellte Genitive der Eindruck, er habe seine Kasusverpflichtung bereits eingelöst. Das haben wir auch bei dem bekannten Fall das Leben Berliner Bürger usw.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.12.2014 um 03.45 Uhr |
|
"Ich hasse es, wenn man mir Bücher unverlangt schickt. Mit dem Bezahlen drücke ich aus, dass ich das Objekt ehre und es ernst mit ihm meine. Unverlangt an mich abgeschicktes Zeug landet in der Papiertonne. Nieder mit dem planlosen Herumschicken! Nieder mit Amazon!" (Lewitscharoff taz 21.9.13) Gibt es eine Prominentenklasse, der Amazon Bücher unverlangt zuschickt? Mir haben sie noch nie etwas zugeschickt. (Was macht L. mit den unerwünschten Honoraren, die ihr aus dem Verkauf ihrer Bücher über Amazon zugeschickt werden?) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.01.2015 um 12.21 Uhr |
|
Warum fällt es manchen Leuten so schwer, verständliche Sätze zu schreiben? Distanzierte sich die Autorin nach 1945 von den nationalsozialistischen Parolen, manifestieren sich in ihrem umfangreichen Werk gleichwohl Kontinuitäten der antimodernen, antiurbanen und antiegalitären Literatur des 20. Jahrhunderts, sowohl narrativ in der Präferenz für das Genre historischer Romane und Erzählungen, der dezidierten Abwehr avantgardistische Literatur und rezenter Entwicklungen des Erzählens, der fiktionalen Perzeption historischer, sozialer, ökonomischer, politischer und kultureller Prozesse als der Kontrolle eines meist von undefinierter Schuld gezeichneten Individuums oder einer Sozietät entzogene, ahistorische Schicksalsmächte, während in ihrem Alterswerk die christliche Thematik einen immer größeren Raum einnimmt für Stoffauswahl und Lösungsmodelle, als auch diskursiv in der Präferenz für einen archaisierenden Sprachgestus und ein 'Pathos der Wahrhaftigkeit'. (Michaela Lehner: „Das Wort als Tat. Grete von Urbanitzky und Gertrud Fussenegger im Kontext völkisch-nationaler und nationalsozialistischer Literatur“. In: „Kulturhauptstadt des Führers“. Linz 2009:185-196, S. 195) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.08.2015 um 04.28 Uhr |
|
Viele Menschen, die online bestellen, haben die Erwartungshaltung, dass ihnen die Produkte direkt nach Hause geliefert werden. (Augsburger Allgemeine 20.7.15) = Viele Menschen, die online bestellen, erwarten, dass ihnen die Produkte direkt nach Hause geliefert werden. Auch bei Wikipedia hat einer was gemerkt, drückt es allerdings auch nicht gerade am geschicktesten aus: „Der häufig verwendete Ausdruck Erwartungshaltung ist das Musterbeispiel eines Pleonasmus, denn jede Erwartung ist automatisch eine Haltung. Die Verdopplung des Ausdrucks verstärkt den Wortsinn jedoch nicht, daher sollte der Begriff 'Erwartung' bevorzugt gebraucht werden.“ |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.08.2015 um 07.27 Uhr |
|
Diese späten und stärksten Romane Raabes vermögen vor allem eins: zu Tränen zu rühren. (FAZ 15.8.15) Man sollte sich die Fanfaren sparen, wenn der Auftritt danach so kümmerlich ausfällt. Also: Diese späten und stärksten Romane Raabes können zu Tränen rühren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.09.2015 um 14.47 Uhr |
|
„Wenn der Mann aus dem Volke die Feder in die Hand nimmt, wird er meist nur gelegentlich und gegen seinen Willen so sprechen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist; vielmehr glaubt er hier auf Stelzen einhergehen zu müssen. Und bei vielen Gebildeten ist es wenig anders.“ (Friedrich Polle/Oskar Weise: Wie denkt das Volk über die Sprache? 3. Aufl. Leipzig, Berlin 1904:1)
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 09.09.2015 um 17.02 Uhr |
|
Schönes Bild, sprachlich auf Stelzen einherzugehen. Mir ist das Problem immer bewußt, ich hoffe, ich kann es meistens vermeiden. Andererseits denke ich, daß man auch nicht gerade so schreiben muß, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Man unterscheidet ja schon mündliche Umgangssprache von Schriftsprache. Zwischen Schnabel und Stelzen (jetzt nicht räumlich gemeint) liegt wohl das, was man beim Schreiben anstreben sollte.
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 09.09.2015 um 17.33 Uhr |
|
Bayerische Dorfschullehrer sagen: Hochdeutsch ist die erste Fremdsprache.
|
Kommentar von Pt, verfaßt am 09.09.2015 um 19.06 Uhr |
|
Das war vielleicht vor Jahrzehnten mal so, heute sicher nicht mehr. Oder schauen bayrische Kinder nicht fern?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.09.2015 um 13.49 Uhr |
|
Ein Gastbeitrag in der FAZ beginnt so: Wir erleben die Folgen eines weit fortgeschrittenen Einsichtsverlusts von Bürgern wie auch Politikern in die Notwendigkeit von Territorialgrenzen. (FAZ 17.9.15) Ich übersetze: Politiker und andere Bürger verstehen nicht mehr, wie wichtig Landesgrenzen sind. Nun erleben wir die Folgen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.10.2015 um 17.37 Uhr |
|
Aus meinen Sammlungen: Adenauer war schriftlich sparsam: kein Wort zuviel. Niemals unterliefen ihm undurchdachte Floskeln. Stets war der Sinn seiner Formulierungen klar. Er ließ sich nie Verschwommenheiten durchgehen. Man wußte immer, was er wollte. Keiner mußte je rätseln, was Adenauer wohl gemeint haben könnte. (Die Zeit 30.11.84) Fünf Sätze zuviel. Man könnte es für einen netten Scherz halten, aber das wäre wohl eine Überschätzung. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.11.2015 um 14.31 Uhr |
|
Lewitscharoff: Für meine Dresdner Rede im vergangen[en] Jahr wurde ich im Nachhinein scharf kritisiert. Ich habe ein paar dumme Sätze reingepackt. Aber das ganze Anliegen war nicht dumm: Es war ein Aufruf gegen die Haltung, dass der Mensch für alles selbst verantwortlich sein soll. Die Vorstellung ist doch entsetzlich, für Krankheiten, für Kinderlosigkeit und schwere Unfälle selbst verantwortlich zu sein. Ich fühle mich viel erleichterter, wenn ich weiß, das Schicksal hängt über mir. Deshalb sage ich auch immer wieder: Mein Schicksal liegt in Gottes Hand und nicht in meinen Händen. (SZ 6.11.15) Wenn es weiter nichts ist - warum hat sie das nicht gleich gesagt, sondern erst "im Nachhinein"? (Vertritt jemand im Ernst die Ansicht, wir seien für alles selbst verantwortlich?) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.01.2016 um 08.13 Uhr |
|
Claus Leggewie beschreibt ganz gut, wie wir zwar in Sicherheit leben, durch Politiker und Medien aber das gegenteilige Gefühl suggeriert bekommen und die Volksverhetzer darauf ihr Süppchen kochen. Dann aber schreibt er: Hinter der Angst steckt „transzendentale Unbehaustheit“, wie Georg Lukács das Wesen der Risiko-Moderne erfasst hat. (FAZ 6.1.16) Verstehen Sie das? Lukács ist als Steinbruch erhabener Unverständlichkeit fast so beliebt wie Walter Benjamin. In der „Theorie des Romans“ heißt es allerdings „transzendentale Obdachlosigkeit“, das Wort „unbehaust“ kommt nicht vor. Das ist aber egal, weil Lukács das Wort „transzendental“ so inflationär verwendet, daß man nie weiß, was es eigentlich bedeuten soll. Weder die ältere Theologie noch Kant helfen weiter. (Lukács ist für mich nicht von meinem ersten Semester zu trennen; der Literaturprofessor zelebrierte unter häufiger Nennung der "Theorie des Romans" die Romane des 19. Jahrhunderts, und zwar so ergriffen und ergreifend, daß ich noch heute darüber lächeln muß. Er hatte einen leichten Sprachfehler, sagte Fich und Fleich, und auf seinen Lippen sammelte sich etwas Speichel, je länger er redete. Man sieht, meine Aufmerksamkeit schweifte ab, bald darauf auch mein ganzes Interesse; aber er hat mich noch wohlwollend im Staatsexamen geprüft. Viele Jahre später wurde ich durch Heirat sogar weitläufig mit ihm verwandt, und er behauptete, sich noch an mich zu erinnern, was aber bei über 300 Teilnehmern im Hauptseminar wohl nur Höflichkeit war. Als die aufsässigen Studenten ausgerechnet an diesem harmlosen Mann ihr Mütchen kühlten, tat er mir leid. Er konnte es so wenig fassen wie Adorno.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.01.2016 um 06.50 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1407#25393 Der Philosoph Waldenfels hat jahrzehntelange Bücher über "Fremdheit" geschrieben, gilt daher als Experte und wird auch in der FAS zum Thema Zuwanderung zitiert. ("Wenn es gutgeht, entsteht etwas positiv Neues.") In der Rheinischen Post war kürzlich auch ein Interview zu lesen: Wie kann die Politik Zeichen setzen, die über Zelte bauen und Brot verteilen hinausgehen und tatsächlich etwas für die Völkerverständigung im eigenen Land tun? Waldenfels Vielleicht wäre das Erste, dass man das Zeltebauen und Brotverteilen als eine Gabe versteht, die Empfänger hat, und nicht nur als Notmaßnahme wie das Eindämmen eines Flusses. Verständigung setzt voraus, dass man einander Aufmerksamkeit schenkt, dass man hinschaut und hinhört, bevor man argumentiert. Sie setzt voraus, dass man fremde Sprachen lernt und dies nicht nur von den Ankommenden fordert. "Lernt Sprachen. Auch die nicht vorhandenen", ermahnt uns der polnische Aphoristiker Lec. Eine Politik des Fremden wäre eine Politik, die sich an den Grenzen des Normalen bewegt. (Rheinische Post 19.9.15) Waldenfels ist Phänomenologe in enger Anlehnung an Husserl und schreibt so ähnlich. Eines seiner Bücher wird hier besprochen: www.polylog.net/fileadmin/.../19_rez_Gmainer-Pranzl_Waldenfels.pdf - und man kann sich einige Zitate ansehen, wenn man keine Zeit hat, ganze Texte von ihm zu lesen. Die Sprache der Phänomenologie ist eben eine Welt für sich. Nicht immer dreht sie sich so selbstgefällig im Kreis wie im früheren Zitat, aber für mich kommt auch nie etwas Greifbares (Diskutierbares, Widerlegbares) dabei heraus. Nur der gute Wille ist deutlich, aber den habe ich sowieso. Die Sprachen der Zuwanderer werde ich nicht lernen, davon haben sie nichts. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.02.2016 um 14.30 Uhr |
|
Wenn uns nur die erste Fassung von "Willkommen und Abschied" bekannt wäre, würden die Lehrer eben diese im Unterricht durchnehmen und für den Gipfel der Poesie erklären: Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, Doch tausendfacher war mein Mut, Mein Geist war ein verzehrend Feuer, Mein ganzes Herz zerfloß in Glut. (usw. man kann ja das ganze Gedicht leicht auffinden). Nun kennen wir aber auch die letzte: Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, Doch frisch und fröhlich war mein Mut: In meinen Adern welches Feuer! In meinem Herzen welche Glut! Die muß noch besser sein, sonst hätte Goethe sie ja nicht angefertigt. Aber darum geht es mir nicht, obwohl es die Schulmeister in ziemliche Schwierigkeiten bringt, sondern um die Beobachtung, daß selbst erhebliche Eingriffe in den "Prosasinn" die emotionale Wirkung nicht verändern. Dazu gibt es einen Abschnitt bei Skinner: Konditionierte Gefühlsreaktionen auf Teile einer Dichtung steuern oft eine Wirkung bei, die bis zu einem gewissen Grade von der „Prosabedeutung“ des Werkes unabhängig ist. Man hat sogar behauptet, daß die Prosabedeutung im wesentlichen nur dazu dient, das Verhalten des Lesers oder Zuhörers aufrechtzuerhalten, so daß die Gefühlsreaktionen auf die einzelnen Teile des Werkes eintreten können. In T. S. Eliots „Gerontion“ zum Beispiel haben Ausdrücke wie trockener Monat, heiße Gassen, verfallenes Haus, windige Räume, trockenes Hirn und trockene Jahreszeit eine Gesamtwirkung, die nicht von ihrer Reihenfolge oder ihrer syntaktischen Ordnung innerhalb des Gedichts abhängt. Die Adjektive „modifizieren“ mehr als die ihnen folgenden Substantive. Eine reine Wortliste wirkt ähnlich, wird aber den Leser möglicherweise nicht zum Weiterlesen reizen. Die Möglichkeit, daß Dichtung emotional wirkt, auch wenn sie sonst keinen Sinn ergibt, ist vielfach anerkannt worden. A. E. Housman schreibt zum Beispiel: (156) „Sogar Shakespeare, der so viel zu sagen hatte, kleidet seine entzückendste Poesie manchmal in eine Hülle ohne Sinn: Take, O take those lips away That so sweetly were forsworn, And those eyes, the break of day, Lights that do mislead the morn. But my kisses bring again, bring again, Seals of love, but sealed in vain, sealed in vain. Das ist Unsinn, aber als Dichtung ist es hinreißend.“ Diese Art von Bedeutung bleibt sogar erhalten, wenn man die Wörter eines literarischen Textes durcheinandermischt. Ein frühes Beispiel hat Lord Chesterton für seinen Sohn geschaffen: Life consider cheat a when ‚t‘is all I Hope the fool‘d deceit men yet with favor Repay will tomorrow trust on think and Falser former day tomorrow‘s than the Worse lies blest be shall when and we says it Hope new some possess‘d cuts off with we what. Dieser Text atmet immer noch etwas vom Original. Man wird an dieselbe Epoche der englischen Literaturgeschichte erinnert und ahnt trotz der Umstellungen noch etwas vom ursprünglichen Sinn. Ausdrücke wie cheat, fool, deceit, falser und worse haben unabhängig von der Prosabedeutung eine bestimmte Wirkung. Joseph Conrad beschreibt ein Beispiel in „Lord Jim“ und sagt dazu: „Die Wirksamkeit eines Satzes hat weder mit seinem Sinn noch seiner logischen Konstruktion etwas zu tun.“ (Das Original lautet: When I consider life, 't'is all a cheat Yet fool'd with hope men favor the deceit Trust on and think tomorrow will repay. Tomorrow's falser than the former day. Worse lies it says, and when we shall be blest With some new hope, cuts off what we possess'd. (John Dryden: Aurenzebe)) Ich muß auf das ganze Kapitel in "Verbal Behavior" verweisen, es ist wirklich interessant. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.03.2016 um 12.44 Uhr |
|
Manche Leute können, wenn sie Hoffnung sagen wollen, der typischen Versuchung der Gebildeten nicht widerstehen und sagen stattdessen Prinzip Hoffnung. Sie sagen auch: Eine europäische Identität, die das Europa-Parlament repräsentieren könnte, gibt es erst in Spurenelementen. (FAZ 17.6.89) – obwohl das sinnlos ist, ebenso wie das schon zitierte: Viele Menschen, die online bestellen, haben die Erwartungshaltung, dass ihnen die Produkte direkt nach Hause geliefert werden. (Augsburger Allgemeine 20.7.15) Aus der Popularpsychologie (Watzlawick usw.) stammt auch die Beziehungsebene: Bastian Sick ist keiner, der auf der Bühne improvisiert: Sein Ablaufplan ist fixiert, seine Texte sind, im buchstäblichen Sinne, Schriftdeutsch. Von einer Beschaffenheit also, die fachlich höchsten Ansprüchen genügt, aber im Vortrag keine dauerhafte Beziehungsebene zwischen ihm und seinem Publikum gedeihen lässt. (SZ 22.3.16 über einen Vortrag Sicks) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.04.2016 um 16.58 Uhr |
|
Ich soll Stephen King lesen. Na gut, das werde ich tun. Angefangen habe ich mit "On Writing", also gerade keinem seiner Romane. Es ist das Buch mit der positivsten Bewertung bei Amazon, die ich je gesehen habe, 26mal 5 Sterne und einmal 4. Obwohl er - neben der Autobiographie - nur Ratschläge für Schriftsteller geben will, lassen sich die meisten auch auf Sachprosa anwenden. Gut gemacht! (Er berichtet auch über seine Jahre mit Alkohol und Drogen. Das gibt es ja heute sehr oft in Autobiographien, aber er macht es knapper und besser.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 27.04.2016 um 18.13 Uhr |
|
Mein Sohn hat während seiner letzten Schuljahre jedes Stephen-King-Märchen verschlungen. Ich war auch mal neugierig und habe 2 oder 3 davon versucht, aber alle bald gelangweilt weggelegt, und hatte keine gute Meinung vom Autor. Dann hat mir ein Freund "Das Leben und das Schreiben" ("On Writing") empfohlen, ich fand es sehr unterhaltsam, teilweise auch ganz lehrreich, es hat mein Bild von Stephen King völlig verändert.
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 27.04.2016 um 18.48 Uhr |
|
The Secret School of Wisdom hatte 20mal 5 Sterne, und dann kam ein Idiot und hat das schöne Bild mit einer 2-Sterne-Bewertung gestört. Das amerikanische Publikum ist natürlich begeisterungsfähiger als das britische. Was für amerikanische Leser 'awesome' ist, finden britische 'quite interesting'.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.04.2016 um 04.42 Uhr |
|
Überraschend oft wird Schullektüre sehr positiv bewertet, offenbar weil die Schüler zum erstenmal Literatur kennenlernen und sie daher interessanter finden als den TV-Einheitsbrei, mit dem sie bisher abgespeist worden sind. Neulich brachte die FAZ gemeinerweise eine ganze Seite Amazon-Rezensionen, nur um die Naivität der Verfasser bloßzustellen. Das fanden einige Leser, auch ich, ziemlich abstoßend, sozusagen sicksch. Man muß immer jenes Dutzend "Top-Rezensenten" abziehen, die angeblich jeden Tag drei Bücher lesen und toll finden - ohne einen einzigen "bestätigten Kauf". Straflose Korruption. Wahrscheinlich werde ich von King doch nichts weiter lesen, das Genre liegt mir nun mal nicht, auch Fantasy oder Science fiction nicht, wovon manche nicht genug bekommen können. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.08.2016 um 06.50 Uhr |
|
"Das liest sich durchaus prächtig, wenn man an einem prachtvollen und sprachschwelgerischen Fabulieren seine Freude hat." (ZEIT über Mosebachs „Mogador“) Prächtigkeit und Mosebach gehen allmählich eine feste Verbindung ein. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.09.2016 um 05.39 Uhr |
|
Ich habe mal in die Leseprobe hineingesehen. Viele prächtige Vergleiche und Adjektive. Ein Tonnengewölbe erhob sich über ihm; in Jahrhunderten und Jahrzehnten immer wieder neu verputzt, von einer blätternden Farbkruste bedeckt, die sich da und dort löste, da und dort auch heruntergefallen war. Na ja, das versteht man eben unter blättern (eigentlich abblättern), daß die Farbkruste sich löst; das Attribut ist überflüssig. Es war ein Wunder, wie das durch sein Gegenteil ausgetauscht worden war. (?) Die Fahrt dann am frühen Morgen, nach Stunden, von denen er sich jetzt noch fragte, wie er ihr Verstreichen hatte ertragen können (...) Dieser ungeschickte Anschluß ist bei Blatz unter "Trajektion" behandelt. Relativsätze sind eben mit Vorsicht zu behandeln. Es ist wirklich Geschmackssache, ob man so etwas gern liest. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.09.2016 um 12.31 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1407#24340 Der Wikipedia-Eintrag bietet Li Bais "Nachtgedanken" auch in einer angeblich von Alfred Forke stammenden Übersetzung: Vor meinem Bette ich Mondschein seh', als wär' der Boden bedeckt mit Schnee. Ich schau zum Mond auf, der droben blickt, der Heimat denkend das Haupt mir sinkt. Ich weiß nicht, wie lange das schon da steht. Mir fällt Gernhardts "Versagensangst" ein: Ich leide an Versagensangst, besonders, wenn ich dichte. Die Angst, die machte mir bereits manch schönen Reim zuschanden. Also bei Forke heißt es natürlich blinkt, und die Übersetzung ist eine der besseren. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 20.09.2016 um 14.41 Uhr |
|
Bei "Nachtgedanken" fällt mir immer auf, daß wohl alle Übersetzungen (an eine andere kann ich mich nicht erinnern) in der Ich-Form gehalten sind. Das ist nicht unbedingt verkehrt, aber im Original steht kein Ich, und dieses kurze Gedicht scheint mir davon geradezu überladen. Ich, mein, mir, das flektierte Verb - all das kommt im Original nicht vor. Ist dieses Gedicht nicht eigentlich viel entrückter, wird man durch die Nennung der 1. Person nicht dauernd wie aus einem Traum gerissen? Es soll keine fertige Übersetzung sein, aber warum kann man es nicht einfach ungefähr so schreiben, mehr steht ja auch nicht im chinesischen Original: Vor dem Bett helles Mondlicht, wie Reif auf der Erde. Mit erhobenem Kopf den hellen Mond sehen, mit gesenktem Kopf an die Heimat denken. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 20.09.2016 um 15.14 Uhr |
|
Das Wort Kopf klingt halt in lyrischen Texten nicht so gut. Soviel Freiheit hätte ein Übersetzer dann wohl schon: Vor dem Bett helles Mondlicht, wie Reif auf der Erde. Aufschauend zum hellen Mond, versinkend in Gedanken an die Heimat. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.09.2016 um 16.07 Uhr |
|
Ich bin kein Fachmann, kenne auch die zweifellos ausgedehnte Literatur zu diesem Gedicht nicht. Das Subjekt fehlt ja in sehr vielen Gedichten, was ihnen gerade dieses Unbestimmte zwischen persönlich und allgemein gibt und die altchinesische Lyrik so einzigartig macht. Es wäre im Deutschen sehr gewöhnungsbedürftig, wollten wir das "Ich" überall auslassen, wo es im Chinesischen nicht steht, und überhaupt unserer Grammatik entgegen, so viele Sätze ohne Subjekt zu lassen. In der zweiten Zeile fehlt Ihrer Übersetzung das "yi", ein bloßes "wie" ist doch wohl zu wenig. Ist nicht der zweifelnde Gedanke des Sprechers gerade der Grund, warum er den Kopf hebt? - In China haben wir zusammen mit Dozenten und Studenten das Mondfest gefeiert, mit den gehaltvollen Mondkuchen und einem großen Gelage. Zwischendurch gingen wir nach draußen und betrachteten den Vollmond, und jeder dachte an die Freunde und Verwandten, die zur selben Stunde denselben Mond sahen, und alle waren gerührt. Meine Frau mußte zum allgemeinen Gesang der sehr sangesfreudigen Chinesen ein Lied beisteuern ("Der Mond ist aufgegangen"), und ich rezitierte Li Bais "Ye si", worauf mir der Dekan mit Tränen in den Augen um den Hals fiel. (Kleiner Tip für Auslandsreisende!) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 20.09.2016 um 17.32 Uhr |
|
Ich war auch auf Kürze bedacht und hielt deshalb tatsächlich den Zweifel mit wie für hinreichend übersetzt. Aber Sie haben recht, es ist schwächer als ein als wär oder ein als ob oder eine Formulierung als Frage und begründet vielleicht nicht ausreichend den Blick nach oben. Was das Gewöhnungsbedürftige des subjektlosen Satzes betrifft – dem ersten Teil meines Versuchs fehlt sogar das Prädikat –, umgangssprachlich kommt das auch bei uns oft vor, man redet nicht immer in ganzen Sätzen, und "so viele Sätze" sind es ja auch wieder nicht in dem kurzen Gedicht. Gerade, weil es sicher etwas anders als gewohnt klingt, man weiß normalerweise, daß man eine Übersetzung vor sich hat, denke ich, daß so auch etwas von der Stimmung des Originals mit wiedergegeben wird. Statt "versinkend in Gedanken an die Heimat" wäre vielleicht "versinkend in Heimweh" noch treffender und fast so kurz wie das Original. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.09.2016 um 18.24 Uhr |
|
Aber ist das Wesentliche nicht gerade, daß Gefühle nicht erwähnt werden? Die bloße Nennung von bestimmten Gegebenheiten evoziert starke Empfindungen. Das hat mir auch jene chinesische Studentin zu vermitteln versucht. Aber was rede ich! Wir werden nicht schaffen, woran bisher noch jeder gescheitert ist. Jeden erfreut es auf seine Weise, darum habe ich, was mich betrifft, die Geschichte mit dem Mondfest erzählt. Vor vielen Jahren kannte ich eine koreanische Studentin, die beim Anblick gewisser leuchtendroter Gegenstände weinen mußte. Es hing irgendwie mit Krieg und Trennung zusammen, ich stand ratlos vor so viel Unglück. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 20.09.2016 um 19.16 Uhr |
|
Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, daß ich gut Chinesisch kann, ich habe leider nur Grundkenntnisse, die kaum für eine einfache Unterhaltung reichen. Aber eine ähnliche kleine Begebenheit wie Prof. Icklers "Tip für Auslandsreisende" kann ich auch erzählen. Chinesen treffen sich ja viel in Parks zu allen möglichen Freizeitbeschäftigungen. Und da dort Kalligraphie ganz groß geschrieben wird, sieht man öfters Leute, die einen mannsgroßen Pinsel in einen Wassereimer tauchen und dann im Stehen ganze Gedichte in chinesischen Zeichen auf glatte Bodenplatten schreiben. Das sind natürlich schnell vergängliche Kunstwerke, aber die Künstler haben meist viele Zuschauer, nicht nur Touristen. Einmal bat ich einen solchen Schreiber um den Pinsel. Ich kann zwar nicht allzuviel schreiben, aber die drei Zeichen "Man hai mu" für meine Heimatstadt Mannheim kannte ich natürlich. Ich war glücklich, daß mein kalligraphisches Kunstwerk zumindest lesbar war und erntete damit eine Menge Beifall. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 21.09.2016 um 17.24 Uhr |
|
Es ist immer verblüffend, wie selbst geringe Sprachkenntnisse sofort ein Lächeln ins Gesicht des Gegenüber zaubern und wie sehr sie helfen, Bekanntschaften zu machen und Freundschaften zu schließen. Aber manchmal kann es auch ins Auge gehen. Bei einem Frankreichurlaub in den Neunzigern (ich erwähne das zu meiner Entschuldigung, es war also erst kurz nach der erlangten Reisefreiheit) fragte uns zum Schluß die nette Vermieterin, ob wir denn mal wiederkommen würden. Ich wollte eigentlich peut-être sagen, da rutscht mir doch pour quoi heraus. Zum Glück bemerkte ich noch rechtzeitig am leicht indignierten Lachen meinen Versprecher und konnte ihn noch korrigieren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.09.2016 um 15.47 Uhr |
|
Im "Haus der deutschen Sprache" wird als Gedicht des Monats ein Text von Lasker-Schüler vorgestellt, der so endet: Und meine bleichen, leidenden Psychen Erstarken neu im Kampf mit Widersprüchen. Man kann es nicht ohne Heiterkeit lesen, es scheint aber ernst gemeint zu sein. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 24.09.2016 um 17.08 Uhr |
|
Auf der Suche nach dem rechten Reime Schlagen manche Dichter Purzelbäume. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.10.2016 um 05.29 Uhr |
|
Noch einmal zur Trias. Vor einigen Jahren, als die EHEC-Krankheit sich ausbreitete, schrieb eine Leserin: Wieder hat die Trias aus Angst, Panik und Hysterie Deutschland fest im Griff. (SZ 9.6.11) Drei starke Synonme und ein gelehrtes Dach drauf – statt einfach: Wieder machen sich die Leute übertriebene Sorgen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.10.2016 um 18.01 Uhr |
|
Machen Tattoos kriminell? Vgl. https://www.facebook.com/Keinetattoos/?ref=page_internal Aber das wissen wir doch seit hundert Jahren! Das kind ist amoralisch. Der papua ist es für uns auch. Der papua schlachtet seine feinde ab und verzehrt sie. Er ist kein verbrecher. Wenn aber der moderne mensch jemanden abschlachtet und verzehrt, so ist er ein verbrecher oder ein degenerierter. Der papua tätowiert seine haut, sein boot, seine ruder, kurz alles, was ihm erreichbar ist. Er ist kein verbrecher. Der moderne mensch, der sich tätowiert, ist ein verbrecher oder ein degenerierter. Es gibt gefängnisse, in denen achtzig prozent der häftlinge tätowierungen aufweisen. Die tätowierten, die nicht in haft sind, sind latente verbrecher oder degenerierte aristokraten. Wenn ein tätowierter in freiheit stirbt, so ist er eben einige jahre, bevor er einen mord verübt hat, gestorben. (...) Was aber beim papua und beim kinde natürlich ist, ist beim modernen menschen eine degenerationserscheinung. Ich habe folgende erkenntnis gefunden und der welt geschenkt: Evolution der kultur ist gleichbedeutend mit dem entfernen des ornamentes aus dem gebrauchsgegenstande. (Adolf Loos: Ornament und Verbrechen, 1908) |
Kommentar von SP, verfaßt am 03.10.2016 um 21.42 Uhr |
|
1908, das war die Zeit, als der Bauherr im Katalog ankreuzen konnte, aus welcher Stilepoche das Gebamsel stammen soll, das der Baumeister an sein Bauwerk anbringt. Es war die Zeit der Türmchen und Erkerchen, die die bauhistorisch Gebildeten damals gar nicht gemocht haben und die heute unter Denkmalschutz stehen. Es war auch die Zeit, in der sich Berlin auf eine Zukunft als Zehnmillionenmetropole vorbereitet hat; ähnlich wie heute. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.10.2016 um 06.29 Uhr |
|
Sind nicht in unseren postmodernen Zeiten die Verzierungen zurückgekehrt? Irgendwann hat man angefangen, die Nierentisch-Ästhetik auf Grabsteine zu übertragen; die Quader kriegten eine wellenförmige Oberkante oder einen "Schlag" wie die Sofakissen usw. Auch viele Hausfassaden, obwohl aus Glas und Stahl, haben seltsame dysfunktionale Giebelchen, wobei das Runde und das Eckige sich noch schlechter vertragen als beim Fußball. Ich frage mich schon seit Jahren, wann die Leute sich daran sattgesehen haben werden.
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 04.10.2016 um 08.27 Uhr |
|
"The cause of criminality among the white population of England is perfectly obvious to any reasonably observant person, though criminologists have yet to notice it. This cause is the tattooing of the skin." http://www.city-journal.org/html/it-hurts-therefore-i-am-12341.html |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.11.2016 um 04.44 Uhr |
|
Von "Dalrymple" gibt es auch eine Kritik an Le Corbusier: https://www.welt.de/kultur/article13608576/Le-Corbusiers-Bauten-schlimmer-als-Bombenkrieg.html Er erwähnt auch die Planstadt Chandigarh, die "Stadt der weiten Wege" (Wikipedia), wo Le Corbusier vergessen habe, daß eine indische Stadt Schatten braucht, und wo laut Wikipedia inzwischen der von Le Corbusier so geliebte Beton bröckelt. Andere haben sich oft genug über das von Le-Corbusier-Schülern entworfene Brasilia geäußert. Auf ihn geht auch der Ausdruck Wohnmaschine zurück; in solchen sollen wir nach dem Wunsch des Meisters unser Leben verbringen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.03.2017 um 14.44 Uhr |
|
Karl Heinz Bohrer war immer ein ausgesprochen markanter, hochindividueller Charakter. (Ijoma Mangold, ZEIT 20.9.12) So darf man nicht schreiben, nicht einmal nachts um zwei. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.06.2017 um 16.26 Uhr |
|
Die beliebte Rede von "Sprachsünden" ist so harmlos wie verfehlt. Meistens geht es um Fehler (Versehen, Irrtümer) oder einfach um Verstöße gegen eine Schulnorm. Es gibt nur ein wirkliche Sprachsünde: den Betrug durch einschüchternde oder einlullende Ausdrucksweise, also das Imponieren einerseits, die Wonnen der Erbaulichkeit andererseits. Sünde ist es, weil dafür keine weltlichen Strafen vorgesehen sind, sondern nur das ewige Schmoren in der Hölle. (So verstehe ich Eduard Engel und schließe mich an.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.07.2017 um 17.20 Uhr |
|
Der Computer als Bedrohung des Humanums (Aus Politik u. Zeitgeschichte 30.6.98) Im Deutschen gibt es kein Humanum; trotzdem tut der Verfasser so, als wüßte jedermann, was das Humanum ist. Auch Lewitscharoff begründete ihre Polemik gegen künstliche Befruchtung damit, dass das Humanum nicht angetastet werden soll. Vielleicht kann der Gynäkologie die Befruchtung vornehmen und dabei darauf achten, daß er das Humanum nicht antastet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.07.2017 um 04.20 Uhr |
|
... daß Ihre Kämpfe und Demütigungen nicht vergebens sind. (Heinrich Böll: Neue politische Schriften. Köln 1973:7) Der Angeredete ist Subjekt der Kämpfe und Objekt der Demütigungen; dadurch wirkt der ganze Ausdruck schief. Bei Heinrich Böll kann von "stilistischer Pracht" ja keine Rede sein; trotzdem bringe ich die Stilblüte hier unter. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.07.2017 um 09.15 Uhr |
|
Ich finde den Satz schon deswegen schief, weil Demütigungen überhaupt nicht vergebens sein können. Sonst könnte es ja einen Sinn haben, jemanden zu demütigen. Also, auch wenn man die Kämpfe und somit den wechselnden Subjekt-Objekt-Bezug wegläßt, ... daß die Demütigungen nicht vergebens sind, halte ich den Satz für schief. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.07.2017 um 09.51 Uhr |
|
Es könnte allenfalls sinnvoll sein, jemanden zu demütigen, um ihn zu einer besseren Einsicht zu bringen, evtl. auch aus Rache oder als Strafe, aber um einen solchen Zusammenhang geht es ja hier nicht.
|
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 28.07.2017 um 10.05 Uhr |
|
Gleich der folgende Satz lautet: "Es ist diese Hoffnung, die mich veranlaßt, auch weiterhin in sozialistische Länder zu reisen, obwohl mir die Zweideutigkeit solcher Reisen klar ist.“ Manche Formulierungen sind ein zweideutiges Schwert …
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.07.2017 um 11.54 Uhr |
|
Die Kämpfe, die man führt, und die Demütigungen, die man erleidet – das alles soll nicht vergebens sein.
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 28.07.2017 um 12.37 Uhr |
|
Der Kampf, ein Visum zu bekommen, und die Demütigung, an der Grenze gefilzt zu werden?
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.07.2017 um 14.28 Uhr |
|
Ja, das ist dann die äußere Sicht. Von innen her haben wir immer gedacht, eure Sorgen möchten wir mal haben. Glücklicherweise haben sich beide Seiten erledigt.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.08.2017 um 06.16 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1407#20304 Auch bei einem anderen Musikkritiker läßt Sokolov die Sicherungen durchbrennen: Irgendwo aus der Welt vor dem Urknall, der Zeit vor der Zeit und dem Raum vor dem Raum. muss der Pianist Grigory Sokolov zu uns zu Besuch gekommen sein, irrtümlich vielleicht oder einer tröstlichen Dienstanweisung folgend. Seitdem macht er Musik für uns (...) (Jan Brachmann FAZ 3.8.17) Was kann da noch kommen, was bliebe gegebenfalls für die Komponisten selbst, Mozart und Beethoven, die er diesmal spielte? Nachtrag: Derselbe ein paar Tage später zur Hammerklaviersonate mit Kissin: ... dem unlösbaren Intelligenztest der Schlussfuge, deren eng getaktete Themeneinsätze uns irgendwann um die Ohren fliegen wie Granaten im Häuserkampf. (FAZ 7.8.17) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.10.2017 um 05.05 Uhr |
|
Zum Goethe-Zitat: Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, Doch tausendfacher war mein Mut. Den Mathematiker graust es (er reitet geschwind), aber wir anderen können in der sinnlosen Steigerung durchaus einen Sinn erkennen. Auch deshalb, weil das Zahlwort nicht buchstäblich gemeint ist, sondern im Sinne von "viel", also "viele Ungeheuer – noch mehr Mut". Vgl. auch Und alle Funken folgten ihren Kreisen, Um sich noch tausendfacher zu entfalten (Dante, übers. von Zoozmann) Grammatiken und Wörterbücher schließen gewöhnlich bestimmte Formen (Mehrzahl, Steigerung) aus, aber das scheint mir meistens überflüssig. Der Sprecher weiß ja, was er sagen will, und wenn er die Bedeutung eines Wortes kennt, weiß er auch, ob Mehrzahl oder Steigerung sinnvoll sind oder nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.11.2017 um 06.08 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1407#19692 Das Hermaphroditisch-Klassenlose (Karl Heinz Bohrer) hat Eduard Engel vorausschauend kommentiert. Zur Wortprägung eines minderen Schriftstellers sagt er: „Es soll törichte Referendare geben und es gibt bestimmt blonde Referendare, es gibt aber ganz sicher keinen törichtblonden Referendar.“ (Stilkunst 1911:143) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.11.2017 um 05.32 Uhr |
|
Noch einmal zu Tätowierungen. Eine häufige Fehlschreibung ist Tatoo. Tatsächlich ist das Wort in vieler Hinsicht schwierig, eben ein reines Fremdwort. Tatu hätte man längst zulassen sollen, oder gleich Tatau mit Annäherung an die Herkunft und an die Ethnographie. Was die Sache selbst betrifft, so fehlt in vielen Darstellungen ein Hinweis auf den Horror vacui als Motiv: Leere Flächen zu füllen scheint ein urtümlicher Drang zu sein, vielleicht weil sie Einfallstore des Bösen sind, das man apotropäisch bedenken muß. Wenn das stimmen sollte, ist es heute sicher umfunktioniert. Ich selbst habe mich schon oft gewundert, warum besonders die Frauen alle möglichen Stellen ihres Körpers mit irgend etwas behängen oder bemalen zu sollen glauben. Ganze Kulturentstehungstheorien bauen auf "Schmuck". |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.11.2017 um 18.17 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1407#26868 Die Pornographie, die ihr eigenes Phantasma als unerreichbar bewahrt und es mit derselben Geste unansehbar nahe rückt, ist die eschatologische Form der Parodie. (Giorgio Agamben) Das hatte ich mir als besondere Blüte notiert. Lore Brüggemann schlägt folgende Permutation vor: Die pornographische Geste parodiert die unerreichbare Nähe der Eschatologie und bewahrt sie als Unansehbares. (http://jajajaneeneenee.blogspot.de/2010/10/lat-uns-agamben.html?m=0) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.03.2018 um 04.39 Uhr |
|
Maria Furtwängler ist eine vielbeschäftigte Persönlichkeit. (FAS 18.3.18) Persönlichkeit ist fülliger als Person (und auch dieses Fremdwort entfernt sich schon etwas von der Alltagssprache, die entweder gar kein Substantiv oder Mensch, Frau sagen würde), und so schiebt sich das Abstraktum an die Stelle des Konkretums. Der Vorgang folgt einem anerkannten Muster, aber insgesamt wird die Sprache dadurch immer "blutleerer". |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.04.2018 um 09.29 Uhr |
|
Ergänzend zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1407#25328: Die Gesellschaft für deutsche Sprache lobte 1988 (Sprachdienst 32/1) einen Buchpreis aus für ein Ersatzwort anstelle von "Retortenbaby". In Heft 4 desselben Jahrgangs wurde bekanntgegeben, daß die Wahl auf "IVF-Kind" gefallen war, das in einer einzigen Einsendung vorgeschlagen worden sei. Die war von mir, aber den Buchpreis habe ich bis heute nicht erhalten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.04.2018 um 11.30 Uhr |
|
Blickes Tod. (Botho Strauß über die Leute, die nur noch auf ihr Smartphone starren) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.10.2018 um 06.51 Uhr |
|
Freud war ein brillanter Stilist von bestechender Klarheit. Mit Recht wird in seinem Namen ein Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa verliehen. (...) Man braucht von der Psychoanalyse nicht viel zu halten, um sich gleichwohl an der Klarheit und der souveränen Eleganz der Sprache Sigmund Freuds zu laben. (Wolf Schneider) Wenn aber die Psychoanalyse nur ein Blendwerk ist – was bedeutet dann die preiswürdige Vorbildlichkeit des Stils? Kann man einen Varieté-Zauberkünstler als vorbildlichen Experimentalphysiker feiern? Oder kommt es nicht doch auch auf die Sache an? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.10.2018 um 06.47 Uhr |
|
Patrick Bahners über die Friedenspreisverleihung an das Ehepaar Assmann (FAZ 15.10.18): In dieser polarisierenden Pointierung kämen im Tonbild der Verlesung der Rede die Rollenzuschreibungen zum Ausdruck, die Topoi der rudimentären Assmannologie sind, des Versuchs professioneller Leser, sich einen Reim auf dieses seltene Phänomen kooperativer Autorschaft zu machen. Usw. – das ist Normalton im Feuilleton der FAZ. Auch wenn den Verfassern offensichtlich gefällt, was sie schreiben – dem Leser gefällt es nicht so sehr. So darf man einfach nicht schreiben. Man würde ja auch unter sehr gebildeten Menschen nicht so sprechen, etwa in der Mensa. Ich weiß, daß eine Rede keine Schreibe ist, aber die Verstehensbedingungen sind nicht ganz und gar verschieden, und eine gewisse Rückkoppelung an die gesprochene Sprache ist nie verkehrt. Sonst kommt eben solche Unnatur heraus, wie Eduard Engel sie angeprangert hat. Man legt den Text beiseite mit dem Gefühl, daß es unglaublich gescheite Leute gibt, die aber lieber für sich bleiben möchten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.10.2018 um 05.16 Uhr |
|
Die Versuchung ist groß, ab und zu schmucke Ausdrücke wie proton pseudos einfließen zu lassen. Man stellt sich dann in eine Bildungstradition und ist schon mal nicht mehr so allein. Eine kleine Stufe höher ist deuteros plous (wie z. B. Platonleser Hartmut von Hentig sein Machwerk zur Rechtschreibreform nannte). Dies hat noch eher Zitatcharakter als das zum Allgemeinbegriff gewordene proton pseudos. Von all solchen Geschmacklosigkeiten sollte man sich fernhalten.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.10.2018 um 05.06 Uhr |
|
Die Wähler interessieren die kleinen, aber nicht lapidaren Dinge: Darf ich mit meinem Diesel noch in die Stadt fahren? (FAZ 27.10.18 über den hessischen Wahlkampf)
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.10.2018 um 06.34 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1407#39828 Zum selben Text von Patrick Bahners äußert sich eine Leserbriefschreiberin (29.10.18) und zitiert einen besonders unverständlichen Satz daraus. Ich bin also nicht der einzige, der diese Schreibweise unerträglich findet. Wenn die Redaktion solche Kritik veröffentlicht, wird sie doch wohl auch dem Redakteur bekannt werden? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.12.2018 um 08.04 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1407#22502 Spaemanns Forderung nach einem strafbewehrten Blasphemieverbot (wie sein Freund Mosebach) wird in den Nachrufen nicht erwähnt. Spaemann rechtfertigt indirekt den islamischen Terror. Die schwere Kränkung zwar nicht Gottes, aber des Gläubigen, soll härter bestraft werden als seine persönliche Beleidigung, wobei Spaemann sich willkürlich auf das doppelte Strafmaß beschränkt, aber ohne weiteres auch die Todesstrafe oder Tötung in Notwehr hätte anführen können. Diese Inkonsequenz ist sogleich bemerkt worden. „Naturrecht“ eben, evident und nicht begründungsbedürftig, aber potentiell terroristisch. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.02.2020 um 05.03 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1407#36916 Eine Musikkritik der SZ ist überschrieben „Lyrisch rasant“. Warum nicht? Alles geht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.03.2020 um 07.25 Uhr |
|
Wenn man sich vornimmt, nie wieder das Wort bekanntlich zu verwenden, wird man ein neuer Mensch.
|
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 18.03.2020 um 06.45 Uhr |
|
Man sollte hinzufügen, daß bekanntlich oft überflüssig ist, aber nicht immer. Man liest am Anfang Ihres neuesten Beitrags an anderer Stelle: Die Begrüßungsmoden wechseln bekanntlich schnell und wandern auch über Grenzen. Das ist doch ein einwandfreies und sinnhaltiges bekanntlich, das auch nichts mit sprachlicher Angeberei zu tun hat. Mündlich verwendet man stattdessen die Partikel ja, also etwa: Er ist ja dann an Krebs gestorben. Dieses ja taucht in Gesprächen sehr häufig auf. Überflüssig wird dieses Synonym von bekanntlich wohl nicht sein. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.03.2020 um 07.02 Uhr |
|
Natürlich habe ich übertrieben, wie immer. Mir unterlaufen täglich Dinge, die ich eigentlich nicht will. (Auch dieses "eigentlich"...) In allen meinen Texten wimmelt es von "bekanntlich". Mit "bekanntlich" dämpft man den Anspruch, etwas Neues mitteilen zu können. Aber warum teilt man es dann überhaupt mit? Man nimmt ihm den Charakter einer Mitteilung und macht es zu einer bloßen Erinnerung, die für das Folgende gebraucht wird. Das ist so ähnlich wie mit dem schon erörterten "auch": http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1058#22830 |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.04.2020 um 08.11 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1407#35884 Urknall-Brachmann zu Sokolows 70. Geburtstag: Wahrscheinlich ist es diese Erfahrung inniger Zuwendung, die Sinn schafft, Freiheit schenkt, zugleich aber eine immense Umgebungskontingenz mitschwingen lässt, welche uns bis ins Mark erschüttert. Es ist das Innewerden einer Gehaltenheit ins Nichts. (FAZ 18.4.20) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.04.2020 um 16.06 Uhr |
|
Zum vorigen, auch wenn es der Sache nach anderswohin gehört: Jan Brachmann über Vorspiel und Orgasmus in der Musik: Wir wissen aus Studien der Hirnforschung der letzten Jahre, etwa an der kanadischen McGill University, dass das Anhören von Musik die Ausschüttung von Dopamin im Gehirn auslösen kann und damit ähnliche Belohnungserlebnisse schafft wie beim Essen, beim Sex oder beim Drogenkonsum. Wenn Versuchspersonen ihre Lieblingsmusik hören, dann nehmen sie den Höhepunkt bereits vorweg. Einige Sekunden vor dem Gipfel des Glücks wird der Nucleus caudetus (!), in dem der Aufbau von Erwartungshaltungen lokalisiert ist, bereits mit dem Belohnungshormon Dopamin geflutet. Mit dem Höhepunkt selbst wird dann der Nucleus accumbens, das eigentliche Belohungszentrum, aktiv. Schauer laufen den Nacken herunter, Gänsehaut entsteht. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/hirnforschung-musik-hat-viel-mit-erotik-und-sex-zu-tun-16726315.html Meine praktisch denkende Frau meint, Brachmanns sollten ihr Schlafzimmer besser heizen. Gänsehaut (also Haarsträuben) gibt es bei Nationalhymnen, aber diese Art von kollektiver Ergriffenheit dürfte dem Sex nicht förderlich sein. Manche Paare sollen Ravels Bolero als Leitfaden auflegen, da wird in der Orchesterfassung am Ende kräftig gestöhnt. Liszts Liebestraum ist zu subtil, eher zum Nachhören. Wagneropern dauern zu lange. Zur Theorie vgl. „Schrittmacherphänomene“ nach Rudolf Bilz (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#32037). Mit dem „Caudetus“ läßt sich Brachmann etwas entgehen, denn der Nucleus caudatus hat ja, wie der richtige Name sagt, einen Schwanz! Eine Hirnforschung, die immer wieder beim unspezifischen Dopamin landet, hat noch einen weiten Weg vor sich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.11.2020 um 05.28 Uhr |
|
Schmuck ist Ornament, der nackte Mensch (das Menschentier) ist Funktion (form follows function). Das Verschwinden des Ornaments ist ein Hauptmerkmal der Moderne. Man sieht es z. B. an den Schriften; Zierschriften sind völlig aus der Mode gekommen, man hat es im Gegenteil bei Groteskschriften manchmal mit der Reduktion zu weit getrieben, wenn Lesbarkeit das Ziel sein soll. Die Postmoderne treibt ihr ironisches Spiel mit den überholten Formen: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1407#33447, aber das läßt schon wieder nach. (Auch an der Architektur, die nur die Originalität des hochbezahlten und preisgekrönten Architekten ausstellt, sieht man sich schnell satt und würde sie gern abreißen, wenn nicht inzwischen der Denkmalschutz seine schützende Hand darüber hielte.) Inbegriff der Moderne ist für mich immer der Türgriff, die Türklinke. Zum Gegenbild gehören noch andere Staubfänger von früher, die man sich nur leisten konnte, weil es Dienstmädchen gab, die den ganzen Tag putzten. Wenn der Staub gefegt war, ging es wieder mal an das Silberbesteck. Berührungsfrei funktionierende Klotüren und Waschbecken-Armaturen sind wünschenswert und werden nun wohl öfter installiert werden. Ich versuche beim Verlassen einer öffentlichen Toilette die Tür mit dem Ellbogen aufzustoßen und wasche mir auch lieber die Hände erst zu Hause, statt den zwangsläufig ekligen Wasserhahn zu betätigen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.01.2021 um 06.04 Uhr |
|
Aus Bildern wurden Schriftzeichen. Die Kalligraphie macht aus Schriftzeichen Bilder, wenn auch nur selten gegenständliche. Man kann sie an die Wand hängen. Die Muslime haben es u. a. wegen des Bilderverbots sehr weit getrieben, die Chinesen gehen eher in die andere Richtung (Abstraktion, Weglassen). In beiden Fällen könnte man das Handicap-Prinzip unterstellen: Man muß es sich leisten können. Kalligraphie vermindert immer die Leserlichkeit, arbeitet also dem ersten Zweck der Schrift entgegen. Der Text einer Sure ist ja auch keine Mitteilung mehr, weil jeder ihn ohnehin auswendig weiß. Das Ornamentale, die "Pracht", schmückt und ehrt, diese Funktion ist dominant geworden. Ein Beispiel für die unaufhörliche Umfunktionierung, das kulturelle Analogon zur biologischen Exaptation. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.01.2021 um 06.41 Uhr |
|
Von der alten Überschätzung des Dichters als Prophet leitet sich her, daß noch heute die Schriftsteller reihum zu Corona befragt werden, obwohl ihnen dazu nichts anderes einfällt als jedem von uns. So kommt es, daß die Meinung einer Frau Streeruwitz veröffentlicht, kritisiert, verteidigt, wieder kritisiert wird usw., was die Seiten füllt und die Bekanntheit fördert. (Streeruwitz hatte mal gegen die Rechtschreibreform protestiert, schreibt aber auch reformiert. Sonst hat sich nicht viel geändert.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.10.2022 um 07.10 Uhr |
|
Die SZ widmet ihre ganze dritte Seite Martin Mosebach. Tobias Haberl interviewt ihn, nicht zum erstenmal. Die Frankfurter Bürotürme, die man von Mosebachs Balkon aus sieht, erinnern Haberl selbstverständlich an Erektionen. Haberl schreibt wie Mosebach in seinen schwächsten Augenblicken: „Irgendwann erscheint Mosebachs Frau auf dem Balkon, blondes Haar, blauer Lidschatten, eine kurios-hübsche Person aus schwedischem Adel. Sie komme vom Zahnarzt und müsse sich entschuldigen, er habe sie doch ordentlich zugerichtet. Beim Hinausgehen streichelt sie den Kopf ihres Mannes, der sich für einen Augenblick aus dem Stuhl erhebt, um ihr zum Abschied die Hand zu reichen. Ihre Blicke begegnen sich flüchtig, ein Spiel aus Nähe und Distanz, unzeitgemäß und anrührend zugleich.“ Auch meine Frau und ich gucken uns manchmal an, aber es ist meisten keiner dabei, der es so edel stilisieren könnte, daß man sich an Hofmannsthal ("Die Beiden") erinnert fühlt. Was Mosebachs Frau betrifft, so ist der schwedische Adel anscheinend wichtiger als der Name, den man nicht erfährt. Was soll man sich unter „kurios-hübsch“ vorstellen? Was ist an der namenlosen Blondine kurios? Die Hübschheit kann es doch nicht sein, die ist so selten nicht. „Und ja“ (um Haberl zu zitieren): über den vulgären Milliardär Peter Thiel berichtet Mosebach, der habe ihn in T-Shirt und Frottee-Socken empfangen und sich am Ende nicht einmal bedankt. Solche Einzelheiten vergißt Mosebach nie, sie füllen ja auch manche Seite seiner manierensüchtigen Prosa (von „Manieren“ ist tatsächlich auch hier wieder die Rede). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.11.2022 um 05.55 Uhr |
|
Es gibt so viele neue Bücher, und doch überrascht es mich immer wieder, daß ganz verschiedene Zeitungen am gleichen Tag die gleichen Neuerscheinungen besprechen. Zur Zeit wird das Erscheinen des Briefwechsels zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch zum epochalen Ereignis hochstilisiert. Die Besprechungen zeigen aber nur, wie zwei Egomanen einander das Leben schwer machen, und wecken weiter keine Neugierde. Sie waren mal Lieblinge der Deutschlehrer, vor allem Frisch, bei dem es etwas zu „interpretieren“ gab, was aber auch wieder nicht besonders schwer zu verstehen war. Das ist ein Hauptgrund der fortdauernden Hochschätzung (ich hatte schon mal das Auf und Ab der Amazon-Rezensionen als Indiz genannt). Wenn nicht jeder als Gymnasiast damit zu tun gehabt hätte, würde man heute kaum darauf verfallen, so etwas zu lesen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.05.2023 um 16.36 Uhr |
|
„Es gibt nichts Sinnloseres, als Lewitscharoffs Werk autobiografisch zu lesen.“ So supergeistreich gibt sich die FR. Andere Nachrufer tun das Naheliegende und lesen ihr Werk autobiografisch. Sie hat ja selbst dazu eingeladen. Zu ihrer Dresdner Rede über die „Halbwesen“ (IVF-Kinder) lieferte sie eine autobiographisch begründete Entschuldigung, die im Grunde noch peinlicher war als die Entgleisung selbst. Ich will aber nicht weiter auf all den Unsinn eingehen, der von ihr und über sie geschrieben wurde. Das Gras wächst ja bereits drüber. Mundus vult decipi, das ist alles. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.05.2023 um 16.43 Uhr |
|
Kurzes Nachtreten: Thomas Steinfeld (SZ) und Andreas Platthaus (FAZ) versuchen, der Verstorbenen doch noch eine gewisse Bedeutung zuzuschreiben. Platthaus schreibt in einem zierlich gedrechselten Text: Natürlich spielte bei der Liebe der Schriftstellerin zum Doppel-f in ihrem Namen auch eine Rolle, dass „ff.“ in der deutschen Textwissenschaft für „fortfolgende“ steht – ein Zitiervermerk, der auf Kontinuität verweist: Er signalisiert das offene Ende. Sibylle Lewitscharoff gebrach es zuallerletzt an transzendentaler Gewissheit. Da gebricht es wohl an etwas anderem. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.08.2023 um 03.52 Uhr |
|
Ich mußte unwillkürlich grinsen. Das ist zwar sehr oft belegt, kommt mir aber schief vor. Erstens weil es doppelt gemoppelt ist (müssen und unwillkürlich; ich muß grinsen allerdings brieflich auch bei Tucholsky), zweitens weil es mehr der Ausdrucksdeutung durch einen anderen entspricht (höhnisch, schadenfroh o. ä.), also in die Kategorie ich verschwand im Walde gehört.
|
Kommentar von Christof Schardt, verfaßt am 22.08.2023 um 07.00 Uhr |
|
"Es ging um die fünf zentralen Eckpfeiler der Außenpolitik von Annalena Baerbock..."
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.12.2023 um 07.47 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1407#36916 Das Feuilleton erfreut uns täglich mit Ballungen wie "brachial-poetisch" (hier soll es die h-Moll-Sonate von Liszt sein). Man kombiniere zwei Wörter, zwischen denen sich absolut keine Verbindung herstellen läßt. In die dadurch entstehende Kluft stürzt der Leser und fragt sich, ob er gerade Tiefsinn oder bodenlosen Unsinn erlebt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.02.2024 um 06.31 Uhr |
|
„Canettis Deutung (...) war getragen von passionierter Empathie.“ (Sigrid Löffler, SZ 22.2.24) Wie kann man so häßliches Deutsch schreiben? Was ist denn an „leidenschaftliches Mitgefühl“ so schlimm? Vielleicht würde die Verfasserin sagen: Das ist nicht das gleiche. – Darüber haben sich schon Lessing und Engel lustig gemacht. |
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 23.02.2024 um 23.45 Uhr |
|
Oft bilden Modewörter den Kern einer schlechten Formulierung, hier ist es »Empathie«. Der Drang, sie zu verwenden, ist stärker als das Bemühen um einen klaren Ausdruck. Besonders schlimm wird es, wenn gleich mehrere solcher Wörter zu einem Haufen zusammengerecht werden. So kommentiert Konstantin von Notz den Ausstieg der Union aus den Gesprächen mit den Ampelfraktionen über eine Änderung des Grundgesetzes zur Stärkung der Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts wie folgt: »Während Millionen Menschen in unserem Land für unseren Rechtsstaat und seine Wehrhaftigkeit auf die Straße gehen und eine klare Erwartungshaltung in Richtung Politik adressieren, kriegt es Friedrich Merz noch immer nicht hin, über seinen Schatten zu springen, so dass wir als Demokratinnen und Demokraten gemeinsam und überfraktionell an einem besseren Schutz unserer höchsten Verfassungsorgane arbeiten können.« (www.gruene-bundestag.de, Hervorhebung von mir.) = Die Leute haben eine klare Erwartung an die Politik geäußert.
|
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 24.02.2024 um 02.22 Uhr |
|
Hier überschneiden sich meiner Ansicht nach verschiedene Problembereiche. Der erste ist die auf dieser Website schon oft diskutierte Wichtigtuerei durch den Gebrauch von Fremdwörtern, um die Dürftigkeit der eigenen Argumente bzw. Argumentation zu verschleiern. Der zweite ist der überwältigende Einfluß des Englischen mit seinen vielen lateinischstämmigen Wörtern, die dann, notdürftig ans Deutsche angepaßt, importiert oder re-importiert werden (deutlich im Artikel von Frau Löffler). Der dritte ist die Gedankenlosigkeit, mit der das alles angenommen und reproduziert wird, ohne verstanden worden zu sein. All das gilt sowohl für die Politik als auch für den akademischen Bereich (teilweise auch für die Medien). Ich kann aus eigener und zunehmend unangenehmer Erfahrung berichten, daß meine kritischen Fragen bezüglich der Bedeutung eines solchen Kauderwelschs (d.h. der Bedeutung eines Textes) und der Forderung nach allgemeinverständlicheren Formulierungen in Gremien schon deshalb auf Ablehnung stießen, weil die Mitglieder dann gezwungen gewesen wären, anstatt Phrasen zu dreschen, konkret auszudrücken, was sie eigentlich meinen. Dem von Herrn Metz erwähnten Konstantin von Notz sollte man vielleicht mitteilen, daß man statt "kriegt es Friedrich Merz" in schriftlicher Form vielleicht besser "bekommt es Friedrich Merz" sagen sollte, aber das ist natürlich nur Beckmesserei. Paßt aber ins Bild. |
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 24.02.2024 um 03.06 Uhr |
|
Interessant, daß auch Sie über »kriegt es nicht hin« gestolpert sind. Mir ging es genauso, und ich wollte in meinem Beitrag eigentlich noch darauf eingehen, habe es dann aber vergessen. Der flinke Wechsel zwischen verschiedenen Registern führt zu einer stilistischen Achterbahnfahrt, die vom Sprecher offenbar nicht bemerkt oder zumindest in Kauf genommen wird. Vielleicht geht es auch darum, verschiedene Gruppen in ihrem jeweiligen Jargon anzusprechen und damit breite »Anschlußfähigkeit« zu demonstrieren: Die »adressierte Erwartungshaltung« bedient das intellektuelle Publikum, die »Demokratinnen und Demokraten« sind eine Verbeugung vor dem Feminismus, und daß Herr von Notz »kriegt es nicht hin« sagt, soll uns wohl zeigen, daß er sogar die Sprache des gemeinen Volkes beherrscht.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.07.2024 um 04.18 Uhr |
|
Noch mal zum neuen Büchnerpreisträger Oswald Egger (nie gehört): Die Süddeutsche Zeitung lobte etwas säuerlich die Unlesbarkeit (oder war es gar kein Lob?). In der ZEIT fand Volker Weidermann die Auszeichnung des Unsinns skandalös, gerade im Vergleich mit Büchner selbst, während ein anderer Redakteur rühmte, Eggers Texte seien „alles andere als verständlich“. Es handele sich um sprachliches „World Building“ und nicht um „Nature Writing“.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.08.2024 um 06.16 Uhr |
|
Vielleicht habe ich es schon einmal gesagt: Wenn ich meine eigenen Texte bearbeite (meistens in der Absicht, überflüssige Wörter zu streichen), fällt mir immer wieder auf, daß ich das Wort „auch“ zu häufig gebrauche. Es entspricht meinem ausgleichenden Naturell. (Ich weiß, daß mancher mich für gar nicht so friedfertig hält.) Auf der „Dogmatismus-Skala“ würde ich weit unten stehen. (Keine Sentenzen, kein „basta!“) Das sage ich ohne Eitelkeit, weil es nicht unbedingt nur ein Vorzug ist, sondern auch lähmen kann. Mir fällt einfach zu jeder These noch etwas anderes ein, was dagegen spricht... Der verstorbene Hans-Martin Gauger, den ich gestern gewürdigt habe, schrieb auch so ähnlich. Als er einmal eine anonyme Preisschrift eingereicht hatte und ich der Jury zuarbeitete, erkannte ich ihn sofort als Verfasser, habe meine Stilanalyse aber nur privat weitergegeben.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.09.2024 um 04.41 Uhr |
|
Der IFB-Verlag preist ein Buch über die Schönheit der deutschen Sprache an, das „niemals ihre Schönheit und Filigranität außer Acht lässt“.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.09.2024 um 04.44 Uhr |
|
Bei durchgeführten Erhebungen schneidet die Universitätsstadt immer wieder gut ab. (inFranken.de 20.9.24) Eine eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg. (Der Neue Wiesentbote 29.9.24) Im bürokratischen Stil wird Wert darauf gelegt, daß Erhebungen und Fahndungen durchgeführt werden müssen, um ein Ergebnis zu haben. Den Leser stört es wie ein Steinchen im Schuh. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.10.2024 um 18.27 Uhr |
|
„,Ich hätte den Preis bekommen sollenʻ: Clemens Meyer schimpft über Buchpreis-Jury (...) Der Spiegelʻ zitiert ihn mit den Worten ,Ich habe gerufen, es sei eine Schande für die Literatur, dass mein Buch den Preis nicht bekommen hat. Und dass es eine Scheiße ist, eine Unverschämtheit.ʻ Später am Abend soll Clemens Meyer im kleinen Kreis die Jury mit recht drastischen Worten beschimpft haben.“ (LVZ 18.10.24) Er hat den Preis also zu Recht nicht bekommen. Wer möchte auch von einer so beschissenen Jury ausgezeichnet werden? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.10.2024 um 05.18 Uhr |
|
Noch einmal Clemens (!) Meyer: „Wenn ich jetzt auf Platz eins der Bestsellerliste wäre, dann hätte ich 100.000 neue Leser und könnte meine Schulden bezahlen. Ich wäre meine finanziellen Sorgen für eine Weile los. Ich muss eine Scheidung finanzieren und habe 35.000 Euro Steuerschulden angehäuft.“ Damit ist Meyer, der übrigens schon zwei Dutzend Preise bekommen hat und nicht zu den armen Schluckern zählt, auf deren hartes Los er angeblich verdienstvollerweise aufmerksam machen wollte, wohl erledigt. Unflätiges Benehmen ist schlimm genug, aber eine nachgereichte Rechtfertigung dieser Art läßt beim potentiellen Buchkäufer die Frage aufkommen, was ein solcher Schriftsteller ihm allenfalls zu sagen hätte. – Wie elegant im Vergleich die provozierenden Auftritte des jungen Peter Handke oder Rainald Goetz!
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.12.2024 um 05.16 Uhr |
|
Es gibt zahllose neuere Bücher mit dem Wort "Phänomen" im Titel. Es ist immer weglaßbar. Die Ausstellung "Das Phänomen Homer" (Wien 2009) beschäftigte sich mit der Homer-Überlieferung und hätte es sagen sollen. "Phänomen" ist alles und gar nichts. Und das ist nur ein winziger Teil des Nebels, den die Gebildeten über ihre Sprache legen. Ich hatte mein Leben lang Gelegenheiten, dabei zuzusehen, wie sie diese Gewohnheit erwerben und weitergeben, und meine Abneigung gegen des Kaisers neue Kleider geht auch sehr weit zurück.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.02.2025 um 16.47 Uhr |
|
In älteren Romanen, keineswegs nur trivialen, wird der Physiognomie – Kinn, Mund, Nase, Augen und Stirn, aber nie den Ohren – eine solche Fülle von Informationen entnommen, daß ein Sherlock Holmes erblassen müßte. Nicht nur die Charakterzüge füllen viele Zeilen, sondern oft die ganze Lebensgeschichte in groben Zügen – was natürlich auch ein Trick des Erzählers ist. Man liest es mit nachsichtigem Lächeln oder fragt sich, wo dieses diagnostische Feingefühl heute geblieben ist.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.02.2025 um 03.36 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1407#51063 Warum sollte ff. für fortfolgende stehen (gibt es das überhaupt?)? Die Verdoppelung des f entspricht doch der üblichen ikonischen Wiedergabe von Mehrheit (seqq., pp. usw.). |
