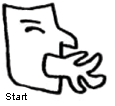


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
08.09.2008
Abfall für alle
Fortsetzung der Rezension schlechter linguistischer Einführungsbücher
Römer, Christine (2006): Morphologie der deutschen Sprache. Tübingen.
(Verf. arbeitet in Jena, bedankt sich bei Gallmann.)
"Das Buch ist in der amtlichen Orthografie abgefasst." (XI) Das trifft nur teilweise zu:
In seinem Epoche machenden „Cours (...)“
so genannt (meist getrennt, manchmal zusammen)
Sonst ist die Orthographie einigermaßen eigenwillig:
Appelativum (meist so, einmal auch Appellativum)
Eisenbergs Grundriß hieß 1998 noch nicht Grundriss. (Weitere Anachronismen dieser Art kommen vor.)
Genus verbi
die Genus verbi-Einordnung
Zu Vertrauen ist schön (53)
Pöpelwahlkampf (103)
Beschränkung der nicht Passivierbarkeit (111)
... teilt die Menge der Prädikate in zwei Gruppen, in Ereignis und nicht Ereignisprädikate (187)
ein Ereignis, dass keine inhärenten Grenzen hat (187)
Maria ist am Schal stricken (189)
Ein mehr an sprachlicher Form ist oft mit einem mehr an Bedeutung verbunden. (212)
Obligatorische Kommas fehlen sehr oft, manchmal auch andere Satzzeichen. Es gibt aber auch überzählige Kommas, gelegentlich sinnstörend (57).
Eigennamen sind oft falsch geschrieben:
Eberhardt Stock (statt Eberhard)
Sigfried Lenz (mehrmals)
Rolf Hochhut (mehrmals)
Behagel (durchgehend so)
Ernst Häckel (statt Haeckel)
Wolfgang Ulrich Wurzel (statt Ullrich)
Daniele Clement (im Register, statt Danièle Clément)
Dionysios Thrax hieß Dionysios und nicht Thrax oder Trax, wie die Verfasserin den Beinamen durchgehend schreibt (auch als „Familiennamen“ im Register). Außerdem war er vielleicht der Verfasser der ersten Grammatik des Abendlandes, aber nicht der ersten Grammatik einer indoeuropäischen Sprache; Panini ist viel älter.
Für Framework gibt es doch sicher auch einen deutschen Ausdruck? Und Subarten sind einfach Unterarten.
Durchgehend herrscht ein naiver Psychologismus, mit „mentalem Lexikon“ usw.
Seit geraumer Zeit ist es allgemein gültiges Wissen, dass Sprachzeichen aus zwei Hauptkomponenten bestehen: aus einer Laut- und einer Bedeutungsseite. (3) Die übliche Mystifikation!
Am Ende einer Silbe treten laut Römer maximal vier Konsonanten auf; aber das gilt doch nur, wenn man pf monophonematisch zählt, sonst sind es fünf wie in schrumpfst usw. (zu S. 7)
Bei sehen soll die silbische Gliederung mit der morphologischen nicht übereinstimmen:
Die Stammbaumtheorie Schleichers hat nichts mit Wortstämmen zu tun – warum wird sie hier überhaupt so ausführlich erwähnt? (36)
Der Text ist manchmal banal, manchmal bis zur Unverständlichkeit verklausuliert:
„Simplifiziertes Subkategorisierungsprinzip
In einem phrasalen Zeichen resultiert der SUBCAT-Wert des Zeichens aus der Verkettung der SUBCAT-Werte der Konstituenten. Ein phrasales Zeichen ist nur dann wohlgeformt, wenn es gesättigt ist, wenn die SUBCAT-Liste leer ist.“ (39)
Die Begriffe sind an der betreffenden Stelle nicht eingeführt oder gar erklärt, der Student kann damit nichts anfangen.
Die Ausführungen über Numeralia in der Rechtschreibreform (46) sind unverständlich.
„Wenn die Modalverben wollen und sollen (...)“ (96) Hier muß es statt sollen anscheinend möchten heißen, sonst gibt der Satz keinen Sinn.
Das Wort vollkommen soll ein Partikelpräfixverb sein (116) – es ist nicht zu erraten, was hier wirklich gemeint ist.
Die Deklination der Substantive zeigt nicht das Genus an (120).
In Er gab ihr einen Kuss soll einen Kuss das „Thema = das Ausgesagte“ ausdrücken. (124) Das ist unverständlich. (Mit Morphologie hat es, wie das meiste, natürlich auch nichts zu tun.)
„Abstrakta haben keine gegenständliche Bedeutung. Sie bezeichnen Konzepte über Erscheinungen in der Welt und Vorgestelltes.“
Dieser Abschnitt wird ausdrücklich als Lehrsatz markiert, ist aber verständlich bzw. allzu naiv. Später erfährt man, daß z. B. Jahr ein Abstraktum ist.
Strumpfhose wird als „Strumpf in Hosenform“ gedeutet und damit als Beispiel umgekehrter Determinationsrichtung. Das ist aber unnötig, „Hose in Strumpfform“ ist völlig normal.
„Von Rückbildungen spricht man dann, wenn das Verb älter ist als das Nomen (schauen > Schau).“ (137) Das ist nicht der übliche Sinn von „Rückbildung“.
Das Kapitel über Adjektive wird eingeleitet durch essayistisches Geschwätz über Mark Twain und die Entbehrlichkeit der Adjektive. (138)
Die Verfasserin behauptet, das Adjektiv werde gebraucht
„- attributiv beim Adjektiv in der Adjektivphrase: (...) dass er tatsächlich lieb ist.“ (139)
Hier ist tatsächlich aber Satzadverb und bildet mit dem Adjektiv (an dessen Stelle auch etwas ganz anderes stehen könnte) keine Phrase. Ein ähnlich krasser Fehler auf der folgenden Seite:
„- prädikativ zum Dativobjekt in der Verbphrase: Die Redewendung war den Studenten nicht geläufig.“
Hier regiert das Adjektiv in Wirklichkeit die Nominalphrase.
141: „Adjektive ohne Aktanten können nicht attributiv auftreten.“ Das ist hier tautologisch. Die Valenz der Adjektive ist unzulänglich behandelt, gehört ja auch gar nicht zur Morphologie.
„Nach den neuen Rechtschreibregeln müssen kopulativ verstandene Farbadjektive (in amtlichen Texten) mit Bindestrich geschrieben werden. Damit ist eine Eindeutigmachung bezüglich der angelegten Lesart möglich.“ (145)
Hier ist alles falsch: Die Reformorthographie gilt nicht nur für amtliche Texte, sie enthält keine Regeln für Farbadjektive, unübersichtliche (!) kopulative Adjektive können (müssen aber nicht) mit Bindestrich geschrieben werden, und die angeblich neue Regel war gerade die alte (Duden 1991, R 40; dort ausdrücklich über Farbadjektive). Die Eindeutigmachung war also damals möglich, heute ist sie es nicht mehr.
gelbsüchtig und bleichsüchtig sind nicht als Adjektiv+Adjektiv zu analysieren (146), sondern als Ableitungen von Gelbsucht, Bleichsucht. Auch bei schmähsüchtig, schwatzsüchtig, putzsüchtig liegt jeweils das Substantiv voraus. Bei ichsüchtig, selbstsüchtig (ebd.) könnte man eine Zwischenstufe der Substantivierung des Pronomens bzw. der Partikel ansetzen (selbst ist entgegen der Verfasserin kein Pronomen). draußensüchtig und außerhalbsüchtig mögen belegt sein, sind aber abweichend gebildet und sollten nicht einfach zwischen den geläufigen Bildungen aufgelistet werden.
Warum sollte der „reihenbildende Charakter“ für Derivation und gegen Komposition sprechen (147 zu Adjektiven mit nicht-, nichts-)?
148: Zusammenbildungen wie dickleibig werden so zerlegt: (dick + leib) + ig. Aber wie stellt sich das beim ebd. angeführten schwerhörig dar?
Von Pronomen wird allgemein behauptet, daß sie stellvertretend gebraucht werden. (150) Aber was vertritt das Pronomen in Ich bin Adam (150)? pro nomen ist übrigens kein möglicher lateinischer Ausdruck (159).
151: Die Verfasserin unterscheidet nicht zwischen Possessivpronomen und Possessivartikel.
Artikel sollen immer unbetont sein, „bei Betonung (z. B. 'das Kleid gefällt ihr) kommt es zur Demonstrativpronomenlesart.“ (152) Das ist unrichtig, denn das Demonstrativpronomen bleibt auch vom betonten Artikel formal verschieden: den Kleidern vs. denen.
Das Suffix -weise ist aus Weise und nicht aus „Art und Weise“ entstanden. (159)
161: Daß den Partikeln in der Vergangenheit „keine Relevanz zugesprochen“ wurde und sie als Füll- oder Flickwörter bezeichnet wurden, trifft so allgemein nicht zu, sondern wird allenfalls von der kleinen Gruppe der Abtönungspartikeln stereotyp behauptet, weil einige Sprachpfleger sich in diesem Sinne geäußert haben.
„Engel, der sich u. a. in der germanistischen Sprachwissenschaft tiefgründig mit der Modifizierung der Partikeln beschäftigt hat ...“ (162) – Wo sonst sollte er sich damit beschäftigt haben, und wieso mit der „Modifizierung“? Gemeint ist offenbar die Klassifizierung.
Das Wort nicht in den Beispielsätzen (168), S. 167 soll einmal Teilnegation, einmal Satznegation sein: Warum Männer nicht zuhören vs. Kontakt zu ihrer Familie hat sie nicht. Ich sehe keinen Unterschied.
Das Wort leider in den Beispielsätzen (176), S. 170 soll einmal Partikel, einmal Modalwort sein: Sie landeten leider nur auf dem 5. Platz vs. Gesunde Inhaltsstoffe, aber leider kalorienreich. Ich sehe wiederum keinen Unterschied.
173: „Dass es sich bei den Interjektionen um Wörter der deutschen Sprache handelt, steht außer Frage.“ Wenige Zeilen vorher hat die Verfasserin mit Zitaten belegt, daß es umstritten ist, und sie hat auch keine neuen Argumente vorgelegt.
176: Präpositionen mit schwankendem Kasus (trotz usw., mit Genitiv oder Dativ) können nicht in eine Reihe mit den Wechselpräpositionen wie an, auf usw. gestellt werden.
198: Dem Halbaffix -werk (Schuhwerk) wird eine „pluralisierende Bedeutung“ zugeschrieben, kaum mit Recht.
199: In affengeil hat doch nicht -geil den Charakter eines Affixoids, sondern, wenn überhaupt, dann affen-.
200: „Konfixe“ werden als „Verkürzungen von Fremdwörtern“ definiert, sehr ungewöhnlich. Wovon sollte poly- (ebd.) eine Verkürzung sein? Der Ableitungspfeil zwischen „biologischer Anbau“ und „Biobauer“ ist kaum interpretierbar.
204: wohnen kann seine präpositionale Kasusrektion nicht verlieren, da es keine hat, sondern allenfalls die einer Lokativergänzung.
Bei der Literaturangabe S. 213 fehlt der eigentliche Buchtitel.
226f.: Die Zuordnung von bitte zu den Abtönungspartikeln überzeugt nicht.
236: Bei den Lösungen wird behauptet, natürlich sei Abtönungspartikel in: Sie brauchen für das Anlegen eines Miniteichs Steine, Kies und natürlich Pflanzen. In Wirklichkeit ist es Satzadverb. Es gibt noch weitere fragwürdige Zuordnungen dieser Art.
Auf fast jeder Seite werden Häppchen aus verschiedenen Theorien geboten, aber immer so skizzenhaft, daß man sie weder beurteilen noch anwenden kann. Das Buch ist nicht im Sinne der generativen Grammatik angelegt, daher sind die umfangreichen Baumdiagramme, die nicht erläutert und gerechtfertigt werden (z. B. 69 oder zu den Modalverben 95 bzw. 97), ohne Erkenntniswert. Solche Ausschnitte belegen höchstens, was die Verfasserin alles gelesen hat.
Der schwerste Mangel ist aber die Themaverfehlung. Das Buch handelt größtenteils gar nicht von Morphologie. In einer Morphologie erwartet man z. B. Flexionsparadigmen, hier findet man sie nicht. Sie spricht sogleich vom Gebrauch der starken und schwachen Adjektive, ohne die starke und schwache Flexion eingeführt und des näheren erörtert zu haben. Damit fehlt ein Kernbereich jeder Morphologie. Stattdessen werden Syntax und Semantik geboten, allerdings sehr oberflächlich und oft falsch.
| Kommentare zu »Abfall für alle« |
| Kommentar schreiben | älteste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.06.2025 um 05.41 Uhr |
|
„Dabei bezeichnet die 1. Person Singular bzw. Plural einen bzw. mehr als einen Sprecher.“ (Rolf Thieroff/Petra M. Vogel: Flexion. Heidelberg 2009:12) Aber das Sprechen im Chor ist sehr selten. Ein Beispiel ist der Rütlischwur: „Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, In keiner Not uns trennen und Gefahr. (Alle sprechen es nach mit erhobenen drei Fingern.)“ S. 82 wird das korrigiert: „Anzumerken ist, dass die Pluralformen nicht genau dieselbe Bedeutung haben wie die Pluralformen sonst: wir bedeutet ‚ich und ein oder mehrere andere‘, ihr bedeutet ‚du und ein oder mehrere andere‘.“ Wobei diese Fälle auch wieder nicht genau parallel sind. Daß mehrere zuhören, ist ebenso normal wie daß einer redet. Sprechen im Chor ist kein eigentliches Sprechen, sondern ein Nachsprechen oder Aufsagen, also eigentlich ein Zitieren. Richtig gesehen bei Clemens-Peter Herbermann: Modi referentiae. Studien zum sprachlichen Bezug zur Wirklichkeit. Heidelberg 1988:62 Fn. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.06.2025 um 07.04 Uhr |
|
„Die wesentlichen Grundgedanken der Kognitiven Linguistik sind, dass Sprache durch die SprachbenutzerInnen entsteht, die mit ihrer Hilfe ihre Gedanken weitergeben.“ (Hilke Elsen: Grundzüge der Morphologie des Deutschen. 2. Aufl. Berlin 2014:21) Ist das nicht umwerfend? Das schwer fehlerhafte, aber brav durchgegenderte Buch sollte man keinesfalls Studenten in die Hand geben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.06.2025 um 16.06 Uhr |
|
„Das Pronomen steht, wie die Bezeichnung aussagt, für ein Nomen (Fürwort): 1. Ego enim sic existimo. 2. Tute dicebas.“ So liest man es in vielen Schulgrammatiken. Aber für welches Nomen stehen ego und tu? Fällt niemandem der Widerspruch zwischen der Definition und den eigenen Beispielen auf? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.06.2025 um 16.59 Uhr |
|
Schwarze, Christoph/Dieter Wunderlich, Hg.: Handbuch der Lexikologie. Stuttgart 1985 Das Handbuch ist repräsentativ für die damalige (und weitgehend noch heutige) mentalistische Linguistik und Psychologie. Es arbeitet fast von der ersten Seite an mit „Repräsentationen“, aber die Bedeutung ist sehr vage. So heißt es in der Einleitung zu den Sätzen: Ich habe heute schon wieder das halbe Rethel-Gymnasium getroffen. Das Rethel-Gymnasium hatte kürzlich seine 75-Jahr-Feier. Im ersten Satz „repräsentiere“ das Wort Rethel-Gymnasium eine Menge von Personen und im zweiten ein Gebäude. Was soll das heißen? Wahrscheinlich so etwas wie „bezeichnen“. Es wird nicht näher erläutert. Der „Wortschatz“ wird teils als Bestandteil der Sprachkompetenz, teils als dessen lexikographische Darstellung aufgefaßt; nur ersteres sei Gegenstand des Werkes. Aber wie kommt man vom Sprachverhalten als der eigentlichen Wirklichkeit zum „Wortschatz“, der unverkennbar nach dem Muster eines Wörterbuchs, also im Sinne der zweiten Bedeutung, modelliert ist? Schon Bühler, der vom „Dogma von Wortschatz und Grammatik“ als einer bekannten Tatsache spricht, hatte sich darüber ausgeschwiegen. Niemand außerhalb des behavioristischen Ansatzes zweifelte daran, den Wortschatz als psychologische Tatsache voraussetzen zu müssen. Dazu gehört stets ein Speichermodell, neuerdings als „Kompetenz“ fortgeführt. Der Psychologe Johannes Engelkamp arbeitet besonders ausgiebig mit der rätselhaften „Repräsentation“, die anscheinend das gleiche ist wie Speicherung. Man kann das heute gar nicht mehr lesen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.05.2025 um 16.00 Uhr |
|
In einer weit verbreiteten deutschen Einführung in die generative Grammatik hieß es um 1970: „Der Satz Norbert beängstigt den Köter ist völlig normal.“ „Es entsteht aber auch der ungrammatische Satz *Der Hund bewundert Norbert.“ Man erkennt hinter dem „beängstigen“ immer noch das Chomskysche, schließlich zu Tode gerittene Beispiel (frighten), von dem sich die deutschen Adepten nicht befreien konnten. Ob Hunde jemanden bewundern können, ist sicherlich keine grammatische Frage. Aber auch „Er kocht das Klavier“ sollte ja damals ungrammatisch sein. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.04.2025 um 04.32 Uhr |
|
Stephen E. G. Lea sieht vier Bereiche, die der Evolution unterliegen: anatomical, physiological, behavioural, cognitive. (Michael C. Corballis/Stephen E. G. Lea: The descent of mind. Psychological perspectives on hominid evolution. Oxford 1999:17) Für das „Kognitive“ gibt es verschiedene Synonyme wie „Intelligenz“; davon kann hier abgesehen werden. Beobachtbare Züge werden also neben das unbeobachtbare Konstrukt des „Geistes“ gestellt, weshalb ich in solchen Fällen von „koordinativem Dualismus“ spreche. Das Nebeneinanderstellen ist ein Kategorienfehler. Außer Körperbau, Physiologie und Verhalten gibt es nicht noch etwas grundsätzlich anderes, sondern dieses Geistige ist eine traditionelle Konstruktion zur Erklärung des Verhaltens: Die psychologischen Begriff interpretieren das Verhalten, sie stehen nicht neben ihm. Die Hypostasierung zu einem eigenen Wesen NEBEN dem Körper ist Metaphysik. Da es sich nicht um einen biologischen Begriff handelt, ist es von vornherein unmöglich, nach der Evolution dieses Geistes zu fragen. Der Geist wird ja nicht dem seligierenden Druck der Umwelt ausgesetzt. „...though some products of the mind fossilize, most do not.“ (21) – Nicht Erzeugnisse des Geistes bleiben erhalten, sondern Ergebnisse des flüchtigen Verhaltens. An keiner Stelle wird gezeigt, wie der „Geist“ zum natürlichen Geschehen hinzutritt, die „cognitive abilities“, die auch als „mechanisms underlying the behaviours“ bezeichnet werden (23), aber anscheinend mit den „brain processes“ (ebd.) nicht abgegolten sind, denn sonst würde es sich um historische Neurophysiologie handeln und nicht um historische kognitive Psychologie. Aber die ständig wechselnde Begrifflichkeit taucht alles in ein ungewisses Licht. Die Verfasser wissen nicht, wovon sie reden. (Es ist die Vagheit, die das Konglomerat „Kognitionswissenschaft“ durchzieht.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.04.2025 um 04.51 Uhr |
|
Zum vorigen: Wer auch nur die Anfangsgründe der Evolutionslehre verstanden hat, kann doch nicht versuchen, eine Stammesgeschichte des "Geistes" zu schreiben ("history of the mind", wie es im erwähnten Buch immer wieder heißt). Nicht der "Geist" ist Gegenstand der Selektion, sondern Körperbau und Verhalten. Ich werde nie verstehen, wie ein solcher Rückfall der Psychologie möglich war.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.04.2025 um 05.41 Uhr |
|
Michael C. Corballis/Stephen E. G. Lea: The descent of mind. Psychological perspectives on hominid evolution. Oxford 1999. Der an Darwin angelehnte Titel ist irreführend. „Geist“ ist ein Konstrukt, kein Gegenstand, der sich entwickeln könnte. Dieser Fehler bestimmt das ganze Unternehmen: „Archaeologists have provided much of the material from which we can make inferences about the mind of our ancestors.“ (V) Die überlieferten Artefakte lassen auf das Verhalten unserer Vorfahren schließen, nicht auf deren „Geist“, was immer das sein mag. Der Mensch hat gelernt, Feuer zu unterhalten. Wir wissen recht gut, wie Verhalten gelernt wird. Die Einführung eines „Geistes“ fügt nichts hinzu. "Geist" ist kein biologischer Begriff. (Pinker ist einer der meistzitierten Autoren, Skinner wird nur in der Einleitung kurz erwähnt: von Chomsky erledigt usw..) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.02.2025 um 16.09 Uhr |
|
Der neutrale Ton wird stets beschrieben, aber üblicherweise nicht mitgezählt, vielleicht weil er nur in Kombination vorkommt. Die meisten Vollwörter sind heute Komposita und durch ihre meist idiomatische Bedeutung und zusammenhängende Aussprache gekennzeichnet (汽车 – Auto). Also wie so viele englische Zusammensetzungen.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 02.02.2025 um 15.12 Uhr |
|
Zumindest theoretisch gibt es ja sogar 5 verschiedene Töne, einschließlich des neutralen bzw. unbetonten. Zum Beispiel im Falle von má mà mă mā ma treten sie alle auch tatsächlich auf, mit jeweils anderer Bedeutung, und dann können sie immer noch mehrdeutig sein. Kann man eigentlich im Chinesischen genau sagen, was ein Wort ist? Die Begriffe Morphem/Silbe/Schriftzeichen fallen dort wohl zusammen, aber ob ein Schriftzeichen nun ein Wort ist oder nur ein Morphem, scheint mir oft nicht klar zu sein. Und gibt es aus einzelnen Wörtern zusammengesetzte Wörter wie im Deutschen, oder muß man diese im Kontext des Chinesischen als Einzelwörter verstehen? Was ergibt eine neue lexikalische Bedeutung (= ein neues Wort), und was ist einfach nur kontextabhängig? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.02.2025 um 05.54 Uhr |
|
Die heutige chinesische Hochsprache (Putonghua) hat 411 verschiedene Silben, die theoretisch in 4 verschiedenen Tönen auftreten können. Macht 1644. In Wirklichkeit werden nur 1338 benutzt. Ist das nun viel oder wenig? Es ist mehr als im Deutschen, aber weniger als im Japanischen und anderen agglutinierenden Sprachen. Wären die Silben zugleich Wörter, träfe die von vielen vermutete Vieldeutigkeit zu, und dieser Effekt tritt ein, wenn man die klassische Schriftsprache in der heutigen Weise ausspricht. Dann wäre wirklich die Schrift nötig, um die horrende Vieldeutigkeit einzuschränken. In Wirklichkeit sind die Einsilbler aber Morpheme, und dann sieht die Sache nicht schlimmer aus als im Deutschen. Nur bei Eigennamen müssen die Chinesen manchmal die Schrift zu Hilfe nehmen (z. B. in den Handteller "schreiben"), aber das ist ja bei uns auch nicht anders ("Ickler mit ck wie Banane"). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.01.2025 um 05.02 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1044#23210 Die koreanische Schrift ist eine Abugida-Schrift; vgl. die Definition bei Wikipedia: "Der Begriff Abugida (...) bezeichnet einen bestimmten Typus von Buchstabenschrift (Alphabet), bei dem die Buchstaben nicht streng nach der gesprochenen Reihenfolge angeordnet, sondern segmental nach Silben gruppiert werden, weswegen sie manchmal fälschlich als Silbenschrift bezeichnet werden. Dieses Schriftprinzip ist charakteristisch für die indischen Schriften und die äthiopische Schrift." Die koreanische Schrift gehört also zum indischen Schriftkreis, zeigt aber durchaus Züge einer plansprachlichen Bearbeitung, so daß die Legende von ihrer Erfindung nicht zu weit hergeholt ist. Leider hat sich der Begriff "Abugida" bisher nicht recht durchgesetzt, obwohl er dringend gebraucht wird. Daß die ganze Welt zu Alphabetschriften (einschl. Abugida) hindrängt, dürfte nicht allein dem westlichen Kolonialismus und Imperialismus zuzuschreiben sein, sondern der Tatsache, daß diese Schriften gerade das rechte Maß an Redundanz und Ökonomie enthalten. Die chinesische Schrift übertreibt es mit der Redundanz (weshalb sie ja auch schon vereinfacht worden ist) und braucht Jahre zu ihrem Erwerb; stenographische Schriften bieten zu wenig Redundanz und sind daher für den allgemeinen Verkehr zu störanfällig. Alphabetschriften lernt man an einem Nachmittag. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.10.2024 um 17.43 Uhr |
|
Aufrichtigkeit bewundert Hans. Das Abweichende dieses Satzes (mit "Aufrichtigkeit" als Subjekt; das Beispiel erinnert von ferne immer noch an Chomskys "Syntactic structures") soll daher kommen, daß "Aufrichtigkeit" unbelebt ist. In Wirklichkeit ist es die Substantivierung von "daß/wenn/ob jemand aufrichtig ist", also ein Abstraktum im Sinne Porzigs ("Die Namen für Satzinhalte"). Abstrakta sind weder belebt noch unbelebt, solche Kategorien sind hier nicht anwendbar – auf die gleichbedeutenden Paraphrasen in Nebensatzform wendet man sie ja auch nicht an. Belebt/unbelebt sind Gegenstände, aber bei konkret/abstrakt geht es um einen Unterschied der Bezeichnungstechnik. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.09.2024 um 19.56 Uhr |
|
Man muß das wohl im Zusammenhang mit der Eigenart heutiger Germanisten sehen, Fachausdrücke immer wieder neu aus dem amerikanischen Englisch zu entlehnen. Sogar die Beispielsätze werden ja oft beibehalten, weil man sich nicht traut, die unendlich kostbaren Einsichten der Amerikaner verlustfrei an Deutsche zu vermitteln. (Ich hatte schon mal zitiert, was österreichische Germanisten über den mind und das brain sagen...) Das sieht man auch an der absurd weitgehenden Beschränkung auf neueste Literatur, meistens aus dem Umkreis der Mitarbeiter der Dudengrammatik selbst. Die großen klassischen Grammatiken werden nicht erwähnt.
|
Kommentar von Ivan Panchenko, verfaßt am 29.09.2024 um 18.13 Uhr |
|
In der Dudengrammatik bin ich auf das Wort Topik als Neutrum gestoßen, obendrein mit Topiks statt etwa Topiken als Pluralform. Die Genuszuweisung erfolgt anscheinend analog zu Thema, ich hätte aber wegen des -ik feminines Genus erwartet, das ist schließlich keine Abkürzung wie URL (wird oft feminin gebraucht, obwohl die Vollform maskulines Genus nahelegt). Auch das noch: Laut Wikipedia wird (das) Topik im Gegensatz zu (die) Topik mit [ɔ] ausgesprochen (besteht da wirklich dieser Unterschied, wissen Sie etwas dazu, Herr Ickler?). Das alles würde mich nicht überraschen, wenn das Wort mit c geschrieben werden würde. Und dann ist da noch Foki, zu erwarten wäre Fozi, es heißt ja auch Indizes. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.09.2024 um 05.40 Uhr |
|
Um die Durchsetzung der Rechtschreibreform zu fördern, folgt die Dudenreaktion dem Grundsatz „So reformiert wie möglich!“. Sie schreibt also ausschließlich selbstständig (die Hintergründe dieses „Putativgehorsams“ habe ich anderswo erörtert). Empfohlen und in der Grammatik praktiziert wird die Großschreibung in adverbialen Wendungen wie bei Weitem, von Weitem: Deklarativsätze stellen bei Weitem den häufigsten Typ unter den selbstständigen Sätzen dar. (107) Das ist ein Rückschritt in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Hierher gehört auch die Weglassung des Kommas zwischen koordinierten Hauptsätzen (http://www.sprachforschung.org/index.php?show=news&id=684#11173) Es ist ein zäher Kampf gegen die Sprachgemeinschaft.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.09.2024 um 05.24 Uhr |
|
Noch zur Dudengrammatik: „Argumente des Verbs“ ist mißgebildet, da „Argument“ ein logischer Begriff ist, „Verb“ aber ein grammatischer. Argumente sind übereinzelsprachlich, Verben gibt es wahrscheinlich nicht in allen Sprachen, oder der Begriff des Verbs bedeutet nicht überall das gleiche. Die Dudengrammatik arbeitet mit dem Begriff „Einstellung“ (auch „propositionale Einstellung“, „Sprechereinstellung“), definiert ihn aber nicht und führt ihn nicht als Stichwort im Register an. „Propositionale Einstellung“ wurde 1940 von Russell eingeführt. Die Übernahme solcher Begriffe aus der Logik in die Sprachwissenschaft versteht sich nicht von selbst. Die Lehre von Proposition + propositionaler Einstellung ist übrigens auch in der Philosophie nicht unumstritten. Zu welchen Absurditäten die Lehre etwa bei Hans Altmann führt, habe ich schon gezeigt (sagen/fragen/erreichen als „propositionale Grundeinstellungen“ usw.). All dies sind Beispiele für die Verwendung von Bruchstücken bestimmter fachfremder Theorien. Wie immer, wenn es wissenschaftlich aussehen soll, setzt man voraus, daß die entlehnten Begriffe dort, wo sie herstammen, schon geklärt sein werden. Das sieht man z. B. an sprachwissenschaftlichen Texten, die Anleihen bei der Neurologie oder Evolutionsbiologie machen. Es ist schwer, eine nicht-psychologisierende Erklärung von „Einstellung“ zu finden. Typisch ist etwa folgendes Gestammel: „Man hat davon auszugehen, daß die Gehalte propositionaler Einstellungen in irgendeiner Weise im kognitiven System einer Person dargestellt sind. Kognitive Systeme enthalten demnach mentale Repräsentationen, die mögliche Sachverhalte oder Situationen darstellen und Präferenzordnungen zwischen diesen Sachverhalten herstellen. Wenn A glaubt, daß a, dann ist a in der kognitiven Struktur des A dargestellt.“ (Martin Carrier/Jürgen Mittelstraß: Geist, Gehirn, Verhalten. Das Leib-Seele-Problem und die Philosophie der Psychologie. Berlin, New York 1989:207, nach Fodor, bei dem die Repräsentation in einer „inneren Sprache“ stattfindet.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.09.2024 um 05.08 Uhr |
|
In der Dudengrammatik wird wie auch bei anderen Autoren im Umkreis der unglücklichen "Satzmodus"-Lehre behauptet, Wunsch- und Ausrufesätze seien nicht "adressatenbezogen". Nun ist Sprache aber grundsätzlich kommunikativ, also partnerbezogen. Als erklärbare Ausnahme kann es schon mal vorkommen, daß jemand einen Fluch ("Mist! Verdammt!") ausstößt, wenn er allein ist. Aber schon "Daß ich das noch erleben durfte!" sagt niemand, wenn kein Hörer da ist. Es hat eine kommunikative Funktion eigener Art. Ebenso: "Wenn nur schon Feierabend wäre!"
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.09.2024 um 04.47 Uhr |
|
"Ich rief dem Kind zu, es brauche keine Angst zu haben." Hier soll ein „abhängiger Ausrufesatz“ vorliegen. (Renate Baudusch: Zeichensetzung klipp & klar (Bertelsmann 2000:19) Aber das mit dem Ausruf steht im Obersatz, der abhängige ist ein gewöhnlicher Fall von indirekter Rede. Diesen naiven Fehler findet man sehr oft. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.06.2024 um 06.11 Uhr |
|
Zum vorigen: Gibt es im Deutschen eine Neigung, die Hauptsatzstellung der Nebensatzstellung anzugleichen? Das müßte fehlerkundlich nachzuweisen sein, aber mir ist nichts davon bekannt. Im Gegenteil: Die Verbzweitstellung (XVY, nicht SVO!) ist sehr stabil und zieht eher den Nebensatz an als umgekehrt, was man auch bei reduzierten Fähigkeiten beobachten kann. Ich glaube also nicht, daß sie ein "Übergangsstadium" ist.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.10.2023 um 03.53 Uhr |
|
„Zu den SVO-Sprachen zählt beispielsweise das Deutsche: Interessant ist, daß diese Sprache neben vielen Präpositionen auch einige wenige Postpositionen besitzt, so z. B. in dem Beispielsatz ‚Meiner Krankheit wegen war ich verhindert‘. Für den Übergangscharakter von SVO-Sprachen spricht übrigens auch die Beobachtung, daß es einem Sprecher des Deutschen durchaus gestattet ist, Sätze – genauer: Nebensätze – zu bilden, die dem SOV-Muster folgen: ‚Der Bauer tötete den Fuchs, weil dieser die Hühner bedroht hatte.‘“ (Frank Unterberg: „Verschieden und doch gleich“?, S. 21 (https://docplayer.org/7470848-Linguistik-server-essen-frank-unterberg.html) Es ist immer wieder amüsant, daß Sprachwissenschaftler Thesen aufstellen, die durch ihre eigene Form dem widersprechen, was sie behaupten. Unterbergs Sätze folgen ja nicht dem SVO-Schema. Der Fall erinnert an Rivarols berühmten Satz über das Französische. Natürlich kann eine Theorie, die dem Deutschen die gleiche Wortstellung zuschreibt wie dem Englischen und Französischen, nicht richtig sein. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.01.2023 um 08.43 Uhr |
|
„Die Entstehung der menschlichen Sprache wird ca. um 100.000 v. Chr. angesetzt.“ (Petra Maria Vogel: Sprachgeschichte. Heidelberg 2012:4) Wenn man sich auf seriöse Forscher (also keine Kreationisten) beschränkt, reichen die Schätzungen von 30.000 bis 3 Mill. Jahre. Es gibt also keine Rechtfertigung dafür, Studenten in Einführungsbüchern mit solchen Thesen zu traktieren. ("v. Chr." ist wieder mal besonders sinnig.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.10.2022 um 04.49 Uhr |
|
Ich hatte schon mal zitiert: „Der Hörer baut in der Vorstellung ein Bild vom Gegenstand auf, das für ihn abgeschlossen und im Wissen verankert ist.“ (Ludger Hoffmann in Ders., Hg.: Handbuch der deutschen Wortarten. Berlin 2007:315) Dem Germanisten fehlt jedes kritische Bewußtsein gegenüber dieser Wald-und-Wiesen-Psychologie. Chomsky hat den Linguisten das gute Gewissen gegeben, wenn sie wie in alten Zeiten, als Philosophen den Psychologie-Lehrstuhl innehatten, ihre rationale, also sprachgeleitete "Psychologie" entwerfen. Man nennt es "Wiederkehr des Geistes"... Solches Zeug füllt jetzt die Handbücher. (Übrigens: Wie verankert man ein Bild?) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.07.2022 um 17.29 Uhr |
|
Ich hatte einige Beispiele von Pseudoformalisierung zitiert, womit die Leute sich und andere betrügen. Hier ist noch ein Beispiel: CSE = f (R, COGEN, CUL) CSE = common sense experience R = reality COGEN = cognitive engine we carry with us in all of our interactions with the world CUL = the culture in which the cognizer is embedded (Alvin I. Goldman: „Naturalizing Metaphysics with the Help of Cognitive Science“. https://fas-philosophy.rutgers.edu/goldman/Goldman%20-%20Naturalizing%20Metaphysics%20w%20Cognitive%20Science%20%28Final,%209-24-13%29.pdf) NB: Der Verfasser ist nicht irgendwer! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.04.2022 um 04.18 Uhr |
|
Das von der KMK veröffentlichte „Verzeichnis grundlegender sprachwissenschaftlicher Fachausdrücke“ verbreitet eine bestimmte Doktrin und entzieht sie durch Amtlichkeit der wissenschaftlichen Diskussion. Man könnte von einer "Staatslinguistik" sprechen, analog zur Staatsorthographie. Zum Beispiel kann man dort lesen, das sprachliche Zeichen sei eine „Verbindung von Lautbild/Schriftbild und Bedeutung“. Das ist der abgestandene Strukturalismus der Saussure-Nachsprecher. Auch wenn die meisten Lehrer zustimmen dürften - sie haben ja an der Uni nichts Besseres gelernt -, ist es beschämend, einerseits durch ein langes Studium wissenschaftlich ausgebildet und andererseits auf die Verbreitung einer partikulären Doktrin verpflichtet zu sein. Von der Artistenfakultät kennt man das sonst nicht.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.03.2022 um 05.52 Uhr |
|
Wikipedia „Kongruenz“: Kongruenz ist eine Beziehung zwischen zwei Satzteilen, derart dass beide ein bestimmtes Merkmal tragen. Sie ist daher von Rektion abzugrenzen, bei der nur ein Satzteil ein Merkmal trägt und der andere Teil dieses dort verlangt. Beispiel: Das Theaterstück gefiel den Kindern sehr gut. In diesem Beispiel regiert das Verb „gefiel“ den Dativkasus an der Ergänzung „den Kindern“; da das Dativmerkmal nur an der Ergänzung, aber nicht am Verb vorliegt, ist dies ein Fall von Rektion, nicht Kongruenz. Im Innern des Dativobjekts gibt es hingegen Kongruenz in den Merkmalen Dativ und Plural: „d-en Kind-er-n“. Der Dativ wird also dem Objekt als Ganzem durch Rektion zugewiesen, durch die Kongruenzregel breitet er sich dann im Inneren auf jedes einzelne Wort aus; dies sind zwei getrennte Mechanismen. Ebenso gibt es im obigen Beispiel Kongruenz zwischen den Wörtern „das“ und „Theaterstück“, obwohl man das Merkmal, Neutrum, nur an der Artikelform „das“ sehen kann. Trotzdem trägt das Substantiv „Theaterstück“ das Merkmal Neutrum eindeutig auch selbst; daher ist auch dies ein Fall von Kongruenz, nicht Rektion. Wieso trägt des Substantiv Theaterstück das Merkmal Neutrum? Ich kann es tatsächlich weder sehen noch hören. „Eindeutig“, aber nicht wahrnehmbar? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.02.2022 um 05.58 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1044#21687 Nach zehn Jahren komme ich zufällig wieder mal an Prof. Pletts Homepage vorbei und sehe, daß sich an den "Geistesiwissenschaften" nichts geändert hat. (https://www.uni-due.de/anglistik/centre_for_rhetoric_and_renaissance_studies/plett_heinrich.shtml) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.01.2022 um 13.39 Uhr |
|
Ludger Hoffmann bringt in seinem „Reader Sprachwissenschaft“ (de Gruyter, mehrere Auflagen, auch herunterladbar) Texte seiner Freunde Ehlich, Rehbein und Redder sowie von sich selbst unter. Sie stehen als „klassische Texte“ (Hoffmann) neben Paul, Trubetzkoj, Bloomfield, Wittgenstein... Über Geschmack kann man streiten.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.12.2021 um 06.22 Uhr |
|
„Apprehension, das sprachliche Erfassen der Gegenstände“ – dieses Projekt von Hansjakob Seilers Kölner Schule der Sprachtypologie hat kaum Nachfolge gefunden. Niemand verwendet den Begriff. Die drei Sammelbände, Buchbindersynthesen, verstauben irgendwo (auch bei mir). Der Titel verrät die alte Vorstellung, daß der Mensch mit Worten gleichsam in die Welt ausgreift. Naturalistisch gesehen ist es beinahe umgekehrt: Der Mensch reagiert (auch) durch sein Sprachverhalten auf die Welt. Wie das geschieht, ist jeweils durch die Geschichte (Kultur) mitbestimmt. Dort sind die Ursprünge der Modelle oder Konstrukte zu suchen, mit deren Hilfe die Menschen ihr Zusammenleben koordinieren. |
Kommentar von , verfaßt am 02.12.2021 um 04.56 Uhr |
|
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.08.2021 um 09.39 Uhr |
|
In der gedruckten Ausgabe der SZ führt Titus Arnu klickeradoms auf Erika Fuchs zurück (statt auf Wilhelm Busch) und hält es außerdem für ein Beispiel des "Erikativs". In der Online-Ausgabe sind die beiden Irrtümer korrigiert, aber die Bereicherung des Deutschen soll immer noch "der" Verdienst von Frau Fuchs sein.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.05.2021 um 07.10 Uhr |
|
Sprache ist kein Code. Wenn man Sprache als Code, Sprechen als Kodieren bezeichnet, macht man eine Anleihe an der technischen Fachsprache und könnte damit suggerieren, eine genauere Einsicht in das Wesen der Sprache zu haben: „Sprechen besteht im Verschlüsseln von Informationen nach einem bestimmten Code.“ (Eugen Hill: Einführung in die historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Darmstadt 2013:27) „Die Konstruktion mit STEHEN zeigt dabei eine parallele Entwicklung wie die von lat. STARE, einem ursprünglich eine Körperhaltung kodierenden Verb, das zur Kopula im Altromanischen wurde und in die Domäne der ursprünglichen Kopula ESSERE eindrang.“ (Rosemarie Lühr) Das ist aber nicht der technische Sinn: "Ein Code oder Kode (...) ist eine Abbildungsvorschrift, die jedem Zeichen eines Zeichenvorrats (Urbildmenge) eindeutig ein Zeichen oder eine Zeichenfolge aus einem möglicherweise anderen Zeichenvorrat (Bildmenge) zuordnet. Beispielsweise stellt der Morsecode eine Beziehung zwischen Buchstaben und einer Abfolge kurzer und langer Tonsignale (und umgekehrt) her." (Wikipedia) Die laxe Redeweise außerhalb der Informationstechnik führt zu fehlerhaften Modellen: „Neben die ´Codierungsprozesse´ des Sprechers und Schreibers treten – informations- und kommunikationstheoretisch gesprochen – die ´Decodierungsprozesse´ des Hörers und Lesers als spezifische Aktivitäten der Person. (Friedrich Kainz in Luchsinger/Arnold 2. Aufl. 274) Kainz greift der wirklichen Einsicht vor, wenn er impliziert, wir könnten Sprechen und Verstehen in diesen technischen Begriffen analysieren, womit übrigens zusätzlich das hochproblematische Postulat einer Gedankensprache verbunden wäre, aus der und in die übersetzt wird. Verräterisch ist schon die seltsame Ausdrucksweise: „Codierungsprozesse des Sprechers“ usw., und diese Prozesse sollen zugleich „Aktivitäten der Person“ sein. Die Anführungszeichen machen das Ganze erst recht unverständlich. Daher der Einwand: A code is a system of encrypting conventions parasitic on language. A code is not a language. It has neither a grammar nor a lexicon (cf. Morse code). Knowledge is not encoded in books, unless they are written in code. One can encode a message only if there is a code in which to do so. There is a code only if encoders and intended decoders agree on encoding conventions. In this sense there isn´t, and couldn´t be, a neural code. In the sense in which a book contains information, the brain contains none. In the sense in which a human being possesses information, the brain possesses none. That information can be derived from features of the brain (as dendrochronological information can be derived from a tree trunk) does not show that information is encoded in the brain (any more than it is in the tree trunk). (Bennett/Hacker) Wenn eine Sprachwissenschaftlerin also sagt, bestimmte Verben kodierten eine Körperhaltung, so kann das nur als Irreführung bezeichnet werden. Noch deutlicher wird dies in anderen Bereichen des Wortschatzes, die sich der traditionellen Namentheorie der Sprache stärker widersetzen. Wenn jemand sagt trotz seiner Leichtfertigkeit, dann ist weder die Leichtfertigkeit ein Gegenstand, dem man ein Zeichen zuordnen könnte, noch läßt sich ein Gegenstand auffinden, dem die Präposition trotz zuzuordnen wäre. Von der „Sprache als Code“ bleibt nicht viel übrig. Ein Ausweg besteht darin, nicht die Gegenstände, sondern die „Begriffe“ als die Korrelate aufzufassen, denen die Sprachzeichen zuzuorden sind. Viele verstehen unter Begriffen offen oder versteckt die Zeichen einer zweiten Sprache, der „Sprache des Geistes“. Damit sind die bekannten Probleme verbunden, die meist unter „Language of thought“ abgehandelt werden. Sie sind unlösbar, und die ganze LOT-Hypothese ist aus naturalistischer Sicht auch vollkommen überflüssig. Ich erwähne hier nur den infiniten Regreß, in den man gerät, weil die hypothetische Geistessprache ja die gleichen semiotischen Probleme aufwirft wie die beobachtbare Menschensprache. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.05.2021 um 17.46 Uhr |
|
„Bei Konjunktionen, die eine Sinnrichtung (z. B. kausal, temporal) ausdrücken, steht weiterhin das Komma: Die Maus springt in ihr Loch, denn sie möchte nicht gefangen werden. Sie schafft es gerade noch, aber der Kater lauert nun davor.“ (Duden Newsletter) "Sinnrichtung" scheint aus gewissen Schulgrammatiken (Latein) zu kommen, ist in der Linguistik nicht üblich und im Duden nicht verzeichnet, auch nicht im KMK-Verzeichnis sprachwissenschaftlicher Fachausdrücke. Ich finde auch außer den Beispielen keine Definition, erst recht keine für Schüler. Kennt es jemand aus seiner Schulzeit? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.11.2020 um 17.36 Uhr |
|
Die Generativisten haben nach Chomskys Vorbild behauptet, manche grammatischen Konstruktionen kämen im "Input" zu selten vor, als daß Kinder sie daraus entnehmen und sich aneignen können. (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1044#31247) Pullum, Sampson und andere haben durch Analysen entsprechender Corpora gezeigt, daß das nicht zutrifft, z. B. bestimmte Fragesätze massenhaft vorkommen. Chomsky hat sich allerdings weder für Corpora noch für empirische Kindersprachforschung je interessiert. Er glaubte ja aufgrund seiner rationalistischen Philosophie immer schon zu wissen, wie es sein muß und folglich ist. Ebenso wichtig: Geoffrey Sampson erinnert daran, daß Kinder auch neue Wörter nach einmaligem Vorkommen behalten und richtig verwenden; warum also sollte bei grammatischen Konstruktionen eine lange Reihe ähnlicher Fälle erforderlich sein? Bestimmte Fragesatzformen brauchen nur einmal vorzukommen, um sich einzuprägen (one-trial-learning). Der Rest ist Übung. Ich kann die Richtigkeit dieser Beobachtung gerade wieder bei meiner dreijährigen Enkelin bestätigen. |
Kommentar von Ivan Panchenko, verfaßt am 20.03.2020 um 21.09 Uhr |
|
Zu #29200 („Inflektiv“*): Die Zusammenschreibung in Fällen wie blödseiundgeradeaufgestandensei ist doch nur eine Konvention, man könnte auch *blöd sei und gerade aufgestanden sei* schreiben, das ist vergleichbar mit Vermerken der Art (lacht), wie sie in Drehbüchern oder Interviewniederschriften verwendet werden können (die Verbform ist halt eine andere). Mit polysynthetischem Sprachbau hat das herzlich wenig zu tun. * Zu erwarten wäre nach dem lateinischen PPP-Stamm eigentlich Inflexiv, man nennt Flexionsmorpheme ja auch Flexive. Ähnliche Abweichungen sind reflektiv und Konnektiv, andererseits heißt es konnexive Logik. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.03.2020 um 15.50 Uhr |
|
Ich rücke mal eine ältere Rezension hier ein, die zuerst in "Fachsprache" und dann bei Amazon erschienen ist, aber auch die Rechtschreibreform und besonders Augsts Etymogeleien betrifft: Gerd Antos: Laien-Linguistik. Studien zu Sprach- und Kommunikationsproblemen im Alltag. Am Beispiel von Sprachratgebern und Kommunikationstrainings. Tübingen: Niemeyer 1996 (Reihe Germanistische Linguistik; 146) 395 Seiten. Unter „Laien-Linguistik“ versteht der Autor die sprachberatende und über Sprache belehrende Sachschriftstellerei, soweit sie nicht von berufsmäßigen (in der Regel akademischen) Sprachwissenschaftlern ausgeübt wird. Daneben wird aber auch das ohne solchen publizistischen Ehrgeiz auskommende „alltagsweltliche Verständnis von Sprache und Kommunikation“ thematisiert. Das Interesse an Rat und Belehrung wird u. a. auf die Erfahrung von Lücken und Fehlern in der eigenen Sprachbeherrschung zurückgeführt. Die Laien legen sich zur Bewältigung dieser Probleme bestimmte „Alltagstheorien“ über Sprache und Kommunikation zurecht. Existenzweise, Inhalt und kognitiver Rang dieses Alltagswissens beanspruchen sogar mehr und mehr das Hauptinteresse des Verfassers, so daß - entgegen der vom Titel geweckten Erwartung - nur etwa ein Fünftel des Buches von Sprachratgebern und Kommunikationstrainings handelt, die im Anhang durch die Wiedergabe der Inhaltsverzeichnisse praktischer Stillehren und das Protokoll eines Kommunikationstrainings repräsentiert sind. Unter diesem breiten Dach bringt der Verfasser eine große Fülle von Gegenständen zur Sprache: Stilratgeber, Gebrauchsgrammatiken, Wörterbücher, Briefsteller, Volksetymologie, Rechtschreibreform, feministische Linguistik, den native speaker, die Metapherntheorie, die linguistische Arbeitsteilung, die Prototypensemantik und vieles andere. Da es nicht möglich ist, all dies hier zu referieren, seien zur näheren Charakterisierung des Werkes die Abschnitte über die Volksetymologie und über die Metapherntheorie herausgegriffen. Der Verfasser selbst ist der Ansicht, „das Verhältnis von Experten und Laien in der Sprachwissenschaft (lasse) sich wohl nirgendwo besser studieren als anhand der sogenannten Volksetymologie“. Die Volksetymologie oder „Sekundärmotivation“ besteht bekanntlich darin, ein fremdes oder undurchsichtig gewordenes Wort durch Anschluß an ein bekanntes (wieder) durchsichtig zu machen; manchmal führt dieser Anschluß zu seiner formalen Umgestaltung (Hängematte). Man kann darin mit Gerhard Augst eine „synchrone etymologische Kompetenz“ am Werke sehen, die sich allerdings ebensogut als Inkompetenz bezeichnen läßt. Die wissenschaftliche Etymologie sieht in der Volksetymologie längst keine Konkurrentin und auch kein „Ärgernis“ (S. 217) mehr, sondern betrachtet den volksetymologischen Prozeß recht gelassen als ein zwar grundsätzlich irriges, aber zweifellos interessantes Verhalten. Der Verfasser versucht nun auf eine schwer greifbare Weise, die Volksetymologie irgendwie zu „rehabilitieren“, selbstverständlich ohne sich zu der These zu versteigen, sie sei eine ernstzunehmende Alternative zur wissenschaftlichen Etymologie. In seinem Bemühen, die Volksetymologie aufzuwerten, stellt er aber die wissenschaftliche Etymologie als Geschichte ihrer Irrtümer dar, was denn doch ein wenig übertrieben zu sein scheint. Er weiß im übrigen selbst, daß die Falsifikation einer sprachgeschichtlichen Hypothese etwas grundsätzlich anderes ist als die von vornherein prinzipienlose volksetymologische Spekulation. - Eine „Rehabilitierung der Volksetymologie in der neueren Linguistik“ (S. 229) gibt es m. E. nicht, denn die verstärkte Beschäftigung mit dem Gegenstand ist keine Rehabilitation - es sei denn, man wollte gerade die verstörendsten Fehler der jüngsten Rechtschreibreform, mit der sich Antos im nächsten Kapitel beschäftigt, als solchen Rehabilitationsversuch ansehen, der dann freilich als gründlich mißlungen zu beurteilen wäre. Von einem „radikalen Perspektivenwechsel“ (durch Augst) kann also nur in einem höchst zweideutigen Sinn die Rede sein; der Verfasser begnügt sich denn auch mit der abschließenden Bemerkung, ein solcher Perspektivenwechsel werfe mehr Fragen auf, als er beantworte. Dasselbe könnte man über die breit referierte Ansicht sagen, unser wissenschaftliches Denken werden in grundsätzlich gleicher Weise von „Metaphern“ gelenkt wie das Alltagsdenken. Schon die Grundlagen dieser am Beispiel der Sprache selbst illustrierten These, die bekanntlich von George Lakoff mit zunächst aufsehenerregendem Erfolg wiederbelebt wurde, sind fragwürdig: Wenn wir das Sprechen in Analogie zu Kampf, Nahrungsaufnahme, Bauen, Spinnen/Weben, Zeichnen/Malen, Musik, Pflanzen, Wetter, Gewässer, Bewegung im Raum „konzeptualisieren“, dann heben sich diese Metaphernbereiche offenbar gegenseitig auf, und die Behauptung von der theorieähnlichen Leistung der Metaphorik erweist sich als haltlos. Dies bemerkt der Verfasser ebensowenig, wie er sich um den Nachweis bemüht, daß die „Dialogmetapher“ in der Computerwissenschaft überhaupt eine Metapher, der Mensch im Gegensatz zum Computer also keine Maschine sei. Das Buch besteht aus zahllosen kurzen Abschnitten, in denen ebenso viele Gegenstände angerissen werden. Der Verfasser referiert in großer Ausführlichkeit die Ansichten anderer, oft wenig bedeutender Autoren und verweist ohne kritische Sichtung auf weitere Quellen, so daß der Leser bald die Orientierung verliert. Hinzu kommt, daß verhältnismäßig einfache Sachverhalte in eine unnötig komplizierte Sprache gekleidet werden, etwa so: „Schreiber sind im Deutschen mit sprachstrukturell wenig salienten Distinktionen zwischen oppositionellen Registern konfrontiert.“ (S. 59) Hier hätte ein wenig laienlinguistische Schlichtheit gutgetan. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.03.2020 um 08.47 Uhr |
|
In dem genannten Lexion "Deutsche Morphologie" gibt es wieder Beispiele der schon oft kritisierten Praxis: Das Kapitel "Genus Verbi" handelt nicht vom Deutschen, sondern von: Tuvan, Russisch, Norwegisch, Türkisch, Niederländisch, Polnisch, Tschuktschisch, Chinesisch, Latein, Altgriechisch, Thai. Das Ganze ist nur Angeberei, da die Verfasserin keine dieser Sprachen beherrscht und alle Beispiele und Erklärungen aus zweiter Hand bezieht. Sie kann also nicht beurteilen, was sie da zitiert, und weiß im Grunde nicht, wovon sie redet. – Es ist nicht zu erkennen, was das Kapitel in einem Buch über deutsche Morphologie zu tun hat. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.02.2020 um 17.36 Uhr |
|
Trost definiert die obliquen Kasus als die verbregierten (25), kurz zuvor spricht er von kopularegierten Prädikativa (18), also ist der Nominativ auch verbregiert. Schwache Substantive sollen nur Menschen und Tiere bezeichnen (27), vgl. aber Hydrant usw., Graph. Steht eigentlich in jeder Schulgrammatik. In Monoflexion gebraucht er mono- ganz anders als in monoattributiv usw., nämlich im herkömmlichen Sinn. (monoattributiv und monoprädikativ werden nur von ihrem Erfinder Trost verwendet. Er fährt überhaupt Zeile für Zeile schwerstes terminologisches Geschütz auf, um banale und oft falsche Dinge vorzutragen. Liest ja eh niemand.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.02.2020 um 17.15 Uhr |
|
In demselben Buch liest man. Sämtliche Substantive können ihrer Gegenständlichkeit bzw. Nicht-Gegenständlichkeit nach in Konkreta (Sg. Konkretum) und Abstrakta (Sg. Abstraktum) eingeteilt werden. Abstrakta bezeichnen Gedachtes, Vorstellungen und Konzepte und sind als solche in der Regel nicht zählbar, existieren deshalb nur im Singular (Singularetantum, Pl. Singulariatantum). (S. 392, von Rüdiger Harnisch) Über Metaphysik kann man lange streiten, aber wie steht es zum Beispiel mit den „Vorstellungen“ und „Konzepten“, die Harnisch gerade erwähnt hat? Sind diese Substantive konkret und haben sie deshalb den Plural und sind zählbar? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.02.2020 um 11.11 Uhr |
|
Im Lexikon "Deutsche Morphologie" von Hentschel/Vogel, das ich schon wegen seines naiven Beitrags über den Absentiv erwähnt habe, heißt es über das Adjektiv: „Die Wortart Adjektiv bezeichnet qualitative (das große Haus), quantitative (zwei Häuser), relationale (das elterliche Haus) und zuständliche (das Haus ist ihm egal) Merkmale eines Bezugsnomens.“ Erstens sind das keine Merkmale des Bezugsnomens, sondern allenfalls solche des Gegenstandes, den das Nomen bezeichnet. Zweitens ist es kein Merkmal des Gegenstandes, wenn er jemandem egal ist, sondern dies ist ein Ausdruck für die Gleichgültigkeit des Betreffenden gegenüber dem Gegenstand. Aber was kann man erwarten, wenn der Beitrag über das Adjektiv von Igor Trost ist! Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=941 (Auch „monoattributiv/monoprädikativ“ sind natürlich übernommen.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.11.2019 um 10.36 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1044#41695 “According to some researchers, hominids prior to Homo sapiens could not, for instance, produce the vowel i {ee}. But ultimately, this does not say very much, since by all accounts, et es perfectle pesseble to have a thoroughle respectable language wethout the vowel i.” (Guy Deutscher: The Unfolding of Language) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.08.2019 um 05.06 Uhr |
|
Was aus der „Optimalitätstheorie“ geworden ist, weiß ich nicht, da mich die rasch wechselnden Theorie-Moden schon lange nicht mehr interessieren. Näheres hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Optimalitätstheorie Unter 10 hoch 1408 möglichen Grammatiken wählen zu müssen war noch nie mein Problem. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.06.2019 um 12.43 Uhr |
|
In Lehrbüchern anderer Fachgebiete ist aus sachlichen Gründen manchmal ein Kapitel über Sprache notwendig, zum Beipiel in der Psychologie. Da findet man dann die ganze Folklore: - Sprache ist rund 100.000 Jahre alt. - Die Anatomie des Kehlkopfes mußte sich erst so weit entwickelt haben, daß die heutige Artikulation möglich wurde. - Chomskys These von der angeborenen Universalgrammatik ist zwar nicht zweifelfrei bewiesen, aber „weithin akzeptiert“. Alles haltlos, aber es wird weitergereicht. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 26.05.2019 um 01.28 Uhr |
|
Das bedeutet m. E. aber auch, daß trotz der materiellen Grundlagen der Konditionierung und ihrer Geschichte, trotz Beobachtbarkeit usw., die so von Skinner definierte Zeichenbedeutung ebenfalls eine ideelle Seite des Zeichens ist.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 25.05.2019 um 23.29 Uhr |
|
Geschichte (wovon auch immer) ist schwerlich etwas Stoffliches, Materielles. Deshalb ergibt das Zitat von Skinner für mich nur Sinn, wenn ich physical anstatt mit physisch (materiell, stofflich, körperlich) doch besser mit physikalisch (die Physik betreffend, auch verträglich mit materialistisch, natürlich, beobachtbar) übersetze.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.05.2019 um 09.12 Uhr |
|
Eine kurze Diskussion über den Begriff "physical" (physisch, materiell) findet sich auch, wie ich gerade sehe, in der Einleitung von Bunge/Mahner: "Über die Natur der Dinge". Die beiden Autoren bevorzugen "materialistisch" usw., um der Verpflichtung auf den Physikalismus der Positivsten zu entgehen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.05.2019 um 06.57 Uhr |
|
Über den Ausdruck "physical" in diesem Zusammenhang hatten wir schon gesprochen. Es bedeutet einfach materiell und beobachtbar, im Gegensatz zu der "wunderbaren" geistigen Seite. Also kein Physikalismus (der aber auch nicht ausgeschlossen ist). Zwischen der naturalistischen Sicht und der empiristischen (hier behavioristischen) besteht kein logischer Widerspruch, sondern es handelt sich um inkompatible Begrifflichkeiten, und es wird behauptet, daß die empiristische die weiterführende ist. Wir beobachten, wie Zeichen entstehen, und können damit etwas erklären und in die biologische und auch sozialen Wissenschaften einbetten, was sonst unbegreiflich und nicht "anschlußfähig" bliebe. Diese These wird aber erst überzeugend, wenn man den Wust von vergeblichen mentalistischen Ansätzen Revue passieren läßt: Ideenlehre, Universalienstreit, "mentale Repräsentation" usw. (und eben "bilateraler Zeichenbegriff"). |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 24.05.2019 um 23.13 Uhr |
|
Ja schon, ich habe das auch schon oft gelesen, und ich verstehe Bedeutung sowieso immer historisch. Natürlich etabliert und verändert sie sich nur mit der Zeit. Das ist ja wohl auch unumstritten. Entspricht das nicht dem Skinnerschen Gedanken einer Konditionierungsgeschichte? Aber gut, wie auch immer, ich sagte ja schon, daß ich gewillt bin, Bedeutung ganz im Skinnerschen Sinne zu verstehen. Wieso widerspricht das dann immer noch dem bilateralen Zeichenbegriff? Nochmal: eine Seite: physischer Zeichenkörper (Formseite) and. Seite: Bedeutung=Konditionierungsgeschichte Warum Skinner meint, die Geschichte sei physisch, leuchtet mir allerdings nicht ein. Geschichte ist doch ein zeitlicher Vorgang, eine Aneinanderreihung von Augenblicken, die nur einzeln nacheinander existieren. Im Zusammenhang existiert die Konditionierungsgeschichte m. E. nur als Idee. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.05.2019 um 17.15 Uhr |
|
Es freut mich ja, daß Sie die behavioristische Sicht als völlig natürlich ansehen, aber begrifflich liegen eben doch Welten zwischen dieser und der "wunderbaren" Auffassung des Zeichens. Ein einschlägiges Skinner-Zitat habe ich schon dreimal gebracht, verweise nur noch einmal kurz darauf: „Meaning or content is not a current property of a speaker´s behavior. It is a surrogate of the history of reinforcement which has led to the occurrence of that behavior, and that history is physical.“ http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584 (dort der größere Zusammenhang) und http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1341#18483 Entsprechend geht die Erforschung der Bedeutung ganz verschiedene Wege. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 24.05.2019 um 17.03 Uhr |
|
Dann hätten wir also zum Zeichen 1. den Zeichenkörper 2. die Geschichte seiner Semantisierung. Sind das nicht auch zwei Seiten, bilateral? Was sollte die "geheimnisvolle" Bedeutung schon anderes sein als die Semantisierungsgeschichte? Sind das nicht auch nur zwei Ausdrücke für das gleiche Ding? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.05.2019 um 16.04 Uhr |
|
Homonymie und Synonymie (im üblichen Sinne, nicht in meinem) sind die beiden bekannten Anomalien, also die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Wenn ich das bilaterale Zeichenmodell kritisiere, dann nicht deshalb, weil ich bestritte, daß Zeichen Bedeutung haben oder etwas bedeuten. Ich spreche mich nur für einer weniger mystische, rationalere Modellbildung aus (wie anderswo dargelegt: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584). An die Stelle der geheimnisvollen (geistigen?) Rückseite des Zeichens tritt die Geschichte seiner Semantisierung, damit wird der Sachverhalt empirisch erforschbar, während über die "Bedeutung" Philosophen seit Jahrtausenden unergründlich spekuliert haben und sich bis heute nicht einigen konnten; es bleibt „eines der tiefsten Probleme der gegenwärtigen Philosophie“ und ein "Wunder" (Hans Lenk). |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 24.05.2019 um 12.15 Uhr |
|
Man muß beim bilateralen Modell genau sagen, was man mit zwei gleichen oder verschiedenen Zeichen meint. Sind sie nur dann gleich, wenn sie sowohl im Zeichenkörper (Form) als auch in der Bedeutung übereinstimmen, oder spricht man ggf. von gleichen Zeichen(körpern) mit unterschiedlicher Bedeutung, oder von gleichen Zeichen(bedeutungen) mit unterschiedlichem Zeichenkörper? Zumindest in meiner Zusammenfassung (letzter Beitrag) habe ich es genau formuliert. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 24.05.2019 um 11.00 Uhr |
|
#22004: H. Weinrich: "Ein Zeichen muß vor allen Dingen von anderen Zeichen verschieden sein." T. Ickler: "Verschiedenheit ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Zeichen." Nehmen wir das Verkehrszeichen "Parkverbot". Früher war es einmal ein einfach rot durchgestrichenes weißes P auf blauem Grund, heute ist es nur ein einfach rot durchgestrichener blauer Grund. (Unterschied zum Halteverbot: kreuzweise durchgestrichen) Noch lange Zeit, nachdem das neue Zeichen eingeführt worden war, konnte man auch das alte Zeichen noch sehen. Es existieren also durchaus unterschiedliche Zeichen mit gleicher Bedeutung. Was ist dabei? Nach meinem Verständnis ist Verschiedenheit nicht notwendig für die Zeichenform. Was allerdings m. E. unbedingt verschieden sein muß, zumindest im gleichen Themenbereich (Domäne oder wie man das auch nennen will), ist die Bedeutung. Ein und dasselbe Zeichen kann nicht sowohl Parken erlaubt als auch verboten bedeuten. Wo es nicht mit Verkehrszeichen verwechselt werden kann, könnte jedoch ein Zeichen auch eine andere Bedeutung haben, aber das würde ich dann nicht mehr als das gleiche Zeichen, sondern sowieso als ein anderes betrachten. Zusammengefaßt: Gleiche Zeichenform impliziert gleiche Bedeutung, aber auf ein und dieselbe Bedeutung können zwei unterschiedliche Zeichenformen verweisen. Kann man denn nicht die genannten trivialen Fehler früherer Wissenschaftler korrigieren, ohne gleich das ganze bilaterale Modell zu verwerfen? ––––––––––––––– zu #41546: "Die Wörter werden nicht aus Phonemen aufgebaut, sondern lassen sich auf Phoneme abbilden" Zugegeben, ich bin nur Laie, aber ich hoffe, ich rede nicht nur dummes Zeug. Wenn doch, schonen Sie mich bitte nicht. Dieser Satz hier klingt mir gar zu gelehrt. Was ist der Unterschied? Sind das nicht einfach nur zwei verschiedene Redeweisen für die gleiche Sache, je nach der Perspektive, die man einnimmt? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.05.2019 um 05.03 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1044#40974 Die Äußerungen des zweijährigen Kindes sind noch verwaschen, nicht auf das Phonemsystem der Erwachsenen abbildbar, folgen aber auch keinem erkennbaren eigenen System. (Schwierige Wörter wie Milch klingen nichttranskribierbar wie Vogelzwitschern.) Ihre Stilisierung schreitet fort, bis das Phonemsystem genügt, um alle Wörter voneinander zu unterscheiden. Ich beobachte keinen Bruch im Sinne Jakobsons mit phonematischem Neuanfang. Die Wörter werden nicht aus Phonemen aufgebaut, sondern lassen sich auf Phoneme abbilden, die man von außen an sie heranträgt wie einen Raster an eine Abbildung: um sie zu erfassen bzw. zu simulieren, nicht um sie zu erzeugen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.03.2019 um 16.25 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1044#22004 Gibt es Phoneme? Phoneme sind durch Minimalpaare definiert. Damit sind sie auf den Grundsatz der Unterscheidbarkeit festgelegt. Man könnte die etwa 40 Phoneme des Deutschen durchnumerieren und dann alle deutschen Morpheme aus den entsprechenden Nummern (Ziffern) aufbauen. Diese Sprache wäre strukturell mit dem Deutschen identisch, es wäre Deutsch in jedem (struktural-)linguistisch relevanten Sinn. Das wirklich gesprochene Deutsche ließe sich Punkt für Punkt auf die Kunstsprache abbilden. Als Strukturalist würde man sagen, es gehe dabei nichts verloren. Man hat ja oft bemerkt, daß der Strukturalist sich eigentlich gar nicht um die „Substanz“, hier also die tatsächliche Artikulation kümmern dürfe. Schon die Analyse in „distinctive features“ (Jakobson) war ein Sündenfall. In einem umfassenderen, realistischen Sinn wäre es kein Deutsch und die Ähnlichkeit mit dem Deutschen nur ein Artefakt. (Niemand würde diese „Sprache“ verstehen.) In Wirklichkeit hat man die tatsächlich bestehenden Diskontinutitäten der Artikulation nur so weit analysiert, daß weitere Unterscheidungen nichts mehr bringen würden, d.h. sie würden nichts mehr zur Unterscheidung der Morpheme beitragen (Allomorphe, freie Varianten, Koartikulationen...). Das Ganze bleibt aber von den Grundannahmen abhängig, die schon den Bau der Kunstsprache geleitet haben. Als objektive Tatsache und Merkmal des Deutschen bleibt also am Ende, daß man nicht mehr als 40 Unterscheidungen braucht, um jedes Morphem von jedem anderen zu unterscheiden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.09.2018 um 05.07 Uhr |
|
Natürlich haben Lateinkundige, statistisch gesehen, auch im Deutschen eine standardsprachlich korrektere Ausdrucksweise. Das liegt aber nicht am Latein, sondern an der Herkunft, heute mehr als früher. Ich bin als Referendar in Berlin an vielen Gymnasien herumgekommen und konnte mit meiner Stammschule (Gymnasium Steglitz) vergleichen. Hier in Erlangen sehe ich auch, wer seine Kinder aufs humanistische Gymnasium Fridericianum schickt. Müller-Wetzel behauptet, nach seinem Lateinkurs seien die Studenten in Jena fähig, Cicero zu lesen. Das muß man wohl cum grano salis verstehen. (Und: Lesen sie denn dann auch Cicero?) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.09.2018 um 16.46 Uhr |
|
Werner Lehfeldt, Martin Müller-Wetzel: Abenteuer Schriftdeutsch. Sechs Grammatikfehler: wie sie das Lesen behindern, wie man sie vermeidet. Ein intensiv kommentiertes Sündenregister aus der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Der Slawist Werner Lehfeldt hat in seiner Abonnements-Zeitung FAZ immer wieder Fehler gefunden und sie mit wachsendem Eifer gesammelt. Er sandte der Zeitung ein „Sündenregister“ zu und war enttäuscht, weil sich die Grammatikfehler der Zeitung daraufhin nicht vermindert, sondern im Gegenteil noch vermehrt haben. Auch Verlage und einzelne Autoren hat er mit solchen Zusendungen traktiert. Man kennt ja die lästigen Zeitgenossen, die es fertigbringen, anderen Leuten sprachlich und orthographisch am Zeug zu flicken. Lehfeldt spricht denn auch immer wieder von „Sünden“, vom „Sündenregister“ usw., wie in der alten Besserwisserliteratur. Seltsamerweise beschränkt er sich auf nur sechs Fehler: 1. Fehlerhafte Konstruktion von Appositionen 2. Fehlerhafte Kasusrektion von Präpositionen, Verben und Adjektiven 3. Fehlerhafter Modusgebrauch 4. Fehlerhafter Tempusgebrauch 5. Fehlerhafte Bindestrichschreibung von Determinativkomposita 6.Fehlerhafte Zerstückelung von komplexen Satzgefügen Erstaunlich ist die Behauptung des Vorworts, es gebe keine Bücher, wo man etwas über solche grammatischen Fehler und ihre Vermeidung nachlesen könne. Es gibt sie wie Sand am Meer. Sein Mitautor, der Lateinlehrer Martin Müller-Wetzel, schreibt: „Ganz erstaunlich finde ich: Fehler, wie ich sie oben aufgezählt habe, die findet man weniger in Texten von Leuten mit Latein. Wenn Sie Ihrem Kind etwas Gutes tun wollen, dann lassen Sie es Latein lernen! (Lateiner wissen auch, wie der Duden funktioniert.) Es ist ganz erstaunlich: Bei einer Examensarbeit können Sie am Deutsch sehen, und zwar ziemlich sicher, ob der Verfasser Latein gelernt hat oder nicht. Lateiner sind da im Vorteil.“ (13) Das ist gar nicht erstaunlich. Die Verfasser haben nämlich für das Deutsche Regeln aufgestellt, die am Lateinischen orientiert sind, und danach bestimmen sie dann, was ein Fehler ist – also eigentlich Lateinfehler im Deutschen. Das zeigt gleich der erste der sechs Fehlertypen: nichtkongruierende Apposition. Eine Apposition müsse in demselben Kasus stehen wie das Nomen, auf das sie sich bezieht. (18 u.ö.) Woher haben sie diese Regel? Aus der Beobachtung des Deutschen kann sie nicht stammen, dort hat sie nie gegolten. Die Verfasser gehen auch nicht so vor, daß sie zuerst den deutschen Sprachgebrauch beobachten und daraus Regeln abstrahieren, sondern tragen die Regel von außen an den Sprachgebrauch heran, eben aus der lateinischen Schulgrammatik. Über dieses bornierte Verfahren hat sich schon Eduard Engel lustig gemacht. Von den Duden-Bänden ziehen sie nur die Rechtschreibung heran und wollen daraus auch die grammatischen Regeln ableiten, im Falle der Apposition also aus den Beispielsätzen (!) zum Komma und ähnlichen beiläufigen Vorkommen. Daß sie die großen Grammatiken des Deutschen, vor allem die historischen, herangezogen hätten, ist nicht erkennbar. Offen zirkelhaft wird es, wenn Müller-Wetzel die nichtkongruierende Apposition zur „Pseudoapposition“ erklärt. (96 u. ö.) Auf die anderen Kapitel gehe ich nicht ein, sie sind ähnlicher Art. Viel Mühe verwendet er darauf, sich mögliche Mißverständnisse auszudenken, denen der Leser durch eine falsche Kasusverwendung ausgesetzt sein könnte – meistens ziemlich abwegig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.09.2018 um 04.02 Uhr |
|
Scientific linguistics has a long history, but two distinct stages—the comparative and the structural—can be recognized in its modern development. The first begins with J. J. Rousseau’s Essai sur l’origine des langues (published posthumously, 1817) and was given its greatest impetus by the rediscovery in the West of Sanskrit in the early nineteenth century. The importance of the latter was to suggest a common origin and an earlier common structure at least for Indo-European languages, and also to draw attention to the details of the evolution of these languages from earlier forms. But comparative and evolutionary (diachronic) studies remained fragmentary in the absence of a systematic theory of language as a synchronic entity. Ferdinand de Saussure, in his courses in Paris and Geneva, put forward and developed the view that a language, as actually spoken by a linguistic community at a given time (i.e., viewed synchronically), forms a self-contained system, each element of which has its place and its own relations (grammatical, etymological, etc.) to the other elements. (http://xtf.lib.virginia.edu/xtf/view?docId=DicHist/uvaGenText/tei/DicHist4.xml;chunk.id=dv4-42) Das ist eine seltsame Darstellung. Sie übergeht, daß die Sprachwissenschaft 2000 Jahre lang als synchronische existierte, bevor die historisch-vergleichende entwickelt wurde, wobei Rousseau keine Rolle spielte; sein Essay handelt ja auch vom Ursprung der Sprache, was die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft kaum berührt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.08.2018 um 16.25 Uhr |
|
Dean Falk: Wie die Menschheit zur Sprache fand. München 2010. In typischer Weise wird ein kleiner Einfall zum Zentrum des Ganzen gemacht: menschliche Säuglinge können sich nicht mehr im Fell der Mutter festhalten; die Mutter legt das Kind ab, um die Hände freizubekommen; das Kind muß aber getröstet werden, Sprache entsteht. (Also im Grunde eine Variante von „social grooming“ wie bei Robin Dunbar u.a.) Weil dieser Gedanke aber nicht ein ganzes Buch trägt, wird eine Menge von mehr oder weniger bekanntem paläontologischen, ethnographischen und anatomisch-psychologischen Material ausgebreitet. Auch Spiegelneuronen, FOXP2 usw. fehlen nicht. Ammensprache, Wiegenlieder, Kniereiterspiele sind gut für das Kind, das ist nicht neu, man liest es aber gern noch einmal. Insgesamt kein schlechtes Buch, aber der Anspruch ist doch wohl etwas zu hoch gesteckt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.07.2018 um 03.48 Uhr |
|
The minimalist program seeks to show that everything that has been accounted for in terms of [deep and surface structure] has been misdescribed … that means the projection principle, binding theory, Case theory, the chain condition, and so on. (Chomsky, New Horizons ... 2000:10). We share the bemusement of Lappin, Levine, and Johnson who write, “What is altogether mysterious from a purely scientific point of view is the rapidity with which a substantial number of investigators, who had significant research commitments in the Government-Binding framework, have abandoned that framework and much of its conceptual inventory, virtually overnight. In its place they have adopted an approach which, as far as we can tell, is in no way superior with respect to either predictive capabilities or explanatory power”. (Pinker/Jackendoff) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.07.2018 um 15.23 Uhr |
|
Klaus Deterding: „Wer oder was ist schief gelaufen?“: Fehler, Jargon und falsche Grammatik im schriftlichen und mündlichen Gegenwartsdeutsch. 2018 (Werbetext:) In Fortführung des ersten Bandes „Mithilfe Ihrer Mithilfe, Herr Minister!“ formuliert der Autor in diesem Buch weiterhin seine Kritik an den Spätfolgen der Rechtschreibreform der neunziger Jahre. Er weist nach, wie sich deren verfehlter Ansatz heute in zunehmendem Maße verheerend auswirkt, und zwar nicht nur in der Orthographie, sondern darüber hinaus in der Grammatik und der deutschen Sprache insgesamt. Sodann wird hier etwas ins Licht gestellt, das so noch nie behandelt wurde, dessen Bedeutung aber kaum hoch genug eingeschätzt werden kann: der juristische Hintergrund der Rechtschreibreform. Der Autor klärt unmißverständlich, wie die damalige Verhandlung zusammen mit der Durchsetzung der sog. Reform auf dem einfachen Verwaltungswege, nämlich über die Schulen und die Ämter, ein dezidiert undemokratischer, antiliberaler Vorgang gewesen war. Damit wurde die notwendige breite Diskussion über die Grundfrage einer Nation, mit welcher Sprache sie umgehen wolle, kompromißlos ausgehebelt: ein glatter Rückfall in den deutschen Obrigkeitsstaat à la Bismarck. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.02.2018 um 06.09 Uhr |
|
Klaus Deterding: Mithilfe Ihrer Mithilfe, Herr Minister!: Die Spätfolgen der Rechtschreibreform für die deutsche Sprache und Literatur. Berlin 2017. Meine Amazon-Rezension: Aus der Zeit gefallen Der Verfasser kritisiert und verspottet viele einzelne Reformschreibweisen, teils mit Recht, teils ohne, aber durchweg unsystematisch und seinem subjektiven Geschmack folgend. Schwerer fällt ins Gewicht, daß er nur verschiedene Dudenausgaben heranzieht, deren Verbindlichkeit ja aufgehoben ist, und weder die Arbeit der zwischenstaatlichen Kommission noch die des Rates für deutsche Rechtschreibung zur Kenntnis nimmt. Daß es eine über 20 Jahre anhaltende fachliche Diskussion zu diesem Gegenstand gibt, wird nirgendwo erkennbar. Hinzu kommen viele Fehler im einzelnen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.02.2018 um 16.18 Uhr |
|
Die strukturalistische Erzähltextanalyse ist von horoskophafter Allgemeinheit, daher stets sehr „überzeugend“: Jemand stößt auf ein Hindernis, ein Konflikt wird gelöst, es gibt Ankunft, Abwesenheit usw. – das paßt immer. Und alles, was geschieht, ist ein Fall von ... (Typ) und hat eine Funktion in einem größeren Ganzen. Ähnlich die Mythenanalyse nach Lévi-Strauss, auch die selbstimmunisierende Klappermühle der Psychoanalyse, aus der immer dasselbe herauskommt: überzeugend und sterbenslangweilig.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.09.2017 um 04.35 Uhr |
|
In Würzburg werden sprachliche Zweifelsfälle in eine Datenbank aufgenommen: http://kallimachos.de/zweidat/index.php/Hauptseite Warum allerdings Bastian Sick ausgewertet wird, ist mir nicht klar. Näher läge es doch, zum Beispiel Zeitschriften wie den "Sprachdienst" durchzuarbeiten. Ob die Kollegen wissen, wie umfangreich das Projekt werden könnte? Nehmen wir die unendlich oft erörterte Frage nach der "pleonastischen" Verneinung bei ehe/bis, die wir hier auch schon diskutiert haben: http://kallimachos.de/zweidat/index.php/Matthias(1929)_Ehe_(nicht)_bevor_(nicht)_bis_(nicht)_ohne_da%C3%9F_(nicht) Da ist also gerade mal das Buch von Matthias ausgewertet; es warten tausend weitere. Das Projekt läuft eigentlich auf eine annotierte Bibliographie der sprachlichen Zweifelsfälle hinaus. Die könnte aber ihren (beschränkten) Nutzen erst bei einiger Vollständigkeit entfalten. Wenn ich zum Beispiel erfahren will, was zur pleonastischen Negation geschrieben worden ist, finde ich in meinem eigenen Bücherregal bestimmt 50 Bücher. Bis das Datenbankprojekt diesen Vorsprung eingeholt haben wird, könnten viele Jahre vergehen. Momentan enthält die Datenbank ZweiDat aufbereitete Daten aus folgenden Texten: Eduard Engel (1922): Gutes Deutsch. Ein Führer durch Falsch und Richtig. Leipzig. Theodor Matthias (1929): Sprachleben und Sprachschäden. Ein Führer durch die Schwankungen und Schwierigkeiten des deutschen Sprachgebrauchs. Sechste verbesserte und vermehrten Auflage. Leipzig. Gustav Wustmann (1903): Allerhand Sprachdummheiten. Kleine deutsche Grammatik des Zweifelhaften, des Falschen und des Häßlichen. Ein Hilfsbuch für alle, die sich öffentlich der deutschen Sprache bedienen. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig. Diese Werke zu verzetteln ist vielleicht keine dringliche Aufgabe. Interessanter wären nicht so leicht auffindbare Belege für Sprachzweifel. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.09.2017 um 16.32 Uhr |
|
Die Angaben zu Aktionsarten sind oft aus der Wortbildung herausgesponnen und nicht am wirklichen Gebrauch orientiert, wie es sein sollte. Besonders mit "iterativ" wird zu großzügig gearbeitet. Zu nicken: "nicken, verb. ahd. nicchen, nichen, mhd. md. mnd. nd. nicken (nikken), iterativ zu nîgen (neigen)" (Grimm: DWb) "mittelhochdeutsch nicken, althochdeutsch nicchen, Intensiv-Iterativ-Bildung zu neigen" (Duden) Dann wäre es ein wiederholtes und/oder besonders heftiges Neigen. In Wirklichkeit ist nicken zunächst diminutiv, bezeichnet also ein Schwaches Neigen des Kopfes, dann aber in der Regel auch kommunikativ, zeichenhaft, eine Geste der Bejahung oder des Einverständnisses. Selten ergänzt durch mit dem Kopf. Früher nickte man einfach den Kopf (= neigte ihn ein wenig). Das Nicken hat sich dann als Bezeichnung einer zustimmenden Gestik verselbständigt, so daß es gebenenfalls durch die adverbiale Bestimmung ergänzt werden kann (was aber relativ selten geschieht). Diese Ergänzung ist aber bei schütteln kurioserweise notwendig, sofern man nicht beim älteren den Kopf schütteln bleibt. Schütteln allein ist nicht kommunikativ. Was schüttelt man also, wenn man "mit" dem Kopf schüttelt? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.09.2017 um 07.31 Uhr |
|
Er ist in Nizza. Weil man auch sagen kann befindet sich, zählt Hilke Elsen das Verb hier zu den Vollverben (Elsen Morphologie 2014:182); das ist aber, wie alle Paraphrasen, kein Beweis. Koordinierbarkeit als Kriterium: Er ist jetzt in Nizza und mit seinem Leben zufrieden. Aber: *Er befindet sich/wohnt jetzt in Nizza und mit seinem Leben zufrieden. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 12.07.2017 um 22.35 Uhr |
|
Soll hier angenommen werden, daß Hitler nicht zwischen »deutsch« und »germanisch« unterscheiden konnte?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.07.2017 um 16.21 Uhr |
|
Jörg Riecke: Geschichte der deutschen Sprache. Eine Einführung. Stuttgart 2016 (Reclam) Riecke beklagt, daß die Widerstandskämpfer Elise und Otto Hampel, die kaum Schulbildung genossen hatten, fast vergessen sind, und führt es darauf zurück, daß es „noch immer eine weitverbreitete Ansicht ist, dass Menschen, die nicht normgerecht schreiben, nicht recht ernst zu nehmen seien. Diese ganz und gar unangemessene Verknüpfung von Rechtschreibung und Intelligenz, eine Folge der Aufwertung der Hochsprache zum Statussymbol, wirkt offensichtlich bis heute weiter.“ (232) „Offensichtlich“, aber es ist Spekulation. Das Kapitel ist überschrieben: „Von Weimar nach Buchenwald – Der Untergang der bürgerlichen Sprachkultur“. Über zwei Seiten widmet Riecke der Tatsache, daß Grimm und viele andere Germanisten über 100 Jahre lang „deutsch“ im Sinne von „germanisch“ gebrauchten, und der These, daß Hitler das für seine Eroberungspolitik ausnutzte. Allerdings: „Es gibt keinen Nachweis, dass Hitler Behaghels Sprachgeschichte gekannt hat, aber es steht außer Frage, dass die ideologische und zugleich fachsprachliche Gleichsetzung von „deutsch“ und „germanisch“ bei Hitler und seinen Anhängern fatale Folgen nach sich zog. Es wurde ein Gebietsverlust der deutschsprachigen Bevölkerung angenommen, der ausgeglichen werden müsse, obwohl er so nie stattgefunden hat.“ (226f.) Ein „Untergang der bürgerlichen Sprachkultur“ hat auch nie stattgefunden. Übrigens ist Behaghels „Geschichte der deutschen Sprache“ (in Frage käme die 5. Auflage, die vor mir liegt) keine leichte Lektüre, und Hitler könnte daraus auch kaum ideologische Munition gezogen haben. Ein Vorzug des Buches sind die Textproben, aber eine weitere derartige Einführung war nicht gerade nötig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.03.2017 um 08.51 Uhr |
|
Ein Beamter erinnerte sich seines Namens, konnte aber nur versprechen ... (Altmann/Hahnemann: Syntax fürs Examen. Opladen 1999, S. 120) Das soll asyndetisch sein, aber man darf das aber nicht übersehen, ohne das die Satzreihe einen ganz anderen Charakter hätte. Daß der "Konnektor" nicht am Anfang steht, ist unwesentlich. (Von der uneindeutigen Intonation sehe ich ab.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.02.2017 um 19.14 Uhr |
|
Wie Hermann Paul (hab ich irgendwo zitiert) bemerkte, ist es praktisch unmöglich, zwei Sätze nebeneinanderzustellen, ohne daß der Hörer eine Verbindung zwischen ihnen herzustellen versucht (mein Beispiel war: Ich bin Sozialdemokrat, ich glaube an das Gute. Syndese ist etwas mehr: eine formal angezeigte Verbindung. Das Komma muß man natürlich erst einmal beiseitelassen, weil grammatische Erscheinungen unabhängig von der Schrift sind. Ich meine nun, die Darstellung ist unvollständig, wenn man nur auf die koordinierende Konjunktion (den "Syndesmos") starrt. Hinzu kommt die Intonation und auch die Sonderregel, daß bei einer Reihung die abschließende Konjunktion darüber entscheidet, welcher Art die nicht konjunktional angezeigten vorangehenden Verbindungen sind (a, b oder c; a, b und c). |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 10.02.2017 um 17.18 Uhr |
|
Dann weiß ich allerdings kaum mehr, was eigentlich Syndese wirklich ist, denn irgendeine Verbindung gibt es ja bei einer Reihung mit Komma immer. Sonst würde man ja (im Falle von Sätzen) gleich zwei einzelne Sätze mit je einem Punkt schreiben. Was wäre ein Beispiel für eine echte asyndetische Verknüpfung zweier Sätze? |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 10.02.2017 um 17.03 Uhr |
|
Das heißt also, die Wikipedia-Definition, die Syndese ausschließlich an Konjunktionen festmacht, ist falsch bzw. unzweckmäßig.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.02.2017 um 16.42 Uhr |
|
Ich wollte nur noch einmal darauf hinweisen, daß es neben den sichtbaren (hörbaren) Konjunktionen noch andere Mittel der Verbindung gibt und daß die scheinbar unverbunden nebeneinanderstehenden Hauptsätze sehr wohl verbunden sind.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 10.02.2017 um 13.23 Uhr |
|
Mir ist hier nicht klar, ob Sie meinen, daß nur die Beispiele nicht passend sind oder daß die Klassifizierung in syndetisch/asyndetisch an sich schon sinnlos ist.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.02.2017 um 10.01 Uhr |
|
Aus Wikipedia "Satz": Sätze können mit einer Konjunktion (syndetisch) oder mit mehreren Konjunktionen (polysyndetisch) oder ohne Konjunktionen (asyndetisch) miteinander verbunden werden. Syndetisch: Ich kam, ich sah und ich siegte. Polysyndetisch: Ich kam und ich sah und ich siegte. Asyndetisch: Ich kam, ich sah, ich siegte. Das vermeintlich asyndetische Beispiel hat zwar keine Konjunktionen, aber die nichtschließende Intonation darf nicht übergangen werden. Die drei Sätze sind dadurch sehr wohl verknüpft, nur eben konjunktionslos. Im ersten Beispiel deutet das Komma die Verbindung an. Wie schon anderswo gezeigt, wird zwar eine der Konjunktionen eingespart, aber man kann sie rückwirkend sogar als und oder oder identifizieren, je nachdem, ob die abschließende ein oder oder ein oder ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.12.2016 um 19.04 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=35#11407 Zu indischen Abugida-Schriften vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Devanagari und danach: http://www.cis.uni-muenchen.de/~stef/seminare/suchmaschinen/schriftsysteme.pdf Hier werden ī und ū, kī und kū in einer Tabelle als „Dehnstufe“ bezeichnet. Richtig wäre „Langvokal“, denn unter Dehnstufe versteht man die Ablautstufe "Vrddhi"; darum geht es aber nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.11.2016 um 08.03 Uhr |
|
Stefanie Stricker/Rolf Bergmann/Claudia Wich-Reif: Sprachhistorisches Arbeitsbuch zur deutschen Gegenwartssprache. Heidelberg 2012. Die Rechtschreibreform wird mehrmals erwähnt, stets affirmativ. Zur s-Schreibung: „Die Neuregelung stellt eine Vereinfachung dar, weil die Wortstämme jetzt gleich geschrieben werden, also das morphologische Prinzip angewendet wird.“ (38) Das war allerdings gar nicht das Motiv der Neuregelung, die vielmehr allein auf die Phonem-Graphem-Entsprechung abstellt (zuzüglich Betonung, was die Sache eben nicht gerade einfach macht: Kürbis, Erlebnis, Bus usw.). Auch war die Morphemkonstanz ja immer schon gewahrt, wenn man das ß als stellungsbedingte typographische Variante verstanden hatte. Immerhin erwähnen die Verfasser den „einzigen unsystematischen Fall“ dass, rechtfertigen ihn aber mit dem „morphemdifferenzierenden Prinzip“, womit sie nochmals über die amtliche Darstellung hinausgehen. (Dasselbe noch einmal unter den Aufgaben und Lösungen.) Kein Wort darüber, daß und warum gerade die dass-Schreibung bis zum heutigen Tag eine absurd hohe Fehlerzahl hervorbringt. Gräuel finden sie auch richtig, weil sie Augsts volksetymologische Spekulationen durchgehend übernehmen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.11.2016 um 05.11 Uhr |
|
„Eine Parenthese ist grammatisch nicht in den Satz eingebaut. (...) Eingeschobene Redeeinleitungen in direkter Rede sind wie Parenthesen. Sie können darum auch an verschiedenen Stellen stehen: Sie sagte: 'Dies war ohne Zweifel unser größter Erfolg.' 'Dies war', sagte sie, 'ohne Zweifel unser größter Erfolg.'“ (usw.) (Hans Jürgen Heringer: Grammatik und Stil. Praktische Grammatik des Deutschen. Frankfurt 1989:297) ("Für den Gebrauch in Schulen") Aber die Satzgliedstellung beweist, daß die vermeintliche Parenthese grammatisch doch eingebaut ist. Sonst müßte es ja auch im zweiten Fall sie sagte heißen. Das kann man doch nicht übersehen, und es ist ja auch viel darüber geschrieben worden. Nicht erst J. R. Ross ("Slifting") hat es entdeckt, sondern schon Blatz schrieb darüber: „Etwas verschieden von den eigentlichen Satzparenthesen sind die in eine direkte oder indirekte Rede eingefügten Schaltsätze, wie: sprach Joseph, sagte er, dachte mancher, meinte der Herr, hieß es – wobei die gesprochenen (gedachten) Worte als Objekt oder Subjekt einen Inhaltssatz vertreten.“ (Blatz II:1289f.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.11.2016 um 10.05 Uhr |
|
Die Arbeit an diesem Buch hat mir viel Spaß gemacht. So oder ähnlich liest man es heute oft im Vorwort von Fachbüchern. Das wäre früher kaum möglich gewesen, und man fragt sich, wie die Verfasser eigentlich ihre Leser einschätzen. (Wahrscheinlich sind es dieselben, die Halbmodalverben "spannend" finden.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.11.2016 um 05.40 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1044#32784 Das Handbuch ist 2016 unter einem anderen Titel noch einmal erschienen. Ich habe es nicht in der Hand gehabt, kann mir aber nicht vorstellen, daß sich viel geändert hat. Solche Werke sind schnell zusammengeschrieben und helfen niemandem. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.11.2016 um 18.37 Uhr |
|
Im Chinesischen gilt wie im Deutschen generell die Regel Subjekt-Prädikat-Objekt. (http://interculturecapital.de/einfach-chinesisch-lernen-5-das-subjekt-im-chinesischen) Zum Beispiel gleich in diesem Satz. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.10.2016 um 16.00 Uhr |
|
An verschiedene Valenzmuster sollen sich „allerhand skurrile Interpretationsversuche angeschlossen haben, so etwa, wenn unter dem Schock des Nationalsozialismus vom ‚inhumanen Akkusativ‘ gesprochen wird (Weisgerber 1957/58).“ (Handbuch deutscher Wortarten:828f.) Von einem solchen Schock kann beim Ahnenerbe-Keltologen Weisgerber, dem Verfasser der „Volkhaften Kräfte der Muttersprache“, bestimmt keine Rede sein. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.08.2016 um 05.51 Uhr |
|
Noch einmal Uni Jena (s. Haupteintrag): http://www.personal.uni-jena.de/~x4diho/DFG%20Antrag.pdf (Auch in diesem Projektantrag wird Behaghel permanent falsch geschrieben: Behagel. Das zeigt eine abgründige Unvertrautheit mit der klassischen Fachliteratur. Der Text zum offenbar genehmigten DFG-Projekt steht seit Jahren im Netz.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.08.2016 um 09.23 Uhr |
|
„Der Hype um die letzte Rechtschreibreform scheint völlig überzogen. Die Änderungen sind minimal, sie betreffen im Wesentlichen nur die ss-Schreibung. Und die deutsche Sprache war davon nicht betroffen. Wer das so empfand, war wohl Anhänger der Abbildtheorie, angereichert mit der Annahme, man könnte mit dem Abbild das Original verändern. Vielleicht spielte aber auch ein anderer Topos mit, nämlich der Topos von der sprachlichen Konstanz. Sprache soll sich nicht ändern. (...) Wie weit der Hype um die Rechtschreibreform in erster Linie eine mediale Inszenierung war, in der sich Personen mit inszenierten, auch Linguisten (glücklicherweise nur bis knapp an die Klapsmühle), bleibt die Frage. Wenn manche bis vors Verfassungsgericht gingen, so haben sie da wenigstens die richtige Antwort bekommen. [Folgt Zitat aus dem Karlsruher Urteil.] So fühle ich mich auch durch die Verfassung geschützt. Ich habe kein Problem damit, mich etwas umzustellen. Aber ich trau mich auch, etwas abzuweichen. Tut mir leid – nicht sehr Leid.“ (Hans Jürgen Heringer: Linguistik nach Saussure. UTB 2013:116) Vgl. auch http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=783#30209 Bezeichnend für Stil und Niveau heutiger Studienbücher. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.07.2016 um 05.38 Uhr |
|
Noch einmal zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1044#25477 und dem "Kodieren": Wikipedia fährt fort: "In der Kommunikationswissenschaft bezeichnet ein Code im weitesten Sinne eine Sprache. Jegliche Kommunikation beruht auf dem Austausch von Informationen, die vom Sender nach einem bestimmten Code erzeugt werden und die der Empfänger gemäß demselben Code interpretiert." Damit fällt aber gerade der zweite Zeichenvorrat weg, und die Rede vom "Kodieren" verliert jeden Sinn. Nur der technizistische Schein bleibt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.07.2016 um 16.46 Uhr |
|
Duden Ratgeber „Handbuch Korrekt und stilsicher schreiben“ von Ursula Hoberg, Rudolf Hoberg, Julian von Heyl, Christian Stang, Antje Kelle. Berlin 2013. Man soll Allerweltswörter vermeiden. Statt Auf dem Flohmarkt gibt es seltene Dinge wird empfohlen Auf dem Flohmarkt gibt es Raritäten. (19) Statt Viele Hundefreunde kaufen sich kleine Hunde soll man schreiben Viele Hundefreunde kaufen sich Welpen. (20) Aber Welpen sind junge Hunde, nicht kleine. Ich bringe ein Päckchen zur Post statt Ich bringe ein kleines Paket zur Post. Auch das ist nicht dasselbe. So geht es weiter mit dem angeblich „treffenden“ Wort, das aber in sämtlichen Beispielen etwas anderes bedeutet als das Original. Der Eiffelturm ist weltbekannt ist durchaus nicht dasselbe wie Der Eiffelturm ist ziemlich bekannt. (21) Synonym wird aus einem griechischen Wort für „gleichnamig“ hergeleitet. (23) Dann wären es Homonyme und nicht „sinnverwandte Wörter“. Synonyme werden zur Vermeidung von Wiederholungen empfohlen, so ausdrücklich Spree-Athen, Main-Metropole und andere Marotten des Provinzjournalismus. Wie sich abgesehen von solchen Antonomasien die Wiederholungsvermeidung mit der Suche nach dem treffenden Wort verträgt, wird nicht erörtert. „Wissenschaftssprache ist also eine Sondersprache für Eingeweihte.“ (27) Nein, für Fachleute, für Wissenschaftler eben. Bei der Rechtschreibung soll man das Stammwort suchen: leidgeprüft wegen leiden. (138) Gerade diese beiden Wörter sind allerdings nicht verwandt. „Besonders kritisch sollte man auch bei Kandidaten sein, deren Informationsgehalt“ (? Bedeutung!) „sich auf Anhieb wohl den meisten Lesern nicht so leicht erschließt, beispielsweise bei: gar immerhin (...)“ (50f.) Was soll an immerhin schwer sein? Das Buch übt beckmesserische Kritik an Wörtern wie allermeiste, fortentwickeln, kontrovers diskutieren (53), an denen doch nicht mehr auszusetzen ist als an all den anderen Verstärkungen und Verdeutlichungen, mit denen die Sprache nun einmal arbeitet. Gleich anschließend erwähnen die Verfasser einige Tautologien, „die etwas hervorheben“ und daher „ihre uneingeschränkte Daseinsberechtigung“ haben: immer und ewig, einzig und allein. Die Umgangssprache, in der sie ihren Platz haben, wird sich auch das allermeiste nicht nehmen lassen, und die Verfasser können auch nicht begründen, warum sie das eine begrüßen, das andere verbannen. Die Verfasser selbst finden nichts dabei, etwas „gezielt zu suchen“ (53). Sie überarbeiten Sätze durch Kürzung, lassen aber Plastikwörter wie Stringenz, prägnant einfach stehen, für die sie offenbar kein Ohr haben. (Sie verwenden sie auch im eigenen Jargon reichlich: Intensität, emphatisch, differenziert ...; dazu bürokratische Wörter wie zunehmend, erneut ...) Der Hauptfehler der vielen Umformulierungen ist aber, daß fast immer am Ende etwas anderes gesagt wird als im Ausgangssatz. Daß man „Übertreibung vermeiden“ solle, liegt schon im Begriff der Übertreibung, muß also nicht eingeschärft werden: „Korrigieren Sie die unpassenden Übertreibungen“ (58). Auch einen „vorschnellen Griff zum Bindestrich“ (89) kann man natürlich nicht gutheißen, wie alles Vorschnelle. Warum einige Sätze „spröde“ oder „trocken“ wirken, andere „flüssig“ oder „locker“, wird nicht genauer gesagt. „Angemessen“ stammt aus der Rhetorik und bleibt völlig leer. In den meisten Fällen wird „unser natürliches Sprachgefühl“ beschworen – nicht gerade das, was man in einem Ratgeber sucht. Immer wieder stößt man auf hilflose Gemeinplätze dieser Art: „Gewachsene Sprache ist eben nicht auf abstrakte Normen festzulegen.“ (76) „Jeder Einzelfall verlangt seine individuelle Lösung; ein Patentrezept gibt es nicht.“ (89) - „Dezent muss das Satzbild sein. Nur individuelle Akzente sind willkommen.“ (97) usw. - lauter Kapitulationserklärungen der Stilistik. Die Verfasser wollen allgemeinverständlich bleiben und vermeiden es, die sprachlichen Dinge bei ihrem Namen zu nennen. Der Text wirkt dadurch oft kindlich oder vielmehr kindergärtnerisch. Besonders nervt die neckische Personifikation von grammatischen Einheiten: „Einige Verben leiden unter Minderwertigkeitsgefühlen.“ (74) - „Komposita, die mehr als zwei Wortteile umfassen, sollten wir auffordern, selbstkritisch ihre eigene Verständlichkeit zu prüfen.“ (88) - „Wenn ein Verb in Ruhe gelassen werden will, dann nimmt es seine Grundform an, den Infinitiv.“ (267) usw. über Hunderte von Seiten. Diese Personifizierung (der Wortarten usw.) verträgt sich übrigens schlecht mit der Rede von der Grammatik als „Bauplan unserer Sprache“ (262). „Hin kennzeichnet die Bewegung von uns weg. Her kennzeichnet die Bewegung zu uns her.“ (67) Das ist offensichtlich falsch – abgesehen von der unschön tautologischen Ausdrucksweise: her bedeutet eben „her“ (– aber hin bedeutet nicht „weg“!). Daher hin und her gehen (ohne Bezug zum Standpunkt des Sprechers). Man solle sagen: Es ist sinnvoll. Es ergibt Sinn. „Stattdessen lehnen wir uns ohne Grund an das englische to make sense an, ohne erklären zu können, inwiefern dadurch unsere Sprache bereichert wird. Zumindest eine kleine Besonderheit müsste zu erkennen sein, wenn solche Übernahme willkommen sein soll.“ (68) (Der erste Satz ist wieder doppelt gemoppelt, denn daß wir es nicht erklären können, bedeutet ja dasselbe wie „ohne Grund“.) Aber die ganze Forderung ist wirklichkeitsfremd, denn Entlehnungen gehen so gut wie niemals mit solchen Begründungen einher, sondern geschehen einfach, aus welchen Gründen auch immer. Die Verfasser empfehlen ja zum Beispiel die Wiederholungsvermeidung, und es läßt sich nachweisen, daß dies ein Grund für die Verwendung von Fremdwörtern ist. Natürlich darf man brauchen nicht ohne zu gebrauchen. Dasselbe ist nicht das Gleiche. Mit solchen abgestandenen Regeln kann man auch hier die locker bedruckten Seiten füllen; am breiten linken Rand werden mehr oder weniger passende Klassikerzitate und Aphorismen angeführt. „Das griffigere Wort ist eben oft das elegantere Wort.“ (77) Als elegant wird empfohlen beabsichtigen statt die Absicht haben. (ebd.) Wie wäre es mit wollen? Das Lob des Aktivs gegenüber dem Passiv wird in sehr herkömmlicher Weise gesungen. Aus dem Aktivsatz Der Lehrer hat es leider damals bemerkt (das Mogeln nämlich) glauben die Verfasser eine „zielsichere, fast spitzbübische Aufmerksamkeit des Lehrers“ herauslesen zu können, die im Passiv „verblasse“ (82). Das ist reine Phantasie. Die Verfasser wissen durchaus, daß das Passiv der „Täterverschweigung“ dient; daher ist es nicht richtig, daß im Passiv „alles sich wie von selbst vollziehe“ (79). Der Täter ist durchaus noch eingeschlossen, wird nur eben nicht genannt. Daher ist Er wurde im Wald erschlagen (mein Beispiel) immer so zu verstehen, daß ein anderer Mensch die Tat vollbrachte, nicht etwa ein Baum oder Blitz. teilweise, stufenweise usw. als Adjektive sind zwar unverändert gegenüber dem adverbialen Gebrauch, aber das gilt schon nicht mehr für die flektierten Formen. (99) „So teilt das Partizip Präsens mit, dass sich jetzt gerade etwas ereignet (...) Das Partizip Perfekt informiert dagegen darüber, dass etwas bereits abgeschlossen ist (...)“ (102) Das ist nur die halbe Wahrheit, da es auf die Aktionsart ankommt, vgl. die vielzitierte belagerte Stadt, die belagert wird, nicht unbedingt belagert worden ist. Ebenso das später angeführte reflektierte Mondlicht (104). Auch wäre das Partizip I besser durch Gleichzeitigkeit (zur Haupthandlung) statt durch den Bezug auf die Sprechsituation („jetzt“) zu kennzeichnen. „Der Satzanfang ist naturgemäß die Stelle, an der man etwas Angestautes 'loswerden' möchte.“ (107) - Er ist aber auch unauffällige Anschlußstelle, wie Drach es genannt hat. Man soll nicht sagen: Wir wollten uns erfrischen und wir entschlossen uns zu einem Abstecher ans Meer. Sondern: Weil wir uns erfrischen wollten, entschlossen wir uns zu einem Abstecher ans Meer. (121) Natürlicher wäre: Wir wollten uns erfrischen und entschlossen uns zu einem Abstecher ans Meer. Denn die Wiederholung des Subjekts ist schwerfällig, während der Hörer intelligent genug ist, die logische Beziehung zwischen beiden Sätzen selbst herzustellen. Viele Seiten füllen sich mit solchen zweifelhaften „Verbesserungen“. „Sorgen Sie dafür, dass Wichtiges im Hauptsatz und Untergeordnetes im Gliedsatz steht.“ (123)(Dieser Satz widerlegt sich übrigens selbst, denn das Wichtige ist doch, wofür man sorgen soll.) Der erste Beispielsatz lautet: Das Hotel lag so nah am Strand, dass wir das Meer rauschen hörten. Man soll ihn so umformen: Da das Hotel so nah am Strand lag, hörten wir das Meer rauschen. Das wirkt unnatürlich, schon wegen des da-Satzes. In einer Erzählung aus dem Urlaub kann man sich so etwas kaum vorstellen. Auch wird übersehen, daß nicht Haupt- oder Nebensatz für die Verteilung von Thema und Rhema entscheidend ist, sondern die Stellung, vgl. Hermann Paul: Deutsche Grammatik IV, 315 (§ 494). Das Werk lehrt für bevor und ehe, aber nicht für bis, daß bei verneintem Obersatz im abhängigen Satz nur dann die Negation stehen dürfen, wenn er vorangeht. (470, 472, 485) Das entspricht aber ganz und gar nicht der Sprachwirklichkeit, auch wenn es ebenso in anderen Büchern von Duden und Wahrig steht. (Verben) „heißen auch Zeitwörter, weil sie Ereignisse bezeichnen, die in der Zeit ablaufen“. Nein, weil sie Tempusmorpheme tragen. Das Buch ist zwar erst 2013 erschienen, aber schon seit einiger Zeit nicht mehr im Handel. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.06.2016 um 04.37 Uhr |
|
Zur Duden-Grundschulgrammatik ( http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1044#25266) In der Einleitung geben die Verfasserinnen zu, daß man seine Muttersprache ohne Grammatikkenntnisse beherrschen kann. „Irgendwann aber ist es hilfreich zu wissen, wie die Sprache aufgebaut ist und wie man sie richtig verwendet. Viele Rechtschreibprobleme kannst du lösen, wenn du dich zum Beispiel in den Wortarten und der Wortbildung auskennst. Beim Schreiben eigener Texte hilft es dir, etwas über den Bau der Sätze zu wissen.“ (s. a. http://download.e-bookshelf.de/download/0002/5946/08/L-G-0002594608-0006778388.pdf) Der einzige Nutzen ist also die Rechtschreibung, und selbst das kann man bezweifeln. Die Hilfe beim Schreiben kann als widerlegt gelten. Linguisten schreiben offenbar nicht besser als andere Menschen. Die Begründung des Grammatikunterrichts ist ungefähr so überzeugend, als ob man Biologieunterricht mit dem Nutzen beim Zerlegen der Weihnachtsgans begründen wollte. „Wörter, die mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben werden, sind Nomen.“ (8) „Mit Nomen bezeichnet man, Lebewesen, Pflanzen und Gegenstände. Diese Nomen nennt man Konkreta, weil sie etwas benennen, das sichtbar, hörbar oder anfassbar ist.“ „Mit Nomen bezeichnet man auch etwas Nichtgegenständliches. Diese Nomen nennt man Abstrakta, weil sie etwas benennen, was man fühlt, denkt oder sich vorstellt. die Freude, das Glück, die Klugheit, die Kunst, die Wut, der Traum, die Musik, die Jugend“ (9) „Jedes Nomen hat ein Genus. (...) Man erkennt es an seinem Artikel (Begleiter).“ (10) „Manche Nomen werden nur im Plural verwendet. die Eltern, die Leute, die Geschwister, die Ferien, die Kosten, die Alpen“ (15) Welches Genus haben sie? „Das Adjektiv kann direkt vor dem Nomen stehen. Dann verändert es sich mit dem Nomen. Es wird dekliniert (gebeugt). Der alte Esel schreit.“ (27) Usw. - nur schwache Adjektivformen werden eingeführt. S. 28 werden beiläufig drei starke Formen verwendet, aber nicht erklärt. Haben die Verfasserinnen das überhaupt bemerkt? Die zweifache Adjektivflexion ist immerhin ein Hauptpunkt der deutschen Grammatik. „Vor viele Verben kann man das Wörtchen sich setzen. Diese Verben nennt man reflexive Verben. (...) Ich wasche mich.“ Dann wäre waschen ein reflexives Verb? „Verben, die man mit und ohne das Wörtchen sich benutzen kann, nennt man unechte reflexive Verben (...) verstehen – sich verstehen.“ (37) Schlechtes Beispiel wegen Bedeutungswechsel. Die Verfasserinnen kennen eine Wortart „Zahlwort“, darunter der Zweite, ein Viertel; sie sagen nicht, warum diese groß geschrieben werden und ob es etwa keine „Nomen“ sind. Und was hat es mit ein paar auf sich, das ohne Kommentar angeführt wird? (71) „Hauptsätze können durch Kommas verbunden sein oder durch Konjunktionen (Bindewort), zum Beispiel und oder oder. Dann entfällt das Komma.“ (115) Hier wird die schlechtere Möglichkeit ohne Einschränkung als Regel gelehrt. In Zeitungen und besserer Literatur steht in solchen Fällen nach wie vor ein Komma, während es aus Kinder- und Schulbüchern getilgt worden ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.05.2016 um 15.56 Uhr |
|
Ich habe das genannte Buch nur durchgeblättert. Studenten würde ich es nicht in die Hand geben, aber ich will darauf nicht eingehen. Nur dies: "Dass Verb zeigen geht zurück auf ahd. zeigōn..." (59) Auf derselben Seite: "Typische indexikalische Ausdrücke auf der sprachlichen Ebene sind Pronomina. In dem Satz Alfred sieht, wie Hans sich betrinkt verweist das Reflexivpronomen sich auf Hans." Natürlich nicht; bei reflexiven Verben verweist das Pronomen auf gar nichts. (Und wenn es nicht reflexiv wäre, wäre es anaphorisch und nicht "indexikalisch" im zuvor erklärten Sinn.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.05.2016 um 10.25 Uhr |
|
Peter Schlobinski: Grundfragen der Sprachwissenschaft. UTB (V & R) 2014. In diesem Buch erwähnt Schlobinski den Verfasser der ältesten erhaltenen Grammatik und glaubt den Namen Pāṇini in Devanagari bieten zu können, ebenso das Wort Sandhi (S. 29). Zu diesem Zweck hat er anscheinend die Buchstaben aus einer Liste zusammengesucht und stellt sie nach Art unseres Alphabets hintereinander. Das Ergebnis ist nicht interpretierbar. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 13.04.2016 um 00.03 Uhr |
|
Das würde wiederum die amüsante Frage aufwerfen, welches Norwegisch? Aber im Ernst – Übereinstimmungen zwischen Holländisch und Kapholländisch sind einfach nicht der Rede wert. Interessant sind allenfalls die Unterschiede. |
Kommentar von Klaus Achenbach, verfaßt am 12.04.2016 um 22.52 Uhr |
|
Norwegisch vielleicht?
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 12.04.2016 um 10.21 Uhr |
|
»Niederländisch, Afrikaans usw.« – was mag sich wohl hinter dem »usw.« verbergen, Pennsylvania Dutch vielleicht?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.04.2016 um 05.25 Uhr |
|
„Damit hat Drach zumindest das für das Deutsche (aber auch andere germanische Sprachen wie Niederländisch, Afrikaans usw.) zentrale V2-Phänomen beschrieben: In kanonischen Aussagesätzen wird genau eine beliebige Konstituente dem finiten Verb vorangestellt. Was dieses Modell aber nicht erfasst, ist einerseits der Bereich nach dem finiten Verb und andererseits auch nicht die Struktur anderer als V2-Sätze. Deshalb verwerfen wir das Drach'sche Drei-Felder-Modell und wenden uns differenzierteren topologischen Modellen zu.“ (Angelika Wöllstein: Topologisches Satzmodell. Heidelberg 2014:21) Als ob Drach gerade mal die Verb-Zweitstellung im Aussagesatz entdeckt hätte! Die Verfasserin kann das Buch nicht gelesen haben, „verwirft“ es aber mit bewunderswerter Selbstgewißheit. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.03.2016 um 09.11 Uhr |
|
In der Schülerduden-Grammatik (Gallmann u. a.) heißt es unter "Laute und Buchstaben": Unsere Schrift hat 26 Buchstaben; dazu kommen noch die Zeichen für die Umlaute ä, ö, ü und das ß. ...) Man kann Grundvokale und Umlaute voneinander unterscheiden. Das ist in einem solchen Kapitel verfehlt. Das ü in süß hat keinen anderen Status als das o in groß. Es gibt also 30 Buchstaben, und sie werden S. 19 alle aufgezählt; also nicht irgendwelche "Zeichen" neben den 26 Buchstaben. Etymologische Gesichtspunkte kommen später in Betracht. Höchstens über das ß könnte man diskutieren, aber selbst diese Ligatur ist zunächst als Buchstabe am besten untergebracht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.03.2016 um 14.51 Uhr |
|
Übrigens ist die erwähnte Frühneuhochdeutsche Grammatik in einem ganz eigentümlichen Stil geschrieben. Ich kann kaum mehr als eine Seite (von 550) lesen, ohne daß ich ein unerträgliches Kribbeln im Hirn spüre und das Buch weglegen muß. Ich kann nicht recht sagen, woran es liegt. Ich greife mal aufs Geratewohl zwei Abschnitte heraus: „(1) die Wahl der Präposition ist durch die Vorstellung zwischen Verb und Objekt bestimmt, es gibt aber verschiedene Vorstellungen, z. B. etwas von jem. begehren / fordern gegenüber etwas an jem. begehren / fordern, (2) es liegt im Grunde die gleiche Vorstellung vor, es variieren verschiedene Präpositionen aus dem gleichen semantischen Bereich, z. B. etwas an / auf etwas legen (...)“ (380) „Die traditionellen Konzessivsätze umfassen eine Reihe syntaktischer Gebilde, deren Semantik verschieden aufgefaßt wird. Im allgemeinen räumt der Konzessivsatz einen für den Sachverhalt im übergeordnenten (sic) Satz irrelevanten Sachverhalt ein. In vielen Fällen würde normalerweise ein adversatives Verhältnis zwischen diesen Sachverhalten bestehen, das gerade nicht besteht.“ (465) Ich versichere, daß das ganze Buch so geschrieben ist! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.03.2016 um 10.20 Uhr |
|
„Vor dem Kernsubstantiv steht ein relativ streng organisiertes Feld aus flektierten Elementen und zwei Arten von nichtflektierten Elementen, dem Adverb und dem vorangestellten Genitivattribut. Nach dem Kernsubstaniv steht ein weniger streng organisiertes Feld, das aus nichtflektierten Genitiv-, Adjektiv-, Partizipial-, Präpositional- und satzwertigen Attributen gesteht. (...) Während der ganzen frnhd. Zeit erscheinen zwei Arten von nichtflektierten Elementen im Feld vor dem Substaniv: (1) Genitivattribute und (2) Adverbia, die ein vorangestelltes Adjektiv bestimmen.“ (Robert Peter Ebert u. a.: Frühneuhochdeutsche Grammatik. Tübingen 1992:313) Das ist ziemlich kryptisch: Wieso sind Genitivattribute „nichtflektiert“? Und die Adverbien, die Adjektive näher bestimmen, stehen zwar „vor“ dem Substantiv, aber zunächst einmal vor dem Adjektiv, und nur darauf kommmt es an. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.02.2016 um 17.41 Uhr |
|
Wenige lassen sich das sogenannte "Beobachter-Paradox" entgehen, das William Labov so formuliert hat: Das Ziel der sprachwissenschaftliche Forschung innerhalb einer Sprachgemeinschaft muß sein, herauszufinden, wie Menschen sprechen, wenn sie nicht systematisch beobachtet werden; wir können die notwendigen Daten jedoch nur durch systematische Beobachtungen erhalten. Ein Scheinproblem und kein Paradoxon, denn es kommt ja nur darauf an, daß die Beobachteten nicht merken, daß sie beobachtet werden, milder: daß sie nicht merken, worauf es dem Beobachter ankommt. In der Praxis keine große Sache. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.01.2016 um 04.43 Uhr |
|
In den letzten Jahren sind immer schneller nacheinander Bücher erschienen, die in die "Lexikologie" einführen. Was das sein soll, ist anscheinend nicht klar. In Wirklichkeit handelt es sich ausnahmslos um Bücher, die sich mit Etymologie, Semantik, Wortbildung, Phraseologie, Zeichenmodellen usw. beschäftigen. Manchmal ist die Wortgeographie einbezogen, meistens nicht. Zum Teil wird die alte "Wortforschung" übernommen (wie die ziemlich lächerliche Umbenennung eines Büchleins von "Deutsche Wortforschung" zu "Germanistische Lexikologie" zeigte), aber ohne die Fülle der Wörter-und-Sachen-Forschung. Der Student, der eine solche Einführung in die Lexikologie zu lesen versucht, sei es die alte von Thea Schippan oder die neue von Volker Harm, muß sich zum zehntenmal durch den Stoff quälen, den er in anderen Einführungsbüchern bereits gelernt hat. Komisch, daß den Verfassern das gar nicht aufgefallen ist. Meiner Ansicht nach sollte eine wohlverstandene Lexikologie sich mit dem Wortschatz beschäftigen und anderes, wie die Wortsemantik und Wortbildung, voraussetzen. Es geht um den Aufbau (die Struktur oder Gliederung) des Wortschatzes und seine Veränderung durch die Geschichte. Dazu gehört die Gliederung in Fachsprachen, Register, Soziolekte, Lehngut usw., auch die geographische Verteilung (Sprachatlas), Wortschatzstatistik und ähnliches. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.01.2016 um 15.58 Uhr |
|
Das Buch von Beller und Bender ist ziemlich schlecht. Traditionelle mentalistische Psychologie, viel Problemlösen und Chomsky, dessen Sprachbegriff weitgehend übernommen wird (samt Strukturbäumchen usw.) Was hat das mit Psychologie zu tun? Der Behaviorismus wird einmal erwähnt, weil Chomsky ihn erledigt habe. Viel ist von „Kognition“, „mentalem Lexikon“ usw. die Rede. Längst widerlegte Geschichten werden wiederholt: Kinder lernen (!) viele dieser Regeln „in einem Alter, in dem wir buchstäblich nicht bis drei zählen können – und das auf der Grundlage eines in didaktischer Hinsicht eigentlich unzureichenden Inputs (Chomsky nennt das poverty of the stimulus).“ (178f.) Spekulationen werden als Tatsachen gelehrt: „Die besondere Sprachkompetenz des Menschen lässt sich auf zwei Mutationen im FOXP2-Gen zurückführen, die eine Vergrößerung sprachrelevanter Areale im Gehirn bewirkten.“ Die Verfasser verwechseln Buchstaben und Phoneme und gelangen daher gar nicht bis zu einer Problematisierung des Phonembegriffs: „Wie produktiv Sprache ist, lässt sich gut daran erkennen, dass die rund 115.000 Wörter des Deutschen allesamt mithilfe eines begrenzten, ja spärlichen Basisinventars von 26 Buchstaben gebildet sind.“ (190) „Ein Satz ist eine Gruppe von Wörtern, die einen vollständigen Gedanken ausdrücken.“ (193) Leider wird nicht definiert, was ein vollständiger Gedanke ist. Der ganze Ansatz ist so naiv wie der muntere Psychologismus des 19. Jahrhunderts. Schade, daß dieses 1000mal wiederholte Zeug nun an die nächste Generation von Studenten weitergereicht wird. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.01.2016 um 10.59 Uhr |
|
„Deutsch hat 115.000 Wörter und 2.100 Regeln.“ (Sieghard Beller/Andrea Bender: Allgemeine Psychologie – Denken und Sprache. Göttingen 2010:178) Die Verfasser berufen sich auf den Rechtschreibduden und die 7. Auflage der Dudengrammatik. Allerdings sind die numerierten Abschnitte dieser Grammatik keine „Regeln“. Man könnte diesen Versuch einer Sprachbeschreibung auf noch viel mehr "Regeln" bringen, sie wären für die Sprache selbst und auch für das Lernen ohne Bedeutung.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.12.2015 um 06.37 Uhr |
|
"Aber auch weitere Rechts-Versetzungen sind möglich. (...) Sie dienen der Hervorhebung. Es handelt sich um eine Topikalisierung des Bezugswortes unter Zurücklassung des Attributes in der Mittelfeldposition. (...) Geld habe ich keins. Papier habe ich nur beschmutztes gefunden. (...) Man beachte die Flektiertheit der Adjektive. Sie sichert den attributiven Bezug.“ (Klaus Welke: Einführung in die Satzanalyse. Die Bestimmung der Satzglieder im Deutschen. Berlin, New York 2007:107) Zur pronominalen Form keins äußert Welke sich nicht. Der erste Satz kann nicht aus *Ich habe keins Geld hergeleitet werden. Dann kann es aber auch beim zweiten Satz nicht so gelaufen sein. Und wieso "Rechts-Versetzung"? Bewegt wird doch nach dieser Auffassung der topikalisierte Teil, also der nach links versetzte. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.10.2015 um 06.16 Uhr |
|
Hans Jürgen Heringer/Rainer Wimmer: Sprachkritik, Paderborn 2015 Dieses Buch, aus dem ich an verschiedenen Stellen schon kritisch zitiert habe, wird jetzt auch in der FAZ (9.10.15) von Helmut Glück verrissen, mit Recht. Man könnte noch hinzufügen: Die Verfasser verwerten ihre in den letzten Jahrzehnten oft vorgetragenen Gedanken zum soundsovielten Male, sogar die Kritik am Begriffebesetzen durch Biedenkopf und seine Semantiktruppe vor 35 Jahren. Als Polenz-Schüler kritisieren sie das CDU-Programm in Leichter Sprache, ohne zu erwähnen, daß die anderen Parteien es genauso machen. Das ganze Buch ist ein konfuses Sammelsurium, das man eigentlich mit Stillschweigen übergehen sollte. Dem Verlag ist noch vorzuhalten, daß viele Texte in besonderen Kästen so dunkelgrau unterlegt sind, daß man sie nur schwer lesen kann. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.08.2015 um 05.39 Uhr |
|
Regeln für junge Sprachwissenschaftler: 1. Verwende nur selbstgemachte Beispiele. 2. Erwähne Dutzende von Sprachen, die du ebenso wenig kennst wie deine Leser. (Am besten fast ausgestorbene Sprachen von Indianern und australischen Ureinwohnern.) 3. Formalisiere (auch wenn es nur Abkürzungen und pseudomathematische Notationen sind). 4. Vermeide die Lektüre älterer (vor-chomskyscher) Fachliteratur. 5. Zitiere deine Freunde so oft wie möglich und laß dich von ihnen zitieren. 6. (Nur für besonders Ehrgeizige) Erfinde Theorien und bezeichne sie mit knackigen Etiketten, die sich ein für allemal mit deinem Namen verbinden. Weiter mit Regel 5! |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 22.07.2015 um 19.17 Uhr |
|
Zu "Präpositionen übernehmen eben oft die Kasusrektion von Synonymen und auch von Antonymen" (#29491): Das hat wohl mit solchen Reihenbildungen zu tun wie auf oder unter dem Tisch usw. Aber es kommt auch genau das Gegenteil vor, was manchmal lästig ist. Ich habe gerade keinen Beleg zur Hand, aber man liest oft etwa ohne oder mit einem ... oder mit oder ohne das ... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.07.2015 um 16.39 Uhr |
|
Zur Mode der "Konstruktionsgrammatik": „Und das Gesindel husch, husch, husch! Kam hinten nachgeprasselt. (...) Dies ist gleichzeitig ein Fall, der sich konstruktionsgrammatisch, nämlich durch Verwendung eines Geräuschverbs als Bewegungsverb, deuten lässt (vgl. Welke 2009).“ (Ingerid Dal, Hans-Werner Eroms: Kurze deutsche Syntax auf historischer Grundlage. 4. Aufl. Berlin, Boston 2014:131) Für eine solche Banalität muß man keine Konstruktionsgrammatik bemühen. Er pfeffert das Buch auf den Tisch – hier ist ein Würzverb zum Transportverb umgedeutet. (Von derselben Art sind übrigens viele Hinzufügungen in der Neufassung von Dals bewährtem Buch.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.07.2015 um 14.21 Uhr |
|
„laut ist eine Präposition (...), es stellt aber eine Konversion aus dem Adjektiv dar.“ (Kirsten Adamzik: Sprache - Wege zum Verstehen. 3. Aufl. Tübingen, Basel 2010:158) Natürlich nicht, es ist aus dem Substantiv konvertiert (< nach Laut + Genitiv), dieses früher aus dem Adjektiv. Heute wird die Präposition meist mit dem Dativ verbunden. Präpositionen übernehmen eben oft die Kasusrektion von Synonymen und auch von Antonymen. Aus demselben Buch: „Das Verb sich erinnern verlangt die Besetzung der syntaktischen Funktionen Subjekt, Akkusativobjekt und Genitivobjekt: Lady Macbeth erinnert sich des Mordes.“ (175) Preisfrage: Wo ist das Akkusativobjekt? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.07.2015 um 17.30 Uhr |
|
„Die Sprache der Hethiter (...) ist überliefert auf Tonscherben in babylonischer Keilschrift, die um 1905 in Anatolien gefunden wurden.“ (Hilkert Weddige: Mittelhochdeutsch. Eine Einführung. 7. Aufl. München 2007:2) Na ja, Scherben... Man schrieb damals auf Tontafeln; im Internet kann man auch hethitische sehen. „Die Begründung der vergleichenden Sprachwissenschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist eng verknüpft mit der Wiederentdeckung des altindischen Sanskrit (u. a. durch Friedrich von Schlegel und Franz Bopp).“ (Ebd.) "Wiederentdeckung"? War es denn in Vergessenheit geraten? Und die beiden Deutschen haben es weder entdeckt noch wiederentdeckt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.07.2015 um 15.14 Uhr |
|
(Da Rainald Goetz den Büchner-Preis bekommt, will ich nebenbei sagen, daß ich meinen Kolumnentitel "Abfall für alle" natürlich von ihm entlehnt habe, nicht als Plagiat, sondern als freundliche Anerkennung und weil er mir so gut gefiel.) Noch ein bißchen weiter, weil man ja aus Fehlern lernen kann: Elsen setzt ein Possessivpronomen mein, meine, mein an, ebenso dein, sein (Hilke Elsen: Grundzüge der Morphologie des Deutschen. 2. Aufl. Berlin 2014:247). Das sind jedoch die Formen des Possessivartikels (den sie nicht anerkennt). Das Pronomen heißt meiner, meine, mein(e). Vgl. Meiner ist angekommen. Daher muß sie später zugestehen: „Als reine Pronomen, also ohne ein folgendes Substantiv, erhalten sie aber eine Endung (...): Das ist meiner.“ Nur in dieser selbständigen Verwendung verdienen sie den Namen Pronomen, weil sie für eine Nominalphrase stehen. Die Distribution der Formen ist ganz verschieden. So steht es auch im Glossar, etwas anderes ist dort nicht vorgesehen: „Pronomen: Wortart, flektierbar nach Genus, Numerus, und Kasus und teilweise auch nach der Person. Das Pronomen, auch Fürwort genannt, hat als Hauptaufgabe, eine Nominalphrase zu ersetzen, ist meist deklinierbar, nicht steigerbar, hat keinen bestimmten Artikel, stellt jedoch keine einheitliche Klasse dar. Ein Pronomen kann allein ein Satzglied sein. Nach ihrer Funktion werden die Pronomina als Stellvertreter des Substantiv (Wortgruppe, Satz) definiert. Sie haben nur geringe eigene Bedeutung und sind grammatische Morpheme.“ Ein klarer Widerspruch also, mit dem man Studenten nicht allein lassen sollte. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 08.07.2015 um 12.35 Uhr |
|
Es gibt auch noch »den Ball spitzeln«, also mehr oder minder kunstvoll mit der Fußspitze spielen. Wenn man so etwas schon nicht weiß, sollte man wenigstens wissen, wo man es nachschlägt (DWDS z. B.).
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.07.2015 um 11.13 Uhr |
|
Betrachten wir exemplarisch eine exemplarische Wortbildungsanalyse! „Bei der Analyse eines derivierten Verbs, zum Beispiel im Satz Der Spion wollte seine Großmutter bespitzeln, müssen Sie zunächst die Infintivendung (sic) abtrennen, weil sie als Flexiv gilt. Dabei setzen Sie bereits voraus, dass Sie ein Verb analysieren. Die Wortart ist in jedem Falle anzugeben. (...) {-n} ist ein Allomorph zu {-en}. Es ist ein gebundenes, grammatisches Flexionssuffix. Nun ist die Struktur des Verbstamms bespitzel- zu bestimmen. Sie trennen das {be-} ab, dann müssen Sie entscheiden, zu welcher Wortart der Stamm spitzel gehört – es gibt kein Verb *spitzeln im Deutschen, es handelt sich also um ein Nomen. Dies ist nicht weiter zerlegbar, damit ist es eine Substantivwurzel, sie ist lexikalisch und frei. {be-} ist ein Derivationspräfix, es ist grammatisch, gebunden, nicht trennbar und bewirkt hier eine Wortartänderung, was bei der verbalen Derivation selten ist.(...) Es handelt sich bei der Wortbildungsart also um eine explizite Derivation, genauer Präfigierung. Nun schauen Sie in der Tabelle (37) in der dritten Spalte die Bedeutungsmöglichkeiten nach. Bei der desubstantivischen Ableitung mit {be-} treten gern ornative oder imitative Bedeutungsveränderungen auf. Über die Parapharase (sic) bespitzeln ‘sich verhalten wie ein Spitzel’ erkennen Sie in unserem Fall die imitative Bedeutung. Bei der Analyse können Sie schließlich noch ergänzen, dass es sich um ein produktives Wortbildungsmuster handelt.“ (Hilke Elsen: Grundzüge der Morphologie des Deutschen. 2. Aufl. Berlin 2014:217f.) Kommentar: Wie schon gesagt, ist das Infinitivsuffix kein Flexiv, sondern ein Mittel der nominalen Stammbildung. Die Behauptung, es gebe im Deutschen kein Verb spitzeln, ist falsch, dieses Verb ist reich belegt und in allen Wörterbüchern verzeichnet. Damit ist auch eine deverbale Ableitung ohne Wortartänderung zumindest möglich: spitzeln > bespitzeln. Die intransitive Paraphrase ‘sich verhalten wie ein Spitzel’ ist falsch und wäre es auch, wenn sie nicht dem transitiven bespitzeln gälte, sondern dem intransitiven, angeblich nichtexistenten Basisverb: spitzeln bedeutet, wie auch das große Duden-Wörterbuch vermerkt: „als Spitzel tätig sein“ (nicht „wie“, daher ist die „imitative“ Bedeutung ebenfalls hinfällig), und bespitzeln bedeutet „(als Spitzel) jmdn. heimlich beobachten, überwachen". Was bleibt also von dem Ganzen übrig? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.07.2015 um 12.11 Uhr |
|
Der methodische Grundfehler der heutigen Wortbildungslehren (etwa seit dem "Lehrbuchwechsel" von Walter Henzen zu Fleischer/Barz) besteht, wie gesagt, darin, daß man den historischen Bestand von Wortgebilden glaubt nach heutigen Regeln aus heutigem Material "erzeugen" ("generieren") zu können und zu müssen (vgl. hier). Nun könnte man sagen: Na und? Auch wenn es nur Simulationen sind, schaden sie doch nicht, es sind halt nützliche Fiktionen. Aber sie schaden sehr wohl. Regeln, nach denen man Dünung, Festung, Teuerung aus Düne, fest, teuer ableitet, gibt es im heutigen Deutsch nicht. In den Köpfen der Studenten setzt sich außerdem fest, daß diese Wörter historisch tatsächlich so entstanden sind, weil der Simulationscharakter der generativen Grammatik nicht immer und oft gar nicht klar ausgesprochen wird (und weil die Verfasser wohl selbst glauben, was sie da erzählen). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.07.2015 um 16.27 Uhr |
|
In fast allen neuen Wortbildungslehren (Fleischer, Wellmann, jetzt auch wieder Elsen) steht, daß bei Afrikaner usw. ein n zur Hiattilgung eingeschoben sei. In Wirklichkeit liegt, wie schon bemerkt, das lateinische -anus zugrunde (vgl. engl. African, American usw.), an das im Deutschen die "Adaptionssuffixe" (Kluge/Seebold) -er, -isch angefügt worden sind. Am Beispiel von Altmann/Kemmerling habe ich auch schon das typische Vorgehen der naiven Wortbildungslehre gezeigt: Festung wird wohl vom Adjektiv abgeleitet sein, wenn auch auf eine heute "unproduktive" Weise (Elsen 2014:87; statt vom mhd. Verb vesten). Ebenso Teuerung (zu mhd. tiuren, nicht zum Adjektiv). So denkt man sich etwas aus. Die Handbücher multiplizieren den Irrtum, und so liest man es dann in sämtlichen studentischen Arbeiten.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.07.2015 um 15.30 Uhr |
|
Lieber Herr Riemer, rein nach dem Wortlaut haben Sie recht, und ich würde Ihnen zustimmen, wenn ich es nicht besser wüßte. Solche Überlegungen haben wir nicht angestellt, sondern die Wendung (bei der es nicht auf das Verb "hauen" ankommt) war unmittelbar so gemeint und üblich, wie ich es dargestellt habe. Aber wer es nicht kennt, wird es wahrscheinlich nicht glauben. (Leider finde ich die Stelle nicht mehr im Original, werde mich melden, wenn ich noch einmal darauf stoße.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 02.07.2015 um 15.13 Uhr |
|
Was macht denn den Satz Der haut einen zu einer besonderen Wendung? Hauen ist ein sehr gebräuchlicher, kindlicher Ausdruck für schlagen. Das unpersönliche (Indefinit-)Pronomen einen wird, ähnlich wie man, sehr allgemein verwendet. Ich würde die Bedeutung nicht mit Der hat mich geschlagen wiedergeben, auch wenn man natürlich genau das daraus schließen kann. Aus Sicht des Kindes ist es aber etwas anderes. Auch ein Kind vermeidet ja nicht ohne Grund das Wort mich. Es schämt sich, die Schmach und Niederlage direkt zu nennen, zuzugeben, gehauen/geschlagen worden zu sein. Darum wählt es intuitiv diese unbestimmte Ausdrucksweise. Es meint, Man wird von ihm geschlagen oder Das ist einer, der andere einfach so schlägt. Es versteckt sich hinter dem Wort einen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.07.2015 um 06.38 Uhr |
|
Es ist schon ziemlich sonderbar, daß nun von vielen Seiten behauptet wird, die Sprachwissenschaft habe bisher fast nur die Schriftsprache oder "Sprache der Distanz" untersucht und solle sich nun der mündlichen Rede zuwenden, der "Sprache der Nähe" (das Ganze oft in den Begriffen von Koch/Oesterreicher, die ich schon kritisiert habe). Was hat denn die "positivistische" Germanistik seit dem 19. Jahrhundert alles zusammengetragen, die Dialektologie und der Sprachatlas und die Wörter-und-Sachen-Forschung? Nehmen wir Sütterlins Neuhochdeutsche Grammatik, von der leider nur der erste Band erschienen ist. Die Fülle mundartlicher Befunde erschlägt einen geradezu. Ich erinnere mich, wie ich eine Wendung las, die ich ganz vergessen hatte, die mir aber als Kind vertraut war: "Der haut einen!" (= "Der hat mich geschlagen!") Da befinden wir uns wirklich im Herzen der Sprache. Alle die theorielastigen neueren Arbeiten, die ich hier nach und nach vorstelle, sind weit davon entfernt, darum auch so öde zu lesen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.07.2015 um 06.36 Uhr |
|
Aber das soll nicht heißen, dass nicht mehrere sprachwandeltheoretische Gesichtspunkte nicht zu bedenken wären. (...) Die Einbeziehungen anderer sprachlicher Register ist eine junge Einsicht. (...) Gesichtspunkte, unter dem sich der seit dem Althochdeutschen so offensichtliche Abbauprozess betrachten ließ. (...) Unverzichtbar ist die Einbeziehung anderer Sprachregister als des der Literatursprache. (Aus der Einführung von Hans-Werner Eroms zur Neubearbeitung von Ingerid Dals „Kurzer deutscher Syntax“, Berlin 2014) Eroms sagt in seiner länglichen, ungelenk formulierten Einleitung immer wieder dasselbe: Grundlage ist die Schriftsprache, aber andere Register müssen einbezogen werden. Die Dialektforschung hat das immer getan. Eroms erwähnt nicht die Arbeiten von Havers, Sütterlin und vielen anderen, die durchaus das gesprochene Deutsch einbezogen und mehr Beobachtungen mitgeteilt haben als fast alle neueren Arbeiten. Das Beispiel der Hauptsatzstellung nach "weil" wirkt abgegriffen, ist auch kein bedeutsamer Fall von Sprachwandel – haben unsere Sprachwandeltheoretiker denn keine anderen, interessanteren Beispiele zu bieten? Kleinste Einsichten oder auch nur Ansichten werden als große wissenschaftliche Fortschritte ausgegeben. Zwischen den Zeilen läßt Eroms aber durchblicken, daß die älteren Grammatiken auch schon manches oder fast alles enthielten, was heute herausposaunt wird, z. B. zur „Grammatikalisierung“ oder zur „Monoflexion“ der Substantivgruppe. Das Buch soll nach Eroms ein „Werk für Studierende“ bleiben, wogegen aber der prohibitive Preis spricht. Während die vorige Auflage bei Niemeyer für 16 DM erhältlich war, verlangt de Gruyter nun 99,95 €. Dafür bekommt man eine wenn auch fehlerhafte Reformorthographie. Zum ersten Abschnitt, Genus, hat Eroms die Spekulationen von Leiss und Froschauer hinzugefügt, ohne die naheliegende Kritik daran zu erwähnen. Im Kapitel über Kasus und Valenz schließt sich Eroms der Forderung von Greule und anderen an, für historische Sprachstufen wie das Althochdeutsche eine „Prokompetenz“ zu entwickeln, die man dann gemäß den Postulaten der generativen Grammatik befragen kann, weil ja angeblich das intuitive Urteil des kompetenten Sprechers die letzte Instanz des Linguisten ist. Das widerspricht der Korpusorientierung. (Greule und sein Schüler Ágel sprechen auch von „Ersatzkompetenz“.) Sprachhistoriker wissen, daß die an Texten erworbene Kompetenz, zum Beispiel unsere Kenntnis des Lateinischen, ein unentbehrlicher heuristischer Leitfaden ist, daß aber stets das Korpus das letzte Wort hat und nicht die Intuition. Die Ersatzkompetenz kann nichts enthalten, was nicht aus den Texten stammt, dort also auch wieder aufgefunden werden kann und muß. Die vermeintlichen großen Fortschritte der „Valenz- und Dependenzgrammatik“ sowie der damit verbundenen „Tiefenkasus“-Theorie spielen in Wirklichkeit auch für Eroms keine Rolle. Die Rektion der Verben wird auch für historische Sprachstufen in derselben Weise dargestellt wie für die Gegenwart, wo es ja offensichtlich auch keiner besonderen Valenzwörterbücher bedarf (das Desaster der IDS-Unternehmungen wie VALBU beweist es). Auch im vorliegenden Fall reicht die traditionelle Darstellung, der Eroms im Grunde folgt, völlig aus, der modische Schnickschnack erledigt sich von selbst. Tesnière hätte gar nicht erwähnt zu werden brauchen. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 20.06.2015 um 01.13 Uhr |
|
Walter Momper fand seinen albernen Imperativ »Berlin, nun freue dich!« auch so schön, daß er ihn zum Buchtitel machte.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.06.2015 um 16.33 Uhr |
|
Noch zum Inflektiv (s. hier: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1044#29184 und hier: http://www.sprachforschung.org/?show=news&id=245#663) „Es bedarf keiner Erläuterung, dass vor allem durch die Inflektive, die sogar kombiniert oder in Verbindung mit anderen, auch komplexen Satzgliedern auftreten können - blödseiundgeradeaufgestandensei; aufschreidurchdiemengegehenhör, klappeaufreißundhandvorhalt, malsoebenmalindierundegähnentuumauchmalwaszusagen völlig neue morphologisch-syntaktische Möglichkeiten entstanden sind: Das Deutsche wird durch sie - sehr partiell freilich, da (zumindest vorerst) strikt textsortengebunden - zu einer polysynthetischen Sprache, in der das Verb einem vollständigen Satz entsprechen kann. Angesichts eines solchen Phänomens müssten sogar reine Systemlinguisten einräumen, dass sich die Gestalt der Sprache im Vergleich zum Neuhochdeutschen klassischer Provenienz gewandelt hat bzw. gerade dabei ist, sich zu wandeln. Man hätte hier ein handfestes 'innersprachliches' Kriterium im strukturalistischen Sinne, das für den Ansatz einer neuen sprachhistorischen Periode ins Feld geführt werden könnte.“ (Jochen A. Bär: „Bildwörter und Wortbildungen. Strukturelle Besonderheiten neumedialer Varietäten in sprachhistorischer Bewertung“. Germanistische Mitteilungen 59/2004, 65-81)(gekürzt) Ich halte das für weit übertrieben, und seither hat sich ja auch nichts getan, diese Formen und zum Teil doch sehr künstlich zusammengedrechselten Beispiele sind nicht in die allgemeine Sprache vorgedrungen. Gerade als Fälle von Scherzkommunikation festigen sie die Regeln, die sie spielerisch durchbrechen. Das Deutsche wird natürlich nicht zu einer polysynthetischen Sprache. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.06.2015 um 04.28 Uhr |
|
GRAMMIS (vom IDS): "Sätze wie die folgenden beiden sind syntaktisch korrekt gebildet, als ernstgemeinte Aufforderungen aber unangemessen. *Sei jung! *Sei haltbar!" Aber sei jung kommt oft vor, auch als Buchtitel. Ob "ernstgemeint" oder nicht - wo ist da die Grenze? (Aufforderungen, die man nicht wörtlich befolgen kann, werden bei Skinner unter "magical mands" behandelt, das ist viel besser als die pedantischen Bewertungen unserer Logizisten.) Ich kann auch nicht finden, daß der Imperativ "infinit" oder "semifinit" ist. Stirb ist eine finite Verbform, zweite Person Singular, kann auch durch das Pronomen erweitert werden: stirb du, du stirb. Das Imperativparadigma ist allerdings defektiv; es wird suppletiv teilweise aufgefüllt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.06.2015 um 17.24 Uhr |
|
Manche Grammatiker (IDS, Bredel/Töpel im Handbuch deutscher Wortarten von Hoffmann) sehen einen "nichtdirektiven" Gebrauch des Imperativs: Steh du mal morgens um fünf auf und halt um acht ein Referat. Komm du erst mal in mein Alter. Meiner Ansicht nach stimmt das nicht. Die Sätze sind ja nicht vollständig. Eine mögliche Fortsetzung wäre: Dann wirst du schon sehen, wie das ist. Das ganze Gefüge ist also konditional. Anstelle der Subordination drückt man sich umgangssprachlich gern koordinativ so aus: Stell dir vor ... dann ... - Das ist aber durchaus mit der direktiven, der Aufforderungsfunktion verträglich. An derselben Stelle (Bredel/Töpel) wird der "Inflektiv" ("Erikativ") als normale, bisher vernachlässigte Verbform behandelt, die auch eine eigene Syntax aufweise: dichganzfestknuddel. Ich halte die Form für eine Spielform und trotz weiter Verbreitung in Internet-Chats für einen Sprachscherz, der wahrscheinlich vorübergeht. Man kann Hunderte von Büchern und ganze Zeitungsjahrgänge lesen, ohne je auf diese Form zu stoßen, und das sollte doch zu denken geben. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 08.06.2015 um 15.55 Uhr |
|
Slawische Deutschlerner haben nicht nur mit den deutschen Artikeln, sondern auch mit dem deutschen Vorfeld-"es" Schwierigkeiten, weil es beides in ihren Sprachen nicht gibt.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.06.2015 um 06.02 Uhr |
|
Wir Muttersprachler bemerken kaum, daß das Vorfeld-es keine Kongruenz auslöst (Es waren einmal drei Brüder...) und daher eher wie eine unflektierte Partikel als wie ein Pronomen funktioniert, vgl. "Da waren einmal drei Brüder" oder "Einst lebte ein König...". Es hat keine Satzgliedfunktion und referiert auch nicht auf etwas. Ich nenne es daher auch Partikel-es. Zugleich tritt es sehr oft auf, eine echte Besonderheit des Deutschen. Trotzdem liest man in erstaunlich vielen Abhandlungen (wie hier schon gezeigt), es sei ein vorweggenommenes Subjekt, und Verwechslungen mit anderen Arten von "es" sind häufig. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 07.06.2015 um 22.07 Uhr |
|
Das deutsche war ist in allen drei Geschlechtern gleich, es hat ja keine Genusendung wie das tschechische byl, byla, bylo. Aber wenn es eine hätte, sagen wir war[m], war[f], war[n], dann gäbe es in dem Satz hinsichtlich des Verbs gar keinen Unterschied zum Tschechischen: Es war[m] einmal ein König, ... (Der einzige Unterschied ist nur, daß im Tschechischen das Vorfeld-es nicht benötigt wird.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.06.2015 um 16.27 Uhr |
|
Eigentlich nur "war", denn das Subjekt kommt ja noch. Danke für den Hinweis, das ist bestimmt ganz alte Tradition.
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 07.06.2015 um 13.39 Uhr |
|
Viele tschechische Märchen beginnen mit "Byl jedno jeden král." (War einmal ein König), worin das "byl" wörtlich nicht "es war", sondern "er war" heißt.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.06.2015 um 18.44 Uhr |
|
Die kanonische Stellung V-2 im Aussagesatz ist zweifellos erst in neuerer Zeit herrschend geworden. Anfangsstellung des Verbs dürfte indogermanisches Erbe gewesen sein, zur idg. Dichtersprache gehört ja die Standardformel âsîd râjâ... ("es war ein König") usw. Hildebrandlied: "want her do ar arme..." Paul erwähnt noch "Weiß Gott..." Elliptisch könnte man den Typ "Weiß ich doch nicht" nennen, wo das zuvor Gesagte apo koinou als Vorfeldfüller der eigenen Rede mitverwendet wird. Das sind also nur scheinbar Verb-Erst-Sätze. |
Kommentar von Bernhard Strowitzki, verfaßt am 05.06.2015 um 17.37 Uhr |
|
Nochmal zu Herrn Riemers Einwand wg. der Ellipse: Kommt eine Blondine zum Arzt und sagt: "Herr Doktor, ich habe so einen merkwürdigen Schmerz in der rechten Schulter." Sagt der Arzt: "Dann nehmen Sie doch den Papagei da weg." Das sind keine elliptischen Sätze (jedenfalls nicht so wie die anderen Beispiele), es fehlt ja nichts. Alle nötigen Satzglieder sind vorhanden, im Gegensatz zu Kann ich mir denken wo das Akkusativobjekt fehlt. Freilich könnte man durch Zufügen eines Platzhalter-es die normale Verbzweitstellung erzwingen, aber dann geht ja gerade der Witz verloren. Die nichtkanonische Satzgliedfolge bedeutet, wie Herr Ickler schon ausführte, eine besondere Betonungsstellung. Das führende es kommt erst sekundär hinzu, aus Systemzwang. (Sage ich einfach mal so, ohne Brugmanns Arbeit gelesen zu haben.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.06.2015 um 03.44 Uhr |
|
Die beiden Stellungstypen (Verbletzt im eingeleiteten Nebensatz, Verbzweit im Deklarativsatz) sind felsenfest im Deutschen verankert, die "Herausstellungen" bestätigen das nur. Der Umfang der "Füllungen" mag sich seit dem 19. Jahrhundert in gewissen Textsorten verringert haben. Mark Twain war nicht auf begriffliche Genauigkeit verpflichtet und sprach tatsächlich von "Parenthesen", obwohl es sich bei der Satzklammer um etwas ganz anderes handelt. Zuvor hatte er ausführlich die wirklichen Parenthesen besprochen, zu denen die Deutschen eine besondere Neigung hätten.
|
Kommentar von Horst Ludwig, verfaßt am 04.06.2015 um 18.26 Uhr |
|
Zur ersten: Ja, ein Verb kann erst anzeigen, was eigentlich Sache ist, wenn alles "Ad-Verbiale" und alle Ausrichtung klar ist. Das hilft zum rechten Verständnis dessen, was da mitgeteilt werden soll. - Zur zweiten: Man muß beim Deutschlernen schon übers Präsens und's Imperfekt hinaus mitmachen, wenn man Probleme mit dem Sachverhalt hier hat, - und dann hat man nur noch das erste Problem.
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 04.06.2015 um 13.13 Uhr |
|
Nach Mark Twain ("Die schreckliche deutsche Sprache") leidet die deutsche Sprache an zwei Parenthese-Krankheiten: Bei der einen steht das Verb ganz am Ende eines langen und komplizierten Satzgefüges und bei der anderen steht das Kern-Verb von "trennbaren Verben" am Anfang und die abgetrennte Verb-Ergänzung ganz am Ende eines langen Satzgefüges. Möglicherweise war das das Deutsch des 19. Jahrhunderts.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.06.2015 um 03.56 Uhr |
|
"Rechts" und "links" ist meine Konzession an die übliche Redeweise der Grammatiker, wobei mir schon bewußt war, daß ich damit der Schriftorientiertheit huldige, die ich sonst kritisiere. Die Alternative wäre "vorn" und "hinten" oder "früher" und "später", aber das ist nicht auf Anhieb klar. Natürlich folge ich mit der Grundordnung und den Variationen im wesentlichen der Auffassung der französischen Schule (Jean Fourquet, Jean-Marie Zemb). Zu Verb-Erst-Sätzen: O. Önnerfors: Verb-Erst-Deklarativsätze. Grammatik und Pragmatik. Stockholm 1997. Marga Reis: Anmerkungen zu Verb-erst-Satz-Typen im Deutschen. In R. Thieroff et al. (eds), Deutsche Grammatik in Theorie und Praxis. Tübingen 2000:215-227. Karl Brugmann nennt die Verb-Zweit-Stellung „gedeckte Anfangsstellung“ und weist darauf hin, daß in ugs. und lebhafter Rede die ungedeckte Anfangsstellung stets üblich geblieben ist. (Habe nun, ach ...) (Brugmann, Karl (1917): Der Ursprung des Scheinsubjekts 'es' in den germanischen und romanischen Sprachen. Ber. ü. d. Verhandlungen der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. 69. Bd., 5. Heft) Hermann Paul dazu: Dt. Grammatik III:71. Paul bezweifelt aber, daß der im Sturm und Drang beliebte Typ (Sah ein Knab...) eine direkte Fortsetzung des alten ist. Die Spezifizierungsrichtung wird natürlich besonders deutlich an den Zusammensetzungen (Kaffeefilter – Filterkaffee) und den Adjektivattributen. Nimmt man hinzu, daß die Nebensätze gar keine richtigen Sätze sind, leuchtet auch die Verb-Letzt-Stellung ein. Aber es ist klar, daß das Deutsche keine vollkommen strenge Serialisierung zeigt (welche Sprache hätte so etwas?), so daß die Typologen, die ja immer von diesem Kriterium Gebrauch machen, weiter streiten können. Attribute zum Beispiel dürften nicht nachgestellt werden, aber wir wissen ja, unter welchen Bedingungen sie das sogar müssen. In den meisten Grammatiken wird heute die Verb- oder Satzklammer eingeführt, als sei sie eine weitere Erscheinung neben den genannten Regeln, dabei ist es dasselbe. Vgl. etwa: „Das Deutsche weist gegenüber dem Englischen oder auch Französischen die Besonderheit auf, dass die Teile des Verbalkomplexes als diskontinuierliche Konstituenten auftreten und einiges dazwischentreten kann. Da diese Teile quasi einen Teil des Satzes einklammern, spricht man auch von der Satzklammer. ... Eine weitere (!) grundlegende Tatsache der Wortstellung im Deutschen ist, dass es drei Verbstellungstypen gibt (...) Verberststellung, Verbzweitstellung und Verbendstellung.“ (Karin Pittner/Judith Berman: Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. 2. Aufl. Tübingen 2007:79) Weinrich kennt auch noch eine Nominalklammer. Die Klammerwirtschaft kann, wie bei Weinrich, sehr kompliziert werden. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 03.06.2015 um 23.50 Uhr |
|
Wieso ist es eine berühmte Ausnahme, wenn ein es zu ergänzen ist, aber sozusagen eine ganz normale elliptische Konstruktion, wenn das oder ich zu ergänzen ist?
|
Kommentar von Bernhard Strowitzki, verfaßt am 03.06.2015 um 18.13 Uhr |
|
Ich will nicht beckmesserisch sein, aber der Ausdruck "von rechts nach links" setzt unsere normale Schreibrichtung voraus. Bei rein akustischer Sprache hat diese Formulierung keinen Sinn. Bei der zweiten Regel – zweifellos die Grundregel des deutschen Satzbaus – bleibt zu klären, was denn genau ein Satzglied ist. Das Spektrum reicht bekanntlich vom einfachen, inhaltslosen Platzhalter-es bis zu ziemlich (oder sogar unziemlich) länglichen, in sich hochstrukturierten Präpositional- und Nebensatzgefügen: Es wuchs ein Enzian. Auf dem kahlen, von den ständig wehenden Winden zerzausten Bergplateau, das sich in einigem Umkreis um den Betrachter erstreckte, zweitausend Meter und mehr über dem Meere, von dem hier freilich weit und breit nichts zu spüren war, gelegen, und das doch seine Herkunft aus urzeitlichem Meeresgrunde, dessen Sedimente zum Gebirge hochgedrückt worden und schließlich zum das ganze Plateau überziehenden Schotter zermahlen worden waren, nicht verleugnen konnte, wuchs ein Enzian. Gewichtiger finde ich allerdings eine der berühmten Ausnahmen, die von den Grammatikern bisher sträflich vernachlässigt wird, nämlich den Einleitungssatz zu einem Witz, der durch Spitzenstellung des Verbs gekennzeichnet ist: Kommt eine Blondine zum Arzt... Steht ein Mann vor einem Schaufenster... Zudem gibt es natürlichauch elliptische Konstruktionen: Kann ich mir vorstellen. Habe ich doch gleich gesagt. Zu ergänzen: Das Will mich darüber nicht streiten. Bin beschäftigt. Zu ergänzen: Ich (obwohl redundant) Nehmen wir noch die Spitzenstellung im Fragesatz und die Endstellung im abhängigen Satz dazu, wird die Sache schon recht verwickelt. Kein Wunder, wenn vor allem Fremdsprachler dabei immer mal stolpern. Wie hilft uns das jetzt aber weiter? Nochmal zum vorigen Beispiel: um den Baum fahren –> Ich fahre um den Baum –> ich bin um den Baum gefahren den Baum umfahren –> Ich fahre den Baum um –> ich habe den Baum umgefahren den Baum umfahren –> Ich umfahre den Baum –> ich habe den Baum umfahren Oder auch: durch das Holz bohren –> ich bohre durch das Holz –> ich habe durch das Holz gebohrt das Holz d[b]u[b]rchbohren –> Ich bohre das Holz durch –> Ich habe das Holz durchgebohrt das Holz durchbohren –> Ich durchbohre das Holz –> Ich habe das Holz durchbohrt |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.06.2015 um 12.27 Uhr |
|
„Das Phänomen nicht-kanonischer Nebensätze ist ein Thema, welches in der Sprachwissenschaft generell seit den späten Siebzigern (so z.B. in Davison, 1979) diskutiert wird und spätestens mit Fabricius-Hansen (1992) auch innerhalb der germanistischen Linguistik angekommen ist. Dass dieser Themenkomplex trotz seines Alters noch immer aktuell ist, zeigen kürzlich erschienene Sammelbände zu diesem Thema, wie sie etwa in Ehrich et al. (2009) und Aelbrechtet al. (2012) zu finden sind.“ Das zeigt, was heutige Germanisten unter der Geschichte ihres Faches verstehen. Die "nicht-kanonischen" Sätze aller Art sind bei Paul oder Blatz in größtmöglicher Ausführlichkeit abgehandelt worden (Paul wird aber in der Dissertation dieses Pioniers gar nicht erwähnt). Man hat der traditionellen Sprachwissenschaft ja geradezu vorgeworfen, sie enthalte mehr Ausnahmen als Regeln. Was sogar stimmt (dies ist übrigens ein nicht-kanonischer Nebensatz, auch als weiterführender Relativsatz bekannt), denn die Grundregeln erfordern viel weniger Platz als die tausend Erscheinungen, die eben die wahre Natur der Menschensprache zeigen. Die genannten älteren Grammatiker haben Sammlungen mit Hunderttausenden von Belegen angefertigt und führen das Nichtkanonische Seite um Seite vor. Wenn ich mir überhaupt die Mühe gemacht habe, jahrzehntelang ebenfalls Beispiele zu sammeln, dann nur, weil ich etwas aus der heutigen Sprache brauche. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.06.2015 um 17.16 Uhr |
|
Vor allem wenn die Schrift immer einbezogen bleibt, mag es ganz praktisch sein, von trennbaren und untrennbaren Verben zu sprechen. Die Schattenseite besteht darin, daß auf diese Weise niemals die Grundregeln der deutschen Wortstellung auf einfache und klare Weise vermittelt werden können. So ist denn auch kaum ein Ausländer vor einer fehlerhaften Verbstellung sicher. 1. Im Deutschen wird grundsätzlich von rechts nach links spezifiziert. 2. Die Personalform des Verbs steht im Aussagesatz nach genau einem Satzglied. 3. Enklitika folgen besonderen Tendenzen. Dazu ein Kapitel "Herausstellungen", also meist starke Topikalisierungen mit nachträglicher Einrenkung des Übrigen. Niemand wird wohl widersprechen, wenn ich Verstöße gegen die 2. Regel als den häufigsten einzelnen Fehler überhaupt bezeichne. Ich höre ihn täglich, z. T. bei lieben Freunden, und überlege immer, ob ich es korrigieren soll, weil es mir leid tut, daß sonst recht sprachgewandte Leute an dieser kleinen Schwäche, die auf falschem Unterricht beruht, wieder und wieder scheitern. |
Kommentar von Horst Ludwig, verfaßt am 02.06.2015 um 16.09 Uhr |
|
Zu #29036 / Der Name mag vielleicht nicht besonders glücklich gewählt sein: Beim Lehren bin ich eigentlich mit der Bezeichnung "Verben mit trennbaren bzw. untrennbaren Präfixen" ganz gut gefahren. Wichtig ist da nämlich die Möglichkeit der Kurznotierung "fahren, ä, u, ist/hat a" und dann dementsprechend "um'fahren, ä, u, [hat] a" bzw. "'um.fahren, ä, u, [hat] a", wobei in der Vokabelliste der Punkt zwischen Präfix und Infinitivstamm ein "erhöhter Punkt" sein soll, um anzuzeigen, daß es sich hier um ein trennbares Präfix handelt. (Zur Kurznotierung war auch ausgemacht, daß die Perfektzeiten mit "haben" gebildet werden, es sei denn, da steht vor der Information zur Form des Perfektpartizips ausdrücklich "ist". Wichtig ist dann fürs Lernen natürlich nicht, daß der Schüler das Schriftbild im Kopf behält, sondern jede Form gleich mehrmals in einem ganzen gesprochenen Satz verwendet, - übrigens mit "er" als Subjekt, denn es ist das kürzest mögliche, wozu dann einige KollegINNen aber vorschlugen, daß "es" angebrachter wäre. Aber ich blieb bei "er"; es hat viel längere Tradition.
|
Kommentar von Bernhard Strowitzki, verfaßt am 02.06.2015 um 14.42 Uhr |
|
Der Name mag vielleicht nicht besonders glücklich gewählt sein, aber "trennbare Zusammensetzungen" sind zumindest für den Eisenbahner kein Problem. (Was im Deutschen "Kurzkupplung" genannt wird, heißt auf Englisch "semi-permanently coupled".) Aber der Unterschied ich umfuhr ~ ich fuhr um ist doch keine Frage der Rechtschreibung. Form follows function. Deshalb irritiert ja auch z.B. ein Wahlwerbeplakat, auf dem ein Bonner OB-Kandidat sich anpreist mit "zusammen führen". |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.06.2015 um 16.05 Uhr |
|
Da haben Sie recht. Es gibt eben Präfixbildungen, Zusammensetzungen und Verbzusatzkonstruktionen. Mir hat spätestens seit jugendlicher Lektüre von Erich Drachs "Grundgedanken" nie eingeleuchtet, wieso es "trennbare Zusammensetzungen" bzw. "trennbare Verben" geben soll, wo es doch viel einfacher ist, sich die grammatische Analyse nicht von der Rechtschreibung diktieren zu lassen. Wenn der Fehler einmal gemacht ist, verdirbt er alle möglichen Abteilungen der Grammatik. Wirklich heikle Fälle gibt es genug, z. B. die "Tmesis": Da habe ich nichts von. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 01.06.2015 um 15.17 Uhr |
|
Wenn man schon von trennbaren und untrennbaren Verben spricht, ist es dann auch sinnvoll, beschließen als untrennbares Verb zu bezeichnen? Daß einfache Verben und solche mit einem Präfix wie be-, ent- ge-, ver- (kein Verbzusatz) nicht trennbar sind, ist doch in diesem Sinne trivial, oder?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.06.2015 um 06.14 Uhr |
|
Matthias Wermke: Deutsche Grammatik für Dummies. Weinheim 2015. Der Band stellt Grundregeln der deutschen Grammatik dar und versucht – dem Charakter der Buchreihe entsprechend – den Gegenstand durch einen unterhaltsamen, auch humorvollen Ton schmackhafter zu machen. Trotzdem bleibt gerade hier das Problem, daß der muttersprachliche Leser nichts Neues lernt, denn er beherrscht ja seine Sprache, und die Stellen, an denen er über die schriftsprachliche Norm im Zweifel sein könnte, könnte er leichter anderswo nachschlagen. So ist kaum jemand vorstellbar, der diesen doch recht umfangreichen Band wirklich durchliest; zum Nachschlagen ist er aber auch wenig geeignet. Anhangsweise werden einige weitere Zweifelsfälle behandelt, aber mit dem Duden, Band 9, ist der Leser in dieser Hinsicht besser bedient. „Ein Schweizer, nämlich der Genfer Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure (1857-1913), war es auch, der als Erster darauf gekommen ist, Wörter als sprachliche Zeichen zu betrachten.“ – „Wie jedes Verkehrszeichen, Hinweisschild oder Warnsignal haben auch die sprachlichen Zeichen zwei Seiten, nämlich eine Ausdrucksseite und eine Inhaltsseite. Die Ausdrucksseite ist das, was Sie sehen oder hören. Die Inhaltsseite steht für die Bedeutung, weshalb sie auch Bedeutungsseite genannt wird. Beide Seiten sind untrennbar miteinander verbunden.“ (50) Das Bild von den „zwei Seiten“ ist eher mystisch als wissenschaftlich. Wie soll man sich das eigentlich vorstellen, daß die Inhaltsseite „für die Bedeutung steht“? Diese abstruse Theorie hätte nicht erwähnt werden müssen, bleibt auch folgenlos für das Buch. Natürlich hat auch nicht erst Saussure entdeckt, daß Wörter sprachliche Zeichen sind, das war seit Aristoteles gar keine Frage. „Bei den trennbaren Verben wird das Partizip II mit ge- gebildet, bei den untrennbaren nicht: er hat aufgeschlossen, aber: hat beschlossen.“ (70) Also ausgeradiert? Der epistemische Gebrauch der Modalverben ist nicht gesondert besprochen. Der Ersatzinfinitiv wird zu Unrecht als obligatorisch vorgestellt: „Die Modalverben können kein Partizip II bilden. Es wird durch den Infinitiv ersetzt.“ (73, ähnlich 85) Das Komma nach Halbmodalverben drohen, pflegen – auch scheinen? – wird ausdrücklich als möglich bezeichnet, eine vielleicht ungewollte Folge der Rechtschreibreform. (83) Das Vorfeld-es wird mit dem Korrelat-es (Vorgreifer-es) verwechselt: Es wurde bei seiner Verabschiedung viel geweint. – „Weil dieses unpersönliche es eigentlich nur die Position des Subjekts besetzt, wird es auch Platzhalter-es genannt.“ (103) Er bedauerte seinen Ausraster bedeutet keineswegs dasselbe wie Er brachte sein Bedauern über seinen Ausraster zum Ausdruck. (105) Im ersten Fall fühlt er etwas, im zweiten Fall sagt er etwas. Das Wort Hausmeister ist nicht aus Haus und Service zusammengesetzt. (112) Die Kompositionsfuge ist nicht mit bestimmten „Buchstaben oder Buchstabenverbindungen besetzt“; es geht ja nicht um die Schrift. (112) In Willensstärke liegt nicht das Fugenelement -ens- vor. (113) Wischmopp ist nicht aus zwei Substantiven zusammengesetzt. (113) Die besondere Betonung von Steigerungsbildungen ist nicht erwähnt (weder bei Adjektiven noch Substantiven), sie sind umstandslos mit andersartigen Zusammensetzungen zusammengeworfen. Bei der Genusrektion der Substantive kann man nicht sagen, daß die regierenden Substantive das grammatische Geschlecht haben. Verben haben ja auch keinen Kasus, sondern regieren ihn eben. (120) (Auch 149 ist das Verhältnis wieder als „Übereinstimmung“ statt Rektion beschrieben.) Wenn man den Artikel „Geschlechtswort“ nennt, kann man nicht sagen, das Englische habe „nur noch einen Artikel (ein Geschlechtswort)“. (124) Die Artikellosigkeit tritt nicht nur bei „Paarformeln“ (Mensch und Hund) ein, sondern bei Aufzählungen beliebigen Umfangs. (133) Bei unserer Oma ihr klein' Häuschen liegt kein Genitiv vor, sondern Dativ. (141) Eine Präpositionalgruppe besteht aus einer Präposition und einer Substantivgruppe (nicht einem Substantiv). (142) Das Personalpronomen steht nicht für ein Nomen. (155) Es wird einerseits (an mehreren Stellen) gesagt, der bestimmte Artikel sei der Form nach mit dem Demonstrativpronomen der identisch („gleichlautend“), aber aus der Tabelle (163) geht hervor, daß das nicht zutrifft; das ist verwirrend. Der indirekte Fragesatz kann nicht als Relativsatz erklärt und umschrieben werden: „Ich sage euch, was Sache ist. (Anstelle von: Ich sage euch das, was Sache ist.)“ (171) Der Gebrauch des starken und schwachen Adjektivs ist nicht durchgehend richtig dargestellt. (179) Während Wermke nur einiges altes Gerümpel gelten läßt, sagt der Dudenband 9, daß heute die schwache Deklination überwiegt: einiges alte Gerümpel. Nicht nur zwei und drei, auch vier wird dekliniert: vierer. (189) Unter der „Grundzahl eins“ (188) verbergen sich verschiedene Dinge: erstens der unbestimmte Artikel ein, der auch zum Zählen benutzt wird – der unbestimmte Artikel wird an einer ganz anderen Stelle behandelt, obwohl das ganze Paradigma unter der „Grundzahl eins“ steht; zweitens das pronominale einer; drittens das Adjektiv: der eine usw. Daher stimmt es auch nicht, daß eins „keine Mehrzahl hat“ (189), vgl. die einen. Das Adjektiv selten gehört nicht in die Reihe der steigerbaren Adverbien. (194) In ab ersten Oktober regiert die Präposition nicht den Akkusativ, der vielmehr adverbial zu verstehen ist. (201) Wie könnten Subjekt und Prädikat nach der Person übereinstimmen, wenn das Subjekt eine Substantivgruppe ist? (221) Nicht alle Sätze mit Verb-Erst-Stellung sind Fragesätze. (229) Orson Wells hieß eigentlich Welles. (187) Das lateinische Sprichwort „Wenn auch die Kräfte fehlen“ ist von Ovid und nicht von einem imaginären Sextus Propotius (240). Dieselbe Anekdote aus einem Büchlein von Christian Stang wird zweimal erzählt. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 30.05.2015 um 23.11 Uhr |
|
In manchen Sprachen gibt es "historische Schreibweisen", die man einfach lernen muß. Leute mit Polnischkenntnissen werden das bestätigen.
|
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 30.05.2015 um 11.45 Uhr |
|
Oder genauer: Ich vermute, daß Sie wegen dieses Zischens das Stimmhafte nicht wahrnehmen.
|
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 30.05.2015 um 11.40 Uhr |
|
Vielleicht noch zur Verdeutlichung: Das z in zoon ist nicht minder stimmhaft als das s in Sohn, es wird nur weicher ausgesprochen. Die Stellung der Mundwerkzeuge ist dabei etwas anders, die Lippen sind leicht gerundet, der s-Laut wird weiter vorn gebildet, er zischt sozusagen mehr als im Deutschen. Mit Stimmhaftigkeit hat das alles aber nichts zu tun, denn die Stimmbänder schwingen bei zoon genauso wie bei Sohn. Ich habe den Verdacht, daß Sie dieses Zischen (oder wie immer man es nennen will) meinen, wenn Sie von »stimmlos« sprechen.
|
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 30.05.2015 um 10.53 Uhr |
|
Zahllose Beispiele finden Sie auch in Wictionary. Hier die Wörter aus Ihrer Liste: zwart (stimmhaft): https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Nl-zwart.ogg zien (stimmhaft): https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Nl-zien.ogg rotzooi (stimmlos): https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Nl-rotzooi.ogg |
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 30.05.2015 um 09.38 Uhr |
|
Lieber Herr Schäfer, achten Sie mal in diesem Beitrag hier: https://www.youtube.com/watch?v=d10VJvNROCM darauf, wie der Sprecher die Wörter zorg (0:30) und organiseren (0:32) ausspricht. Außer diesen Beispielen für ein stimmhaftes s am Wortanfang und im Wortinnern finden Sie in dem Beitrag auch gleich mehrere Beispiele für das stimmlose s, etwa in salariëring (1:01) oder signaleert (1:09). Man kann hier sogar das Phänomen der Assimilation sehr schön studieren. Aus dem stimmhaften s in zelf (2:19) wird in hetzelfde (2:24) ein stimmloses. |
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 30.05.2015 um 08.52 Uhr |
|
Lieber Herr Metz, ich habe selbst beinahe zehn Jahre lang in Amsterdam, Leiden und Den Haag gelebt und bin deshalb zumindest mit der holländischen Aussprache wohlvertraut. Letztere dominiert auch den staatlichen Rundfunk. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir ein Beispiel für die stimmhafte Aussprache eines s-Lautes im Nordwestniederländerländischen liefern könnten, und zwar unabhängig von der Verschriftung, die bekanntlich nicht in erster Linie dazu dient, die Aussprache wiederzugeben. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 26.05.2015 um 18.58 Uhr |
|
"I can't find any evidence that there is a British vs. American usage difference at play, either." – Dann hat er nicht danach gesucht.
|
Kommentar von Horst Ludwig, verfaßt am 26.05.2015 um 17.39 Uhr |
|
Zu #28966 "Sicherlich, aber dieses "is" findet man doch so häufig, daß ich gern mal von einem Muttersprachler oder sehr guten Sprachkenner hören würde, ob es falsch ist" Mein bester *native informant* hier am College, der ganz sicher gut schreiben kann, sagt erstmal: "The expressions "it is to do [with]" and "it has to do with [with]" are interchangeable. I can't find any evidence that there is a British vs. American usage difference at play, either." Und dann (zu #28970) spricht er, wie ich auch und viele in den USA, von "preferred spellings", also nicht einzig möglichen (wobei dann jede Abweichung falsch wäre), und demnach ist "organization [...] the preferred American spelling". Und "British usage generally uses "-ise" where American uses "-ize"", also *generally*; aber "[t]here are some curious anomalies": Wenn ich meinem Spell-Check "advertise" eingebe, teilt er mir mit ""advertise" is spelled correctly", aber gebe ich ihm "advertize" ein, versichert er mir: "Not in the Dictionary: advertize" und rät mir: "Change To: advertise". Ich vermute, das ist so wegen "advertisement", wo keine [z]-Aussprache interferiert, also nichts dazwischen funkt. Ich meine jedoch, dieses Substantiv auch schon mit [-taizmnt] gehört zu haben, und das wäre also "spelling pronunciation" aufgrund falscher Schreibung. Aber nichts ist verloren, denn jeder versteht doch sofort, was gemeint ist, und lacht nicht erstmal über einen Witz oder die unzureichende Bildung eines Mitbürgers dieses großartigen Landes der zwar nicht unbegrenzten, aber doch immer mehreren Möglichkeiten, wo's nicht was Vernünftiges behindert. So soll's jedenfalls sein und ist's hier wohl auch. |
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 26.05.2015 um 10.21 Uhr |
|
Was meinen Sie nun mit »Wörter wie zwart usw.«? Ihre Beispielliste enthielt ja auch das Wort »zien«. Soviel steht fest: Am Silbenanfang wird das z vor Vokal nicht, wie Sie schreiben, stimmlos ausgesprochen, sondern stimmhaft. Deshalb trifft Ihre Aussage für »zien« nicht zu. Und auch in »zwart« wird es in der Standardsprache stimmhaft ausgesprochen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen der »Bühnenhochlautung« und der etwas nachlässigeren Aussprache, wie man ihr zum Teil im Alltag begegnet. Das rechtfertigt aber nicht die Aussage, in »zwart« sei das z stimmlos auszusprechen. Vielleicht hat sich Ihre Lehrerin daran gestört, daß Sie es mit der Stimmhaftigkeit ein wenig übertrieben haben. Das stimmhafte deutsche s wird auch anders ausgesprochen als das niederländische z. Wenn Deutsche Niederländisch sprechen, erkennt man sie oft zuerst an den falsch artikulierten s-Lauten. Die Unterschiede zu lehren ist auch deshalb schwierig, weil einfach die Begriffe zu ihrer Beschreibung fehlen. In dieser Notlage mag ein Lehrer auf die Kategorie Stimmhaftigkeit/Stimmlosigkeit zurückgreifen, aber wirklich gerecht wird man dem Problem damit nicht. Im übrigen entspricht meine Darstellung nicht nur der in den einschlägigen Wörterbüchern und im Paardekooper, dem Standardwerk zur Aussprache des Niederländischen, sie hält auch durchaus dem Praxistest stand, glauben Sie mir. Noch mal genau hinzuhören kann natürlich nie schaden. Daß ich tagsüber im Außenministerium andere Laute vernehmen werde als heute abend auf dem Heimweg in der Straßenbahn, wenn sich die Fahrkartenkontrolleure miteinander unterhalten, versteht sich von selbst, ist aber hier wohl nicht das Thema. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 26.05.2015 um 09.32 Uhr |
|
Da Herr Metz im Haag wohnt, findet sich bestimmt eine Gelegenheit, mal hinzuhören. ;)
|
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 26.05.2015 um 09.12 Uhr |
|
Nein, Merr Metz, das ist nicht der Fall. Hören Sie mal genau hin. Als Hesse neige ich dazu, das stimmlose s meistens stimmhaft zu sprechen, und es bedurfte der energischen Intervention meiner Niederländisch-Lehrerin (Muttersprachlerin), mir diese Gewohnheit für Wörter wie zwart usw. auszutreiben.
|
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 26.05.2015 um 08.43 Uhr |
|
Im Niederländischen wird das z am Silbenanfang standardsprachlich stimmhaft ausgesprochen: zien, zomer, zwart. Daß es in rotzooi stimmlos ist, liegt an der Assimilation (das t von rot ist stimmlos); in zooi spricht man das z stimmhaft aus.
|
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 26.05.2015 um 07.15 Uhr |
|
Lieber Germanist, was das Englische und Niederländische angeht, irren Sie. Beispiele für das Englische hat Herr Ickler schon genannt, und im Niederländischen steht das z am Silbenanfang praktisch immer für das stimmlose s: zwart, zien, rotzooi.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.05.2015 um 17.10 Uhr |
|
Manchmal (*he haz, *she iz).
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 25.05.2015 um 14.57 Uhr |
|
Im Britischen Englisch, Niederländischen, Spanischen und Portugiesischen ist "z" der Buchstabe für das stimmhafte [s] und "s" der Buchstabe für das stimmlose [ß]. Im Französischen und Katalanischen ist es uneinheitlich.
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 25.05.2015 um 09.17 Uhr |
|
Vermutlich letzteres – vor dem Hintergrund, daß es immer unüblicher geworden ist, unabgekürzt zu schreiben oder gar zu sprechen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.05.2015 um 08.52 Uhr |
|
Die lautlichen Voraussetzungen des Konstruktionswechsels sind mir schon klar, aber, wie gesagt, ich halte sie nur für notwendig, nicht für hinreichend. Die Umdeutung muß für den Sprecher sinnvoll, die ältere Form nicht mehr zwingend sein. Entweder übt ein anderes Muster einen Sog aus, oder die bisherige Ausdrucksweise ist so abgeschliffen, daß sie nicht mehr analytisch verstanden wird (oder beides).
|
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 25.05.2015 um 07.00 Uhr |
|
Zu R. H.: Wenn diese Aussage zutrifft, dann ignorieren die Wörterbücher den britischen, australischen, neuseeländischen usw. Schreibgebrauch. Es gibt kaum eine Tageszeitung, kaum einen Buchverlag außerhalb Nordamerikas, der die z-Schreibung verwendet, es sei denn, es soll eine einzige Produktversion für den gesamten englischsprachigen Markt hergestellt werden. Witziges Detail am Rande: ISO-Normen müssen in internationalem, d.h. britischem Englisch verfaßt sein, weshalb nordamerikanische Unternehmen gerne fluchen, weil sie überall z in s, -er in -re oder -or in -our umwandeln müssen. Die in Genf (!) ansässige ISO nennt sich aber offiziell "International Organization for Standardization". Zu Herrn Markner und Herrn Ickler: "is" und "has" sind in der im Englischen üblichen gebundenen Aussprache oft kaum zu unterscheiden (besonders in Nordengland und in Schottland). Womöglich hat der "Fehler" auf diese Weise Eingang in die Hochsprache gefunden. Ähnlich beliebt, wenn auch wohl noch nicht von den Wörterbüchern als legitim anerkannt: "would of" statt "would have". Letzteres gilt aber gleichermaßen für Großbritannien und Nordamerika. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.05.2015 um 05.11 Uhr |
|
Das ist keine wirkliche Erklärung, denn bevor der Muttersprachler die Verkürzung "falsch" auflöst, muß er das "is" in diesem Zusammenhang für möglich halten. Andere Vorkommen löst er ja nicht so auf.
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 25.05.2015 um 01.32 Uhr |
|
Eine berechtigte Frage. Das zitierte Buch ist von der Cambridge University Press verlegt worden, welche in dieser Hinsicht der Oxforder Orthographie folgt – wohl mit Blick auf den amerikanischen Markt. Christopher Lyons jedenfalls lehrt in Salford, einer Vorstadt von Manchester. Es wird gemutmaßt, daß it is to do with eine Art Fehlinterpretation des in der Regel abgekürzt gesprochenen it has to do with sein könnte, also aus it's (got) to do with entstanden ist. Belege seit den 1980er Jahren z. B. bei Anthony Giddens. |
Kommentar von R. H., verfaßt am 24.05.2015 um 21.54 Uhr |
|
It may come as a surprise to many, but most authoritative UK English dictionaries prefer the -z- spelling (...), and have done so for decades. English (US) only allows -z- spellings, but other countries allow -s- & -z- interchangeably (...) https://rapidbi.com/organisational-organizational/ |
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 24.05.2015 um 19.58 Uhr |
|
Aber warum dann organization statt organisation?
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 24.05.2015 um 15.48 Uhr |
|
Das ist britisches Englisch, Amerikanern kommt es seltsam vor (und Deutschen womöglich auch).
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.05.2015 um 15.32 Uhr |
|
Sicherlich, aber dieses "is" findet man doch so häufig, daß ich gern mal von einem Muttersprachler oder sehr guten Sprachkenner hören würde, ob es falsch ist.
|
Kommentar von Klaus Achenbach, verfaßt am 24.05.2015 um 14.03 Uhr |
|
Vermutlich weil er meint, daß "has" an Stelle von "is" stehen müßte. Sonst ergibt der Satz auch aus meiner Sicht keinen Sinn. Im übrigen erschließt sich auch mit "has" der Sinn nur schwer, weil der Satz sehr schlecht aufgebaut ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.05.2015 um 04.55 Uhr |
|
In seinem "Handbuch" (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1044#23933) zitiert Ludger Hoffmann einen englischen Sprachwissenschaftler: „It appears that in these languages with no definiteness marking it is [sic!], as an element oft discourse organization, to do with whether or not a referent is familiar or already established in the discourse.“ (Ludger Hoffmann in ders., Hg.: Handbuch der deutschen Wortarten. Berlin 2009:304) Warum fügt er eigentlich [sic!] ein? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.05.2015 um 09.20 Uhr |
|
Am Anfang des genannten Buches referiert Hentschel unkritisch den bekannten Versuch von Bargh et al. Ich gebe die Darstellung aus Wikipedia wieder: Die Versuchspersonen sollten zunächst aus vier von fünf vorgegebenen Wörtern Sätze bilden, zum Beispiel aus „finds, he, it, yellow, instantly“ den Satz „he finds it instantly“. Dann sollten sie für eine zweite Aufgabe in einen anderen Raum am Ende eines Korridors gehen. Im Experiment ging es tatsächlich darum zu messen, wie lange die Probanden für die Gehstrecke benötigten. Die eine Hälfte der Versuchspersonen, die Experimentalgruppe, hatte Wortlisten bekommen, die Begriffe wie Florida, vergesslich, Glatze, grau oder Falte enthielten, also Wörter, die mit alten Menschen assoziiert werden. Diese Gruppe ging deutlich langsamer als die Kontrollgruppe, das heißt allein das Lesen bestimmter Wörter beeinflusste das Verhalten der Probanden, ohne dass diese davon etwas bemerkten. Sie wähnten ihr Verhalten als ihrer bewussten Kontrolle unterliegend. Dass der Effekt auch umgekehrt funktioniert, konnte Thomas Mussweiler zeigen. Seine Versuchspersonen sollten fünf Minuten lang langsam umhergehen. Anschließend konnten sie besser als die Kontrollgruppe Wörter identifizieren, die mit alten Menschen assoziiert werden. Dort wird jedoch auch mitgeteilt, wie umstritten die Versuche sind und wie schwer es war, sie zu reproduzieren. Skinner berichtet über ähnliche Vesuche: Probanden neigte angesichts einer Zahlenkolonne eher zum Addieren oder zum Multiplizieren, je nachdem, ob Skinner vorher unauffällig und tatsächlich unbemerkt entsprechende Wörter in seinen Vortrag eingeflochten hatte. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.05.2015 um 19.06 Uhr |
|
Ich habe noch ein wenig in dem zuletzt erwähnten Buch geblättert: „Wir finden nun im Dyirbal Beispielsätze wie die folgenden (...)“ (36) Die würden wir finden, wenn wir Dyirbal könnten; da wir es aber nicht können, finden wir die Beispiele nur in irgendwelchen Grammatiken. „Im Tamilischen richtet sich das Genus eines Wortes ausschließlich nach seiner Bedeutung.“ (69) Auch türkische Kasusformen werden angeführt. S. 51 wird der „Absentiv“ behandelt, obwohl es ihn gar nicht gibt. Die Transkription älterer Sprachen wie Sanskrit ist irreführend, da ohne Längenzeichen. Bei den chinesischen Zeichen S. 200 (men) ist ein Fehler unterlaufen, der die Pointe der Homophonen-Schreibweise verdirbt. Bei Pinyin-Umschriften werden die Töne mal markiert, mal wieder nicht. „Dominus 'Herr' ist maskulin, manus 'Hand' ist feminin und genus 'Geschlecht' ist neutrum. Alle drei Wörter enden auf -us, aber sobald man sie zu deklinieren beginnt, zeigen sie ein völlig unterschiedliches Verhalten: der Genitiv 'des Herrn' wird auf -i gebildet und lautet domini, der Genitiv 'der Hand' hingegen wird durch langes u ausgedrückt (manūs), und der von genus schließlich lautet generis. Dieses unterschiedliche morphologische Verhalten ist es, das für die Genuszuweisung ausschlaggebend ist.“ (69) Nein, das ist nur für die Deklinationsklassen ausschlaggebend und hat zunächst mit Genus nichts zu tun. Man denke an casus, wo der Genitiv ebenfalls ein langes u hat. Lat. accusativus soll auf einem Übersetzungsfehler beruhen, wie gehabt; immerhin wird „Ablativ“ nicht mehr von afferre abgeleitet. Zu der sehr vereinfachten Darstellung passen die meisten Literaturangaben nicht recht: hochtheoretische, meist englischsprachige Werke. Am Anfang wird der heilige Saussure referiert, samt neckischen Abbildungen aus dem "Cours". Das Buch ist in halb reformierter Mischorthographie gedruckt (Genus Verbi, aber Genitivus qualitatis usw.), dazu gibt es sehr viele Druckfehler. Stellenweise nervt der Plauderton: „Es hat sich also damals im System der Verschlusslaute so einiges getan.“ (123) Gefühlt alle vier Wochen erscheint eine neue Einführung in die germanistische Linguistik. Seit es flächendeckend dieselben Einführungskurse gibt, denkt sich mancher Dozent, daß man daraus doch gleich ein Buch machen könnte, auf der Grundlage der im Kurs benutzten Bücher. Sie gleichen einander wie Eier. Nur die Zahl der Fehler nimmt ständig zu - schon weil die Kenntnis von Sprachgeschichte und Wissenschaftsgeschichte immer mehr zurückgeht. Ich habe seit Jahren kein Einführungsbuch mehr gesehen, das man Studenten ohne Bedenken in die Hand geben könnte. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.05.2015 um 12.16 Uhr |
|
Über den Behaviorismus in der Spracherwerbsforschung schreibt Elke Hentschel: „Seine Vertreter wie der Linguist Leonard Bloomfield oder der Psychologe Burrhus Frederic Skinner sahen Lernen grundsätzlich als eine Veränderung des Verhaltens an, die durch Üben oder Beobachten und im Gefolge des Schemas Reiz-Reaktion-Konsequenz entsteht – also ganz so, wie das beim berühmten Pawlowschen Hund der Fall ist.“ (Elke Hentschel/Theo Harden: Einführung in die germanistische Linguistik. Bern 2014:162) Soviel Ahnungslosigkeit im Jahre 2014 ist eindrucksvoll. Das „Gefolge des Schemas Reiz-Reaktion-Konsequenz“ ist darüber hinaus eine preiswürdige Erfindung. Man kann sich vorstellen, was solche Absurditäten in den Köpfen der Studienanfänger für Schäden anrichten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.04.2015 um 17.14 Uhr |
|
Christopher Robin hat den Strukturalismus bündig zusammengefaßt: „He (nämlich Owl) can spell Tuesday so that you know it isn't Wednesday.“ |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.02.2015 um 14.10 Uhr |
|
„Wir benutzen die Sprache, um unsere Gedanken auszudrücken, Aussagen über die Welt zu machen, Anweisungen zu geben usw. Was läuft dabei in unseren Köpfen ab? Auf welche Kenntnisse müssen wir zurückgreifen können, damit wir sprachliche Äußerungen verstehen und produzieren können? Diese Frage steht im Mittelpunkt der linguistischen Forschung.“ (Schwarz, Monika/ Chur, Jeanette: Semantik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen 1993:13; ebenso in der 6. Aufl. 2014:15) Das ist der heutige Psychologismus: nicht das Sprachverhalten, sondern hypothetische Prozesse in den „Köpfen“ als Gegenstand der Sprachwissenschaft. Natürlich weiß niemand, was dabei in unseren Köpfen abläuft, und das wenige, was man weiß (stärker durchblutete Hirnregionen), nutzt der Sprachwissenschaft nicht im geringsten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.06.2014 um 06.05 Uhr |
|
Zu den vielen falschen Darstellungen des Dativus iudicantis paßt folgende Beobachtung: Nicht erst seit dem Roman von Heinrich Böll weiß jeder wache Bürger die Seriosität des Springer-Verlags und der „Bild“-Zeitung richtig einzuschätzen. Für Wulff übten deren Möglichkeiten dennoch eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. (FAZ 12.6.14) Dieses für entspricht dem Dativus iudicantis. Gemeint ist aber, daß Wulff selbst von dieser Anziehungskraft betroffen war, folglich müßte es auf heißen. Aber gegen das Umsichgreifen des für scheint kein Kraut gewachsen zu sein. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.05.2014 um 17.08 Uhr |
|
Ein (schlechtes) Einführungsbuch beginnt so: „Der Begriff Grammatik beinhaltet folgendes: - Grammatik als mentale Fähigkeit, d. h. das sprachliche Wissen, das jeder Sprecher besitzt, und das ihn in die Lage versetzt, Sätze in seiner Muttersprache zu produzieren und zu verstehen - Grammatik als Theorie bzw. Beschreibung dieser mentalen Fähigkeit.“ (Wöllstein-Leisten, Angelika u. a.: Deutsche Satzstruktur. Grundlagen der syntaktischen Analyse. Tübingen 1997. Unveränd. Nachdruck 2006:9) Der erste Schritt ist also die Psychologisierung des Gegenstandes. Das würde einem geradezu irrsinnig vorkommen, wenn man nicht wüßte, daß es auf Chomsky zurückgeht, der die Linguistik rundweg zu einem Zweig der Psychologie erklärte. Irrsinnig ist es immer noch. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.04.2014 um 17.11 Uhr |
|
Die bekannte schwedische Germanistin Inger Rosengren schrieb einmal: „Ilse Zimmermann hat uns bei der Formalisierung beraten, wofür ich ihr hier nochmals herzlich danken möchte.“ (Fs. Helbig 1995:104) Das heißt, die Verfasserin beherrscht den Formalismus selbst nicht - wie kann sie dann glauben, daß damit dem Leser etwas erklärt wird? Wer liest diesen Teil überhaupt? Es gibt Millionen Texte aus der Richtung der Generativen und Kategorialgrammatik voller Formalisierungen, die kein einziger Mensch je nachvollzogen hat. Bestenfalls überspringt man die Formeln, die ja meistens auch nur Pseudomathematik sind. |
Kommentar von Andreas Blombach, verfaßt am 05.04.2014 um 16.53 Uhr |
|
In der Kurzbeschreibung bei Amazon wird das Buch auch hiermit angepriesen: "Die Satzgliedanalyse sensibilisiert nicht zuletzt für stilistische Feinheiten literarischer Texte. Sie ist daher auch einem literaturinteressierten Germanistikstudenten von Nutzen." Nun ja. Von einem Büchlein mit 100 Seiten kann man eigentlich nur eine oberflächliche Darstellung erwarten; das muss ja auch nicht grundsätzlich schlecht sein. Ich vermute, dass das Buch in eine ähnliche Richtung geht wie "Fit für das Bachelorstudium: Grundwissen Grammatik" vom Dudenverlag? Wenn es sich an Erst- und Zweitsemester richtet, ist eine etwas flapsige Sprache vielleicht gar nicht so verkehrt – aber ich habe das Buch nicht gelesen, weiß nicht, wie es wirklich um die Ausdrucksweise steht, und möchte mir daher kein Urteil erlauben. Schüler verschont man hoffentlich auch weiter vor Valenz u.ä. "Die Valenz der Verben wird semantisch hergeleitet. Weil zum Rennen ein Renner gehört, fordert „rennen“ ein Subjekt. Allerdings gehört zum Rennen noch manches andere, was gleichwohl nicht in die Valenz des Verbs eingeht, und andererseits kann man sagen, daß rennen Spaß macht – ohne Subjekt. Diese Begründung in der Sachverhaltsanalyse gilt also nicht." Ich teile ja Ihre Kritik an solchen Herleitungen, möchte hier aber doch hinzufügen, dass rennen in einem Satz wie Rennen macht Spaß eben auch als substantiviertes Verb interpretiert werden kann (nach amtl. Regelwerk sind in solchen Fällen m.W. Groß- und Kleinschreibung erlaubt). Es ist in jedem Fall abstrakter als mit Subjekt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.04.2014 um 04.08 Uhr |
|
Der Verlag Carl Winter in Heidelberg war einmal berühmt für sprachhistorische Standardwerke. Neuerdings bringt er Bändchen heraus, die zwar immer noch in das vielversprechende Blau gekleidet sind, aber die Sprachwissenschaft in leichtverdaulichen Häppchen unters Volk bringen, zugleich ein Zeichen für das geringe Niveau, das heute in der Deutschlehrerausbildung angesetzt wird. Ich habe bei Amazon ein Büchlein besprochen, das erstaunlicherweise schon in dritter Auflage erschienen ist, also doch wohl in Seminaren benutzt wird: Renate Musan: Satzgliedanalyse. Das schmale Buch ist in einem sehr persönlichen, stellenweise geradezu aufgekratzten Ton verfaßt: Das Vorfeld liegt, wie der Name nahelegt, „na, wo wohl? - genau: vor dem Vorfeld“; „wir müssen also höllisch aufpassen“ usw. Es werden ausschließlich selbstgemachte Beispielsätzchen ("Hannibal rasiert seinen Elefanten") analysiert. Viele häufige Erscheinungen der wirklichen deutschen Sprache, z. B. der Ersatzinfinitiv, kommen daher gar nicht vor. Die Valenz der Verben wird semantisch hergeleitet. Weil zum Rennen ein Renner gehört, fordert „rennen“ ein Subjekt. Allerdings gehört zum Rennen noch manches andere, was gleichwohl nicht in die Valenz des Verbs eingeht, und andererseits kann man sagen, daß rennen Spaß macht – ohne Subjekt. Diese Begründung in der Sachverhaltsanalyse gilt also nicht. Warum stehen Subjunktionen in der linken Satzklammer? Das wird zwar weithin postuliert, aber eine Begründung wäre hilfreich, zumal für die hier angesprochenen Anfänger. Die Partikelverben sind sehr oberflächlich behandelt; „preisgeben“ ist falsch etymologisiert. Die Verfasserin benutzt zwar die reformierte Rechtschreibung, führt aber das nicht mehr zulässige „spazierengehen“ als Partikelverb (mit „spazieren“ als „Verb-Verbpartikel“!) an. Die bekanntlich sehr schwierige reformierte Groß- und Kleinschreibung wird auch nicht ganz beherrscht („Genera verbi“). Viele Aussagen sind so vereinfacht, daß sie geradezu falsch werden, z. B.: „Eingebettete Fragesätze sind im Gegensatz dazu (zu den freien Relativsätzen) immer Ergänzungen zu Verben des Fragens wie „fragen“ oder „wissen wollen“.“ Statt grammatisch zu argumentieren, gibt die Verfasserin solche Meinungsäußerungen: „Das erscheint mir weder sehr plausibel noch überzeugend.“ (Was ist eigentlich der Unterschied?) Der Leser wird mit solchen Ratschlägen bewirtet: „Kenntnisse zu den einzelnen Wortarten lassen sich sehr gut durch die Lektüre der Grammatiken des Deutschen vertiefen.“ Einige Literaturhinweise sind dann aber wieder zu "hoch" (etwa Dowty zu semantischen Rollen). Das Niveau und die Darstellungsweise sind eher an Schülern ausgerichtet; unter einer Reihe „Kurze Einführungen in die germanistische Linguistik“ stellt man sich etwas anderes vor. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 27.03.2014 um 00.14 Uhr |
|
Die Transliteration oder Umcodierung von Alphabet- in Nicht-Alphabetschriften und umgekehrt bereitet Schwierigkeiten, wie man an der hethitischen Keilschrift und dem Bibelhebräisch vor der Einführung der masoretischen Vokalzeichen sehen kann. Die Keilschrift ist eine Silbenschrift und kann einzelne Konsonanten nicht abbilden. Deshalb war sie eigentlich für die indogermanische hethitische Sprache nicht gut geeignet. Das ursprüngliche Bibelhebräisch war eine unvollständige Alphabetschrift, denn sie hatte keine Zeichen für Vokale, was bei Übersetzungen zu Mißverständnissen führte.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.03.2014 um 11.40 Uhr |
|
Eine solche Einschränkung auf Alphabetschriften kann ich in der Definition nicht erkennen.
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 26.03.2014 um 10.55 Uhr |
|
Die Wikipedia-Definition von "Code" trifft demnach am ehesten auf die Transliteration von lateinischen in griechische und kyrillische und altindische und vielleicht auch arabische Schriftzeichen und umgekehrt zu, also auf Alphabetschriften untereinander.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.03.2014 um 04.35 Uhr |
|
Der Begriff "Information" wird ebenso lax gebraucht. Obwohl an sich schon älter, soll er heute den Eindruck erwecken, als befinde man sich in der Informationstheorie. In Wirklichkeit läuft es auf die technizistische Paraphrase der uralten naiven Sprachtheorie hinaus, daß man nämlich Gedanken in Worte kleide, nach Art einer Übersetzung. In meinen Augen natürlich grundverkehrt. "Ein Code oder Kode ist eine Abbildungsvorschrift, die jedem Zeichen eines Zeichenvorrats (Urbildmenge) eindeutig ein Zeichen oder eine Zeichenfolge aus einem möglicherweise anderen Zeichenvorrat (Bildmenge) zuordnet.[2] Beispielsweise stellt der Morsecode eine Beziehung zwischen Buchstaben und einer Abfolge kurzer und langer Tonsignale (und umgekehrt) her." (Wikipedia) Vgl. auch Roy Harris: "The Grammar in Your Head". In: Blakemore, Colin/Greenfield, Susan (Hg.): (1987): Mindwaves. Oxford: 507-516. Bennett/Hacker sagen in ihrer Antwort auf Kritiker wie Dennett, Searle: A code is a system of encrypting conventions parasitic on language. A code is not a language. It has neither a grammar nor a lexicon (cf. Morse code). Knowledge is not encoded in books, unless they are written in code. One can encode a message only if there is a code in which to do so. There is a code only if encoders and intended decoders agree on encoding conventions. In this sense there isn’t, and couldn’t be, a neural code. In the sense in which a book contains information, the brain contains none. In the sense in which a human being possesses information, the brain possesses none. That information can be derived from features of the brain (as dendrochronological information can be derived from a tree trunk) does not show that information is encoded in the brain (any more than it is in the tree trunk). |
Kommentar von R. M., verfaßt am 25.03.2014 um 22.44 Uhr |
|
So ist es zwar gemeint, aber die Metapher ist nicht nur schief, sondern vor allem als Definition völlig ungeeignet.
|
Kommentar von Gunther Chmela, verfaßt am 25.03.2014 um 21.25 Uhr |
|
"Sprechen besteht im Verschlüsseln von Informationen nach einem bestimmten Code." Könnte man nicht (mit viel gutem Willen) die Sprache, in der die Information in Worte gefaßt wird, als den hier gemeinten "Code" der "Verschlüsselung" auffassen? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.03.2014 um 16.18 Uhr |
|
"Sprechen besteht im Verschlüsseln von Informationen nach einem bestimmten Code." (Eugen Hill: Einführung in die historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Darmstadt 2013:27) Der technizistische Ton ist irreführend. Was sollen diese Informationen sein, bevor sie verschlüsselt werden? "Die Konstruktion mit STEHEN zeigt dabei eine parallele Entwicklung wie die von lat. STARE, einem ursprünglich eine Körperhaltung kodierenden Verb, das zur Kopula im Altromanischen wurde und in die Domäne der ursprünglichen Kopula ESSERE eindrang." (Rosemarie Lühr) Auch das zeigt den laxen Umgang mit "kodieren". Eine Körperhaltung kann nicht kodiert werden. Alles nur leeres Gerede. Sprache ist ein konventionelles, erlerntes Verhalten, das eine bestimmte Funktion hat. |
Kommentar von ppc, verfaßt am 24.03.2014 um 18.38 Uhr |
|
Aus der Sicht der "Endanwender", d.h. derjenigen, die Texte lesen und verstehen wollen oder gar müssen, sind Sprüche wie "Komma ... nicht vom Sprachsystem abgedeckt .. systemwidrige .. nicht syntaktisch begründete .. durchlöchert..." der blanke Hohn beziehungsweise sogar grober Unfug. Wie jemand mal sagte "Der Mensch wurde nicht um des Gesetzes willen geschaffen, sondern das Gesetz um des Menschen willen", so sollen Kommas doch einfach nur das Lesen erleichtern, und das tun sie, indem sie die Struktur des Satzes deutlicher machen, als es ohne Kommas möglich wäre. Irgendwie kommt mir die genannte Formulierung so vor, als wolle jemand eine offensichtlich unsinnige Fehlentscheidung mit der Brechstange rechtfertigen, vielleicht um sich bei Frau oder Herrn Professor lieb Kind zu machen. Wie soll man mit diesem Geschwafel denn die üblichen, täglich zu lesenden (nein, ich meine nicht die FAZ oder ähnliche seriöse Zeitungen) Mehrdeutigkeiten vermeiden, die durch Kommasparwut entstehen? Ein pragmatischer und menschenfreundlicher Ansatz wäre: Komma zwischen Hauptsätzen immer dann, wenn es das (Vor-)Lesen erleichtert. Natürlich ist das dann nicht rein syntaktisch, sondern auch semantisch, aber kümmert das den Leser? Nein. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.03.2014 um 05.45 Uhr |
|
Marlon Berkigt: Normierung auf dem Prüfstand. Untersuchung zur Kommasetzung im Deutschen. Frankfurt: Peter Lang 2013. Es handelt sich um eine von Beatrice Primus betreute Dissertation. Für die Erkenntnis, daß die Kommasetzung syntaktisch bedingt ist, wird stets auf Primus verwiesen. Unter den vielen Autoren, die dies längst ebenso gesehen haben, sei Ulrike Behrens genannt („Wenn nicht alle Zeichen trügen: Interpunktion als Markierung syntaktischer Konstruktionen“ – 1989 im selben Verlag erschienen), die merkwürdigerweise nicht erwähnt ist. Der Verfasser untersucht die Kommasetzung zwischen koordinierten Hauptsätzen, bei erweiterten Infinitiven und bei Herausstellungen. Appositionen werden ebenfalls zu den Herausstellungen gerechnet („Das ist Angela Merkel, die Bundeskanzlerin.“ S. 15, vgl. S. 44). Das ist unüblich. Primus extrapoliert aus dem Schreibbrauch eine „im Schriftsystem verankerte Norm“ und erklärt dann, das bisher und seit langem übliche Komma zwischen Hauptsätzen, die schon durch eine koordinierende Konjunktion (und, oder) verbunden sind, sei „nicht vom Sprachsystem abgedeckt“ (31) – weil es nicht syntaktisch beschreiben werden kann. Die Reform habe diese systemwidrige Regel aufgehoben und sei nur noch durch eine nicht syntaktisch begründete Kann-Regel durchlöchert. Primus und ihre Schüler fragen sich nicht, ob ihnen vielleicht bei der Extraktion der Regeln aus dem Schreibbrauch etwas entgangen sein könnte. Die durchgängige syntaktische Beschreibbarkeit der Interpunktion (mit ihren eigenen syntaktischen Mitteln natürlich) ist ja nur ein Postulat, keine empirische Tatsache. Kurz gesagt: Eine Satzreihe ist keine Aufzählung. Es wird auch nicht gefragt, ob die Koordination von syntaktisch vollständigen Sätzen etwas ganz anderes sein könnte als die Koordination von Wortgruppen oder Wörtern. (Im Chinesischen zum Beispiel können dafür nicht die gleichen Konjunktionen gebraucht werden.) Es wird weiterhin aus dem Schreibbrauch eine Regel extrahiert, die die Kommasetzung bei Infinitiven an die Unterscheidung kohärent/inkohärent (im Sinne Bechs und Gallmanns) bindet. Gegen diese vermeintliche Regel verstößt nach Primus die Nichtsetzung des Kommas bei nichterweiterten Infinitiven mit zu (Berkigt Anm. 100). Obwohl es ein Hauptziel der Reform war, die Verbindlichkeit des Rechtschreibdudens aufzuheben, legt der Verfasser weiterhin den Rechtschreibduden zugrunde. Er sei weiterhin das Nachschlagwerk des „kompetenten Sprachbenutzers“, der seinerseits geradezu als der Dudenbenutzer aufgefaßt wird – womit er freilich als unabhängige Verkörperung des Sprachsystems, das der Nomierung gegenübergestellt werden könnte, ausfällt. (Vgl. S. 25) Die Frage, wie korrekt die Dudenredaktion das amtliche Regelwerk überhaupt darstellt und anwendet, wird nicht erörtert. Auch wissen viele kompetente Schreiber, zum Beispiel Sekretärinnen, entweder nicht, daß der Duden auch Regeln enthält, oder sie benutzen sie nicht, weil sie nur im Wörterverzeichnis nachschlagen. Der Verfasser beschäftigt sich an keiner Stelle mit dem amtlichen Regelwerk selbst. Das amtliche Regelwerk ist heute die gesetzte Norm. Ihr stehen zwei nicht aueinandergehaltene Normen gegenüber: die dem intuitiven Schreibbrauch inhärenten Regularitäten und die vom alten Duden direkt oder durch die Rechtschreiberziehung der Schreibenden verkörperte Norm. Dem Rechtschreibduden wird ausdrücklich bescheinigt, daß er keine wissenschaftliche Darstellung der Rechtschreibung ist. Warum hält der Verfasser sich nicht an das amtliche Regelwerk, das ausdrücklich diesen Anspruch erhebt und von dem die Verfasser selbst sagen, es sei kein populärer, unmittelbar anwendbarer Text? Welchen Sinn sollte es haben, die von den Kultusministern gesetzten Normen an den postulierten „Regularitäten des Schriftsystems“ zu messen? Die Rechtschreibreform hatte ja nie die Absicht, den vorfindlichen Schreibbrauch deskriptiv zu erfassen, sondern wollte neue Normen setzen, die auch von Wenigschreibern leichter zu befolgen sein sollten. Der empirische Teil untersucht die Kommasetzung der „Nürnberger Nachrichten“ über einen längeren Zeitraum. (Merkwürdigerweise hat sich der Verfasser weder bei der Redaktion des Blattes nach den hausinternen Regelungen erkundigt noch in Erwägung gezogen, welche Rolle die Rechtschreibprogramme spielen könnten.) Als Fazit bleibt, daß die „Nürnberger Nachrichten“ auch vor der Reform schon oft das Komma zwischen mit Konjunktion koordinierten Hauptsätzen weggelassen haben (die FAZ nur selten) und es nach der Reform noch öfter weglassen, weil es nun kein Fehler mehr ist. Bei erweiterten Infinitiven und Herausstellungen hat sich dagegen wenig geändert, für den Verfasser ein Beweis, daß die vorher herrschende Norm im ersten Fall systemwidrig war, in den beiden letzteren jedoch nicht, die vorübergehende Freistellung des Kommas bei Infinitivgruppen also überflüssig war. Wie jeder Schüler weiß, ist es leichter, Kommas wegzulassen, als sie an den richtigen Stellen zu setzen. Insofern ist das Weglassen der Kommas durch die Zeitungsleute kein Beweis für ein zugrunde liegendes System, sondern allenfalls ein Hinweis auf die Schwierigkeit einer gehobenen Interpunktion, die ihren guten Sinn haben könnte, auch wenn Primus sie nicht als syntaktisch motiviert beschreiben kann. Wie die satzinterne Groß-und-Kleinschreibung sich keineswegs mit einer Wortartunterscheidung deckt, sondern durch raffiniertere Gesichtspunkte der leserfreundlichen Textgestaltung überformt sein kann, so ist es auch bei der Kommasetzung vorstellbar. Es gibt einige Druckfehler, auch Namen sind falsch geschrieben (Ehrlich statt Ehlich, Burckhart Garbe statt Burckhard). Die Anmerkungen 19 und 51 sind identisch; auch sonst wird oft wörtlich wiederholt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.02.2014 um 15.28 Uhr |
|
In der Grundschulgrammatik vom Dudenverlag heißt es, Konkreta seien Nomen (gemeint sind Substantive), mit denen man Lebewesen und Gegenstände bezeichnet, die man sehen, hören, anfassen kann, mit Abstrakta solche, die man fühlt, sich denkt oder vorstellt. Also die naive ontologische Zweiteilung der Welt. Als Beispiel für Abstrakta wird "Musik" genannt, obwohl jedes Kind einwenden wird, die sei doch hörbar. Darauf gibt auch die Lehrerhandreichung keine Antwort. Viel Spaß, ihr Grundschullehrerinnen!
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.02.2014 um 06.01 Uhr |
|
Dyirbal ist das Hätschelkind der Sprachwissenschaftler, weil es einerseits ausführlich beschrieben, andererseits praktisch ausgestorben ist: "Dyirbal gehört zu den Pama-Nyungan-Sprachen und wird in Australien gesprochen. Die Sprache ist fast schon ausgestorben: 2001 gab es (laut Dixon in einem Fax) nur noch sechs Sprecher, alle über 65-jährig. Dank der Sprachbeschreibung von R. M. W. Dixon (1972) ist das Dyirbal schon lange bekannt für seine Ergativität, die sich sowohl in der Morphologie als auch in der Syntax auswirkt. Ein weiteres Kennzeichen der Sprache ist die Einteilung in vier Nominalklassen, von denen die zweite Bezeichnungen für "Frauen, Feuer und gefährliche Dinge" umfasst (Buchtitel von George Lakoff 1987)." (Wikipedia) Man liest also nun sehr viel über "Ergativität" (auch im Deutschen), andererseits ist Lakoff ja sehr in Mode (s. meine Bemerkungen über Metapherntheorie). Wenn man irgendwo das Dyirbal erwähnt findet, sollte man nicht weiterlesen, es kann sich nur um Angeberei handeln, im besten Fall um ein methodisches Versagen. Man muß sich das einmal richtig vorstellen: In einer lückenhaften und auch empirisch oft unangemessenen Darstellung der deutschen Sprache von Dyirbal oder Mongolisch zu reden! Wie konnte es soweit kommen? In dem besprochenen Handbuch kommen die großen deutschen Grammatiken (Paul, Blatz, Sütterlin mit ihrer Fülle an tatsächlich beobachteten Einzelheiten) nicht vor, sind offenbar gar nicht bekannt oder wurden wegen vermeintlicher Überholtheit nicht einmal aus dem Regal geholt. Das merkt man auch daran, daß grammatische Begriffe, die im 19. Jahrhundert ganz geläufig waren und es unter sprachhistorisch Vorgebildeten ununterbrochen geblieben sind, auf ganz rezente Autoren zurückgeführt werden. |
Kommentar von Bernhard Strowitzki, verfaßt am 12.02.2014 um 20.17 Uhr |
|
Ohne mir sofort alle Kritikpunkte zu eigen zu machen oder das Werk oder die Autoren im einzelnen zu kennen: Über irgendwelche angeblichen Eigenschaften der Dyirbal-Sprache daherschwätzen, aber nicht wissen, was bahuvrihi bedeutet – das sind mir die Richtigen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.02.2014 um 05.39 Uhr |
|
Elke Hentschel/Harald Weydt: Handbuch der deutschen Grammatik. 4. Aufl. Berlin/New York 2013. Das Buch benutzt immer noch das generische Femininum, obwohl doch die deutsche Standardsprache dargestellt wird, zu der es nicht gehört und niemals gehören wird: „Die normative Grammatik möchte ihren Leserinnen sagen, wie man korrekt spricht/schreibt.“ (6) Usw. Auch alternierend: beispielsweise im Kapitel über den Artikel ist ständig von der Sprecherin und dem Hörer die Rede. Geradezu irreführend sind solche Sätze: „Die ‚erste Person‘, ich, bezeichnet die Sprecherin, die ‚zweite‘, du, den Angesprochenen.“ (219) Der Gewinn dieses Privatsprachgebrauchs besteht nur darin, daß man ständig merkt, wie ernst es den Verfassern mit der Gleichberechtigung ist. Ob eine deutsche Grammatik aber der richtige Ort für solche Bekundungen feministischer Rechtgläubigkeit ist, sei dahingestellt – zumal angesichts vieler sachlicher Mängel, die ich gleich nachweisen werde. Ausländern sollte man ein solches Buch jedenfalls nicht in die Hand geben. In Elke Hentschel (Hg.): Deutsche Grammatik. Berlin/New York 2010 war das generische Femininum übrigens schon aufgegeben worden. Die Wortarten oder partes orationis werden üblicherweise nicht „Verbalklassen“ genannt. (13) Der Hund heißt auf chinesisch nicht gu. (13) (Auch nicht gao, wie in der ersten Auflage.) Das palatalisierte t‘ in russ. bit‘ ist phonetisch nicht dasselbe wie das t in dt. Tier. (2) Das Vorfeld im Aussagesatz ist nicht die „Subjektposition“. (14 und später zu es) Von den drei Beispielen für Ablaut (21) ist nur eines richtig, die anderen beiden zeigen Umlaut. Daß die Verbindung spazieren gegangen nicht durch andere Satzteile unterbrochen werden darf (25), trifft nicht zu: Spazieren bin ich mit dir schon lange nicht mehr gegangen. (Die Darstellung der Verbzusatzkonstruktionen - „trennbaren Verben“ - ist nicht nur hier kritisierbar.) „So wurde kennen lernen bis zur Rechtschreibreform 1996 als ein Wort aufgefaßt und entsprechend zusammengeschrieben; nach den nun geltenden Regeln kann es wahlweise auch als zwei Wörter betrachtet und getrennt geschrieben werden.“ (12) (In der vorigen Auflage hieß es: „So wurde kennen lernen bis zur Rechtschreibreform 1996 als ein Wort aufgefaßt und entsprechend zusammengeschrieben; seither wird es als zwei Wörter betrachtet und getrennt geschrieben.“ (14)) (s. dazu „Grammatica ancilla orthographiae“) Im klassischen Latein usw. soll das Personalpronomen „regelmäßig weggelassen“ worden sein („sog. 'pro-drop'-Sprachen“) (16) Vgl. Sprachen, „die das Subjekts-Pronomen regelmäßig nicht ausdrücken“ („pro-drop-Sprachen“) (219) – Das ist eine bedenkliche Sicht, die bei Chomsky und anderen darauf hindeutet, daß sie das Englische als Muster im Sinn haben. Im Lateinischen wurde ja nichts „weggelassen“. In Ich esse einen Apfel soll der Apfel das „Ziel“ sein – ziemlich seltsam. Die Ausführungen über das Englische (33, zu Aspekt und Aktionsart) sind in einer deutschen Grammatik fehl am Platz, zumal ja nicht ausdrücklich vergleichend vorgegangen wird. „Bei unpersönlichen Verben, deren logisches Subjekt in einem obliquen Kasus steht, kann das grammatische Subjekt es sogar ganz weggelassen werden, wenn das logische Subjekt die erste Stelle im Satz einnimmt: Es graut mir/Mir graut.“ (55) Das ist falsch. Vielmehr gibt es zwei Varianten: Mir graut/Mir graut es. Zur ersten gibt es die Umstellung Es graut mir (mit Vorfeld-es), zur zweiten die Umstellung Es graut mir (mit formalem Subjekt es). Zur Verwechslung der verschiedenen es beim unpersönlichen Passiv s. u. *Ich laiche *Du blühst *Wir misslingen (55) Hentschel erklärt diese Formen für „nicht möglich“. Später kommt sie auf Märchen usw. zu sprechen, wo dergleichen doch vorkommt – was soll es also in einer Grammatik? Jeder muß doch wissen, was er sagen will. Du blühst: 27 000 Belege bei Google (allein in dieser Abfolge gesucht). Ich laiche kommt bei Jean Paul vor und auch sonst. Wir sind mißlungen, spotten die Atheisten. „Sätze wie Er lebt oder Ich liege (ohne Ergänzungen wie etwa in Berlin/im Bett) sind zwar äußerst selten, können jedoch unter bestimmten Bedingungen durchaus vorkommen: Gott sei Dank, er lebt! Sitzt du oder liegst du? - Ich liege.“ (58f.) Das ist doch ganz normal. Ein Merkmal „intensiv“ soll das Müssen vom Sollen unterscheiden, das ist offenbar falsch oder trifft nur in besonderen Fällen zu. Außerdem ist „intensiv“ nicht definiert. Anscheinend soll es einen Grad an Verbindlichkeit oder Dringlichkeit bedeuten, aber das ist schwer objektivierbar. Eisenberg hält aussehen, schmecken, riechen usw. für Kopulaverben, die mit einem prädikativen Adjektiv verbunden werden. Hentschel gesteht zu, daß in „vergleichbaren Konstruktionen“ des Englischen ein Adjektiv steht, verweist aber auf andere Sprachen, die wie das Serbische hier ein Adverb verwenden. Das ist methodisch bedenklich, weil die Frage im Deutschen entschieden werden muß und schon der Hinweis auf „vergleichbare“ Konstruktionen eine Petitio principii darstellt. Hentschel fährt fort: „Semantisch liegt in der Tat eine nähere Bestimmung des Aussehens, Schmeckens, Riechens, also des im Verb ausgedrückten Vorgangs, und nicht eine Eigenschaft des Subjektes vor. Dies spricht gegen die Annahme, dass es sich hier um Kopulakonstruktionen handelt.“ (63) Aber wenn jemand blaß aussieht oder etwas bitter schmeckt, geht es doch nicht um Vorgänge. Vielmehr sind es synonymische oder troponymische Varianten von scheinen oder eben sein. Ein Infinitiv möchten existiere noch nicht (66), es gibt aber durchaus Belege: ]Ohne vorgreifen zu möchten, kann ich vorab sagen, dass wir die Maschine nun seit über einem Jahr in Gebrauch haben, am Tag durchschnittlich 3 große Tassen Kaffee damit machen und wir bis jetzt keine großen Nachteile feststellen konnten. Windows ist voll von Funktionen, die hellsehen, was der Nutzer zu möchten hat. Gegen Eisenbergs Beispiel eines Passivs von Modalverben Der Friede wird von allen gewollt: „Solche Bildungen sind jedoch äußerst selten und werden auch nicht von allen Sprechern akzeptiert.“ (Sie sind nicht selten, aber es handelt sich um Vollverbverwendung.) „Ein Beispiel für diesen südlichen deutschen Sprachgebrauch bilden die Erzählungen des alemannischen Schriftstellers J. P. Hebel, die ausschließlich im Perfekt gehalten sind.“ (95) (Das steht fast gleichlautend in allen Auflagen seit 1990.) Hebels Erzählungen sind durchweg im Imperfekt gehalten, die alemannischen Gedichte gattungsbedingt fast nur im Präsens. Zur Imperativbildung: „Bei der 2. Person Singular wird die Personen-Endung -st durch ein -e ersetzt, wobei das Personalpronomen ebenfalls entfällt: du gehst > gehe! Das -e der Imperativendung wird im modernen Sprachgebrauch meistens weggelassen: hör mal!, komm mal her! usw. Ein evtl. Umlaut wird bei der Bildung des Imperativs rückgängig gemacht: du läufst > lauf(e)!“ (110) Das ist wohl die seltsamste Herleitung von Imperativen, die je in einer Grammatik gestanden hat. Die Genera des Verbs werden auf sonderbare Art erklärt. Zum Aktiv heißt es: „Er liest einen Groschenroman. (...) Die Handlung geht vom Subjekt aus und zielt auf das Objekt, was man etwa so symbolisieren kann: S→v→O“ (113) „Handlung“ ist ein semantischer Begriff, „Subjekt“ und „Objekt“ sind syntaktische Begriffe. Was soll es heißen, daß die Handlung auf das Objekt zielt? Jemand setzt sich der Stimulation durch ein Buch aus, das nennt man lesen. Die „symbolische“ Darstellung ist ungeeignet, der grammatischen Tatsache der Transitivität etwas hinzuzufügen. Obwohl die Verfasser wissen, daß es im Deutschen kein Medium gibt, konstruieren sie ein solches: „Das Buch verkauft sich (gut). Die Handlung geht nicht wirklich vom Buch aus, aber sie zielt auch nicht einfach nur auf das Buch; es wird eine mittlere Position zwischen diesen beiden Möglichkeiten eingenommen.“ (114) Wenn man sich klarmacht, daß es hier um den Buchabsatz geht (das Buch wird viel verkauft), kommt einem eine solche Paraphrase der „Handlung“ ziemlich sinnlos vor, erst recht die Graphik mit dem in sich zurücklaufenden Pfeil, der eine Art Reflexivität suggeriert Eher könnte man die Möglichkeiten der Rezessivbildung (Valenzminderung) diskutieren (vgl. the book sells well). „Beim unpersönlichen Passiv wird das Subjekt nur formal durch das Pronomen es ausgedrückt, das bei entsprechender Satzstellung auch weggelassen werden kann.“ (115) Da ist wieder die Verwechslung des formalen Subjekts mit dem Vorfeld-es. Das Subjekt wird beim unpersönlichen Passiv gar nicht ausgedrückt, und das Vorfeld-es wird ganz unabhängig davon eingefügt. Es „kann“ daher auch nicht nur, sondern muß bei anderer Vorfeldfüllung wegfallen: Es wurde viel gelacht. *Viel wurde es gelacht. (Dieser Fehler steht schon in der ersten Auflage 1990:118) Zur „gemäßigten Kleinschreibung“ 134. 130: zum Partizip I zu streng formuliert, vgl. meinen „Kritischen Kommentar“. Der Infinitiv lasse kein Subjekt zu (128) – hier hätte man eine Stellungnahme zu Alle mal herhören! usw. erwartet. Wieso steht bei mein geliebter Freund „das Ergebnis der Handlung selbst im Vordergrund“ ('mein Freund, der von mir geliebt wird')? (131) „Synchron gesehen weist das Deutsche drei Infinitiv-Endungen auf: -en, -eln und -ern.“ (Ebenso schon 1990) Wieso das? Das l und das r gehören doch zum Stamm und gehen durch alle Flexionsformen durch. Vgl. sagen – sagst sammeln - sammelst Das Richtige steht in den älteren Grammatiken. Sütterlin: „Die Endung lautet -en: reiten, rechnen, atmen; nach der nachtonigen Stammsilbe -el- oder -er- steht nur -n: heucheln, wandern.“ (274, ähnlich Duden Bd. 9 s. v. Infinitiv.) Wieso ist Geist ein Abstraktum? (135) Weil man den Geist nicht anfassen kann? Sprachlich wird Geist als Körperteil behandelt, wie die Bahuvrihis (Kleingeist) und der Pertinenzdativ (Du gehst mir auf den Geist) beweisen. Genitive auf -s von weiblichen Eigennamen sollen nur in Possessivkonstruktionen vorkommen, nicht nach Präpositionen *unweit Mariannes und Verben *Wir gedenken heute Mariannes. (140) (Ebenso 143: *Ich kann mich Brigittes nicht entsinnen, *wegen Evas) Vgl. aber Wir gedenken Katharinas in der Messe... Auf dem Bild oben rechts sieht man den Haupteingang des Instituts mit einer Inschrift, die Maria Theresias gedenkt. (http://www.werbeka.com/schloss/tschech/hradd.htm) Der Apostroph in Ingrid's Imbissbude wird nicht nur im Rechtschreibduden toleriert, sondern entspricht der amtlichen Regelung. (144) Ablativ wird, wie schon in der ersten Auflage, irrigerweise von afferre abgeleitet. (154) Die Lehre von der angeblichen Fehlübersetzung „casus accusativus“ wird wiederholt. (172) Dir ist wohl langweilig? ist kein Beispiel für einen Dativus iudicantis (169). Die Deutung der Bahuvrihis als eigener Typ der Substantivkomposition wird mit Coseriu und Fleischer abgelehnt; es seien einfach Determinativkomposita in Pars-pro-toto-Funktion. (176) Das ist aber falsch, sie sind anderer Herkunft und wurden im Sanskrit auch anders betont. (Wie schon 1990 wird bahuvrihi falsch übersetzt: „Reis besitzend“ statt „Vielreis“ - übrigens ein Gegenbeispiel gegen die Behauptung, jemand werde „mittels eines charakteristischen Körperteils benannt“.) Bei Afrikaner ist kein n zur Tilgung des Hiats eingefügt, sondern diese Suffigierung geht bereits auf das Lateinische (vgl. Scipio Africanus) zurück; das deutsche Suffix tritt verdeutlichend hinzu. Bei Zusammenbildungen wie einarmig (204) wäre das Zusammenspiel mit den Bahuvrihis zu erwähnen. Bei den Adjektiven auf -bar (206) wäre zwischen der älteren, nicht mehr produktiven Schicht der Desubstantiva und den neueren, ausschließlich herrschenden Deverbativa zu unterscheiden. Die Präposition bis soll weitere Präpositionen regieren. Aber es ist gleichgültig, daß nach bis oft Präpositionalphrasen stehen; die Verfasser geben selbst zu, daß auch andere Adverbialia stehen können. Dasselbe gilt für außer, denn es ist Zufall, daß bei außer bei Regen eine „weitere Präposition“ folgt. Das Kapitel über den „Absentiv“ ist überflüssig, da es keinen Absentiv gibt. „Wer hat sein Geld noch nicht abgeholt? Frauen haben kritisch auf diese Kongruenz hingewiesen, dies besonders, wenn sich wer eindeutig auf eine Frau bezieht (Wer möchte seinen Mann mitbringen?), als paradox bis diskriminierend empfunden wird.“ (229f.) Das stand so schon in der ersten Auflage von 1990, nur daß es hieß: Bewußte Frauen haben ... Sogar die skurrilen Einfälle Luise Puschs aus den 80er Jahren (das Professor) werden weitergeschleppt. (154) *nach Ansicht vierer Kommissionsmitglieder soll falsch sein (236), vgl. aber: Kommentare vierer namhafter Theoretiker (SZ 5.2.09) Da durchsuchte die Polizei die Wohnungen vierer Mitglieder. (FR 10.5.13) und viele andere Beispiele „Nicht nur die Zahlen von eins bis zehn, sondern auch elf und zwölf werden mit einfachen Wörtern benannt.“ (236) Daraus läßt sich aber sprachvergleichend nichts gewinnen, weil elf und zwölf auch nur verdunkelte Zusammensetzungen sind. Sie lassen in anderer Weise, als die Verfasser meinen, das Duodezimalsystem durchschimmern. Gegen das Argument, als und wie hätten keine Kasusrektion und seien daher keine Präpositionen, wenden H/W ein: „Zum einen könnte es Präpositionen dann logischerweise überhaupt nur in Sprachen geben, die über Kasus verfügen; zum anderen ist auch auch in solchen Sprachen nicht automatisch sichergestellt, dass jede Präposition jederzeit auch einen Kasus verlangt.“ (257f.) Es wird dann auf türkische Postpositionen eingegangen. Aber das ist unzulässig, falls man nicht von vornherein Universalität der Wortarten postuliert. Die Verfasser weichen immer wieder auf andere Sprachen aus, um irgend etwas zu beweisen. Wenn das richtig wäre, dürfte zum Beispiel auch die Flektierbarkeit keine Rolle als Wortartmerkmal spielen, weil es ja flexionslose Sprachen gibt usw. - welches Merkmal gibt es denn in allen Sprachen ohne Ausnahme? Keine epistemischen Modalverben bei weil? (265) Das ist fraglich. „Auch bevor und ehe können in Satzgefügen stehen, zwischen deren (stets negierten) Teilen ein konditionales Verhältnis besteht: Bevor du dich nicht entschuldigt hast, rede ich kein Wort mehr mit dir.“ (273) Das ist stark übertrieben! „Die Konjunktion als drückt zwar gewöhnlich Gleichzeitigkeit aus, kann aber auch zum Ausdruck von Vor- und Nachzeitigkeit verwendet werden: Als Herta in Belgrad war, regnete es. (gleichzeitig) Als endlich alle da waren, konnte die Sitzung beginnen. (vorzeitig) Kaum waren die letzten eingetroffen, als die ersten schon wieder gehen mussten. (nachzeitig)“ (277) In allen Fällen kann man Gleichzeitigkeit erkennen: Genau dann, als alle eingetroffen waren/als die ersten gehen mußten ... „Als kann ausschließlich mit Tempora der Vergangenheit stehen.“ (277) Hier sollte auf das historische Präsens hingewiesen werden, das sich gut mit als verträgt. Bei den Modalpartikeln sollte (wie schon in früheren Arbeiten der Verfasser) der Betonungsunterschied berücksichtigt werden: Der ist ja heiß! vs. Der ist aber heiß! (286) Interjektionen wie schwupps, zack, rumms werden zwar wie Adverbialien in den Satz integriert, bleiben aber intonatorisch abgehoben. (298ff.) Das Vorfeld-es wird ausdrücklich als Vorwegnahme des Subjekts angesehen (322ff.). Es ist aber nicht einzusehen, in welchem Sinn das es das Subjekt vorwegnimmt und in welcher grammatischen Beziehung die beiden Teile zueinander stehen könnten. Auch für die Satzteile werden stillschweigend universale Definitionen angestrebt, sonst könnte der Ansatz, Prädikate über Verben zu definieren, nicht mit dem Hinweis auf Russisch, Türkisch oder Mongolisch zurückgewiesen werden. Aber für wirklich universale Definitionen ist der Horizont der Verfasser auch wieder nicht weit genug. Sie wären auch für den Leser einer deutschen Grammtik nicht besonders nützlich. Was bedeuten „Substantiv“ und „Verb“ in Sprachen, die für beides dieselben Numerus- und Possessivsuffixe verwenden oder „Verb“-Formen (weil sie auf Partizipien zurückgehen) nach dem Genus bzw. Sexus flektieren? „Nach Helbig/Buscha steht das Objektsprädikativum auch nach den Verben finden und halten für. Diese beiden Verben gehören zwar semantisch in dieselbe Gruppe, stellen aber insofern Sonderfälle dar, als finden mit Adjektiven verbunden wird (vgl. *Ich finde ihn einen Trottel, aber: Ich finde ihn trottelig) und halten für eine präpositionale Rektion aufweist.“ (2013:311, ebenso schon 1990:312) Ich finde ihn einen wesentlich interessanteren Spieler als Thomas Müller. (Sehr viele Belege dieser Art!) Das Baumdiagramm zu Die Ente hat gequakt nimmt eine halbe Seite ein (wie so manches andere in diesem nichtgenerativistischen Handbuch), aber der Leser weiß nicht, warum da ein Subjekt bewegt und eine Spur zurückgeblieben sein soll. Wortreste sollen nur dann durch sowie verbunden werden können, „wenn bereits zwei vorausgehende Teile durch und verbunden sind (...): Es gibt Kurz- und Mittel- sowie Langstreckenraketen.“ (269) Das ist falsch. Gerade das vorangehende Beispiel Vor- und Nachteile kommt sehr oft auch einfach mit sowie vor. „Während das Subjekt von Ich koche die Suppe eindeutig agentivisch ist, also eine willentliche Tätigkeit ausführt, ist das Subjekt von Die Suppe kocht ein sog. Experiencer, also ein Jemand oder ein Etwas, dem eine Handlung widerfährt.“ (319) Das entspricht nicht der üblichen Definition von „Experiencer“ (worunter eine wahrnehmungsfähige Größe verstanden wird), sondern trifft auf den Patiens zu. Die gelegentlichen Ausflüge in die Theorie der Tiefenkasus sind hier, wie in anderen Grammatiken, wenig überzeugend. Bei den wenn-Sätzen (325) ist die eigentliche Problematik übersehen, nämlich die Möglichkeit, solche Sätze nachgestellt ohne Korrelat-es wirklich als Subjekt- oder auch Objektsätze zu gebrauchen: Mich macht wütend, wenn ich dich nur sehe. Für die Forschung könnte sich auch als Hemmschuh erweisen, wenn Patente auf Gene allzu pauschal erteilt werden. (FAZ 21.3.02) Am schlimmsten aber wäre, wenn zugelassen würde, daß nach einer anonymen Geburt die Meldung an das Personenstandsregister vernachlässigt würde. (FAZ 26.5.04) Mit Objektsatz: Wer könnte verantworten, wenn ganze Staatsbudgets in Afrika zusammenbrechen? (SZ 6.6.07) Wir können nicht ignorieren, wenn 22 von 27 Staaten innerhalb Europas einen Mindestlohn haben. (SZ 24.12.07) Inneres Objekt und kognates Objekt sind nicht dasselbe. (329) Zu außer („verkapptes Objekt“): Außer einer Scheibe Brot habe ich heute noch nichts gegessen. „Formal liegt hier ein Attribut vor.“ An der Stelle von nichts könne auch z.B. nur Obst stehen. (329, ebenso 1990) Aber ist es dann noch Attribut? „nur [Obst außer einer Scheibe Brot]“? Die Beispielsätze Gib das, wem du willst und (?) Sie entsann sich mühelos, wessen sie wollte (338) sind an dieser Stelle ungeeignet, da sie nicht einfach „Relativsätze ohne Beziehungswort“ zeigen, sondern das ganze andere Problem der Kasusattraktion, das aber hier verborgen bleibt wegen des identischen Verbs in beiden Teilen, im Relativsatz elliptisch. Besser wäre: Gib das, wen du liebst und Sie entsann sich nicht, was sie einkaufen wollte. Die Beurteilung der Grammatikalität dürfte dann anders ausfallen. Nicht vergleichbar ist daher auch der Satz mit Korrelat und verschiedenem Verb: Sie entsann sich dessen, was er ihr gesagt hatte. (ebd.) Die Ausdrücke besonders gern und besonders heute (357) sind nicht vergleichbar. Wenn meine Wut auf ihn mit der Adjektivkonstruktion ich bin auf ihn wütend zusammengestellt wird, bleibt unklar, wo der „verbale Ausdruck“ zu sehen ist. (361) Appositionen mit als und wie werden nicht als Appositionen anerkannt (369). Zur Begründung wird ausgeführt: „Appositionen sind syntaktisch nebengeordnet, d. h. sie stehen auf derselben Ebene wie ihr Bezugswort.“ Aber wenige Seiten vorher waren Appositionen als eine besondere Form des Attributs definiert worden (265), und Attribute sind ihren „Bezugswörtern“ bestimmt nicht nebengeordnet. Das Genitivobjekt bezeichnet nicht „den Teil eines Ganzen“ (337), sondern das Ganze, von dem nur ein Teil betroffen ist. Deshalb spricht man ja auch vom Genitiv des geteilten Ganzen. Zu *Sie ist wohnhaft/*Er ist gebürtig: „Da unser Weltwissen uns sagt, dass jeder Mensch (irgendwo) geboren oder wohnhaft ist (...), ist eine solche Äußerung ohne zusätzliche Angaben sinnlos und verstößt damit gegen allgemeine pragmatische Prinzipien der Kommunikation.“ (Es folgt ein Hinweis auf Grice) Das ist nicht schlüssig. Wenn sich etwas von selbst versteht, muß es ja gerade nicht erwähnt werden. Mit dieser Begründung wird z. B. Das Huhn legt, Die Frau erwartet wieder, sie hat nicht verhütet usw. erklärt. Die richtige Erklärung ist vielmehr, daß der Ausdruck einer Relation sinnlos ist, wenn die Relata nicht erwähnt sind. Daher der Scherz: Quizmaster: Was ist der Unterschied? Kandidat: Zwischen was? Quizmaster: Tut mir leid, helfen darf ich Ihnen nicht. „Enge Appositionen bei Personalpronomina können im Unterschied zu anderen engen Appositionen flektiert werden: mir Unglücksraben, dich Angsthasen. (Ausnahme: beim Anredepronomen Sie können im Dativ keine engen Oppositionen gebraucht werden: *Ihnen Rohling)“ (So schon 1994) Aber es gibt Belege wie: Dass Ihnen Dummkopf der Unterschied zwischen Klage einreichen und Anklage erheben nicht geläufig ist, das wundert mich nun wirklich nicht. (Internet) Warum sollten Schaltsätze „Metakommentare“ sein und nicht einfach Kommentare? (373) Wieso ist Oma Duck arbeitet den ganzen Tag, Franz Gans faulenzt überhaupt eine Satzreihe? Ist jeder Text eine Satzreihe, oder hängt es von der Interpunktion ab? Kommt er heute nicht, kommt er eben morgen. (374) Das soll eine asyndetische Satzreihe sein, aber da die Satzreihe als Verbindung von Hauptsätzen definiert ist, stimmt das nicht, denn es handelt sich ja um ein Satzgefüge mit einem uneingeleiteten Nebensatz. So wird derselbe Satz später auch nochmals eingeführt (386). Engl. lies und lice werden immer noch (wie 2003) als Beispiel homophoner Wörter angeführt, die durch die Schreibweise disambiguiert werden. Der orthographisch relevante Unterschied zwischen Auto fahren und schlafwandeln ist nicht der Grad der Durchsichtigkeit, sondern daß es ich fahre Auto, aber ich schlafwandele heißt. (443) Als Zugabe enthält das Buch eine Kurzdarstellung verschiedener Grammatikmodelle. Einige Druckfehler: lehnt (statt lehnen S. 169) aggultinare (wie in der 1. Auflage 1990) Lux statt Luchs (149) Porte-manteau-Morphem (214) müßte nach der Neuregelung Porte-Manteau-Morphem geschrieben werden (üblicher ist Portemanteau oder Portmanteau). gibt = gibt es (240) Die Schauspielerin in „Casablanca“ hieß Bergman, nicht Bergmann (schon in der 1. Aufl. 1990). Die Verfasser schreiben zwar reformgetreu Genus Verbi usw., aber vorreformiert Genitivus rei, materiae, auctoris, Dativus commodi, incommodi, iudicantis. subsummieren (297) bleibt auch nach der Reform falsch. mnemotchnisch (315) Dazu kommen gelegentliche Kleinschreibungen wie im allgemeinen und einige falsche Silbentrennungen. Umfangreiche Zitate aus dem Werk von Hennig Brinkmann (1971) sind in Reformschreibung umgesetzt. (405f.) Für ein „Handbuch“ wird zuviel diskutiert: die Erwähnung sehr vieler anderer Meinungen widerspricht dem Zweck eines Nachschlagewerks. Was für Syntaxmodelle es gibt, ist vielleicht Stoff für einen Einführungskurs (hier ist es im Stil vergangener Jahrzehnte gehalten), aber nicht für ein Handbuch. Was soll ein kurz erwähntes Modell, das mit „Spuren“ arbeitet, dem Leser dieser konventionellen Grammatik bringen? In Ihr seid beide gekommen wird auch als Diagramm dargestellt, wie das Pronomen aus dem Prädikat herausbewegt worden sei und dabei eine Spur namens t (für trace) zurückgelassen habe. Aber welche Einsicht folgt daraus für den Benutzer dieser Grammatik? Er wird an dieser Stelle nicht einmal darüber belehrt, warum an der Spitze des Baumdiagramms ein „IP“ = Inflection steht. Anderswo tauchen unerklärte „empty elements“ auf. Autoren, mit denen sich die Verfasser immer wieder auseinandersetzen, sind besonders Zifonun et al., Eisenberg, Engel, Brinkmann (auf diesen wird der Begriff „Zusammenbildung“ zurückgeführt, was gewiß unnötig ist). (Hennig Brinkmann wird als „jüngerer Vertreter“ der inhaltsbezogenen Grammatik gegenüber Leo Weisgerber bezeichnet. Das stimmt zwar, aber der Altersunterschied betrug nur zwei Jahre. Im Gegensatz zu Gipper gehört Brinkmann nicht zu einer folgenden Generation.) Besonders störend sind die Hinweise auf andere Sprachen in dieser keineswegs kontrastiv angelegten Grammatik: „Wenn man nun Sprachen wie Dyirbal und Deutsch miteinander vergleicht ...“ (316) Aber die Verfasser kennen die besprochene Einzelheit über das Dyirbal nur aus zweiter oder dritter Hand und können nicht beurteilen, was sie da gelesen haben. Es wäre sehr zu wünschen, daß das zur Zeit unvermeidliche Dyirbal auch einmal wieder aus deutschen Grammatiken verschwände. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.02.2014 um 18.42 Uhr |
|
Im "Handbuch der deutschen Grammatik" von Hentschel/Weydt steht von der ersten Auflage (1990) bis zur vierten (2013), im Wortlaut nur leicht variiert: „Ein Beispiel für diesen südlichen deutschen Sprachgebrauch bilden die Erzählungen des alemannischen Schriftstellers J. P. Hebel, die ausschließlich im Perfekt gehalten sind.“ (2013:95) Hebels Erzählungen sind durchweg im Imperfekt gehalten, die alemannischen Gedichte gattungsbedingt fast nur im Präsens. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.02.2014 um 16.49 Uhr |
|
Übrigens kann man einen etwas peinlichen Einblick in den Wissenschaftsbetrieb nehmen, wenn man sich die zuletzt hier eingerückten Anmerkungen bei amazon ansieht und auf den "Kommentar" klickt - aus der Feder eines aufstrebenden Untergebenen der Herausgeberin: http://www.amazon.de/Deutsche-Grammatik-Gruyter-Lexikon-Hentschel/dp/3110185601/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1391528079&sr=1-6&keywords=hentschel+grammatik Zu seinem Glück liest niemand das Buch geschweige denn meine Besprechung geschweige denn den verborgenen Kommentar zu meiner Besprechung... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.01.2014 um 17.34 Uhr |
|
Noch eine meiner amazon-Besprechungen: Elke Hentschel (Hg.) Deutsche Grammatik. Berlin/New York 2010 (de Gruyter) Das Buch gehört zu der immer noch wachsenden Reihe von Einführungs- und Nachschlagwerken, die vom Linguistik-Boom der letzten Jahrzehnte übriggeblieben sind. Es enthält eine verhältnismäßig kleine Auswahl von Stichwörtern, deren einige zudem recht entbehrlich scheinen: „gemäßigtes Splitting“ oder „nonprogressiv“ zum Beispiel oder auch „Ablativ“ und „Gerundium“ - beides gibt es ja im Deutschen nicht, weshalb auch keine deutschen Beispiele angegeben werden können. Mehrere Einträge kommen in fast identischem Wortlaut ein zweites Mal vor, nämlich als Teil größerer Kapitel, also etwa „generisches Maskulinum“ noch einmal unter „Genus“ usw. Im übrigen gibt es viele Einträge, die lediglich Verweise auf andere enthalten, wodurch die Seiten oft sehr locker bedruckt wirken und das ganze Werk tatsächlich in einem kleineren Taschenbuch unterzubringen gewesen wäre. Der feministische Tick des „Handbuchs der deutschen Grammatik“ von derselben Verfasserin (in Zusammenarbeit mit Harald Weydt) ist aufgegeben: Das generische Femininum, eine sehr störende Marotte, kommt nicht mehr vor. Der sogenannte „Absentiv“ wird auch wieder behandelt, obwohl es ihn nicht gibt (vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1278) „Mir ist kalt“ soll Dativus iudicantis sein (59). Das ist falsch, da es sich nicht um das Urteil, sondern die tatsächliche Beeinträchtigung handelt, also eher incommodi. „So kann ein Adjektiv wie gleich normalerweise aus semantischen Gründen nicht gesteigert werden; ein Satz wie Manche Tiere sind gleicher als andere ist jedoch trotzdem sofort verständlich.“ (9) Das trifft nicht zu, der Satz kann vielmehr nur in dem außergewöhnlichen Zusammenhang von Orwells Roman verstanden werden. Seine augenscheinliche Absurdität ist gerade die Pointe innerhalb dieses Buches. Gelegentlich werden Restbestände der generativen Grammatik in Erinnerung gerufen: „minimalistische Theorie, minimalistisches Programm Das minimalistische Programm ist eine Weiterentwicklung der Generativen Grammatik Chomskys, die er in den 1990er Jahren vorgelegt hat. Dabei wird das zuvor sehr aufwendige Regelwerk radikal reduziert mit dem Ziel, ein möglichst ökonomisches Modell vorzulegen.“ Das ist alles. Man erfährt nichts Spezifisches, es ist ein ganz unbrauchbarer und überflüssiger Eintrag, wie so mancher andere. Bei PRO fehlt der Hinweis auf den theoretischen Rahmen, die generative Grammatik, andere Modelle kommen ohne solche Hilfskonstrukte aus. „Wenn ein Modell nicht nur Sätze analysiert, sondern auch zu erklären und darzustellen versucht, wie sie gebildet werden, spricht man von einer Generativen Grammatik.“ Es fehlt der Hinweis, daß es sich nur um eine methodisch begründete Simulation durch ein Regelwerk und nicht um die wirkliche Bildung von Sätzen durch den Sprecher handelt. („Erzeugung“ ist ein technischer Begriff aus der Theorie abstrakter Automaten.) Als „Indefinitnumeralia“ wird eine ziemlich sonderbare Gruppe zusammengestellt: „viel, etwas, ein bisschen, mehrmalig, manchmal, mehrfach, allerlei“. Wieso das „es“ in „Es kamen viele Fans zum Jubiläumskonzert“ auf das nachfolgende Subjekt verweisen und es sozusagen vorwegnehmen soll, bleibt rätselhaft, denn das Vorfeld-es tut ja nichts dergleichen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.12.2013 um 06.10 Uhr |
|
Seit das "Bewerten" nach einer törichten Lernzieltaxonomie mehr gilt als das "Wissen", wird im Deutschunterricht Sprachkritik betrieben, und die Kenntnis sprachlicher Tatsachen kommt zu kurz. Hermann Paul hat nur wenig übertrieben, als er die geschichtliche Betrachtung der Sprache zur einzig wissenschaftlichen erklärte (die Übertreibung ist ja in ebendemselben Werk, den "Prinzipien", zurückgenommen). Im Grundkurs bringen wir den angehenden Deutschlehrern zwar die Lautverschiebungen bei, aber dann kriegen sie Einführungsbücher in die Hand, in denen Herbst mit lat. herba in Verbindung gebracht wird. Und weil Studenten grundsätzlich ihren Büchern mehr vertrauen als ihren Lehrern, kriegen wir das dann in Prüfungsarbeiten aufs Brot geschmiert. O tempora! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.12.2013 um 12.34 Uhr |
|
Zu der absonderlichen Behauptung, die menschliche Sprechtätigkeit sei "nicht beobachtbar" (vgl. #13242) paßt folgendes: „Die Sprechfähigkeit des Menschen ist ein spezifischer Teil der Kognition: Sie ist eine humanspezifische mentale Fähigkeit, die konstitutiv für viele unserer allgemeinen kognitiven Fähigkeiten ist. In diesem Sinne ist Kognition der allgemeinere Begriff und inkludiert Sprache.“ (Monika Schwarz: Kognitive Semantiktheorie und neuropsychologische Realität. Tübingen 1992:36). Es paßt auch in gewisser Weise zum psychologisierten bilateralen Zeichenbegriff Saussures. (Die Verfasserin ist übrigens dieselbe Schwarz-Friesel, die heute in der Mitte der Gesellschaft gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit kämpft, aber das ist reiner Zufall.) |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 29.11.2013 um 13.39 Uhr |
|
Sind dann Sprachen, die sich nicht mehr verändern, unnatürliche? Ändert sich das klassische Latein noch oder ist es unnatürlich? In der Form des Kirchenlateins wird es weiterentwickelt. Auch künstliche Sprachen wie z.B. Programmiersprachen ändern sich und werden weiterentwickelt durch Hinzufügen neuer Funktionen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.11.2013 um 10.20 Uhr |
|
Alle natürlichen Sprachen befinden sich in ständigem Wandel. Diese Tatsache gehört zu den Universalien der Sprache. (Damaris Nübling in Zusammenarbeit mit Antje Dammel, Janet Duke und Renata Szczepaniak: Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. Tübingen 2006:1) Ich übersetze den zweiten Satz: Alle natürlichen Sprachen befinden sich in ständigem Wandel. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.09.2013 um 04.35 Uhr |
|
In Hoffmanns Handbuch schreibt Gabriele Graefen: „Für [die Personalpronomina] ist wesentlich, dass der Begriffsbildung eine frühe (vorbürgerliche und vordemokratische) Personenauffassung zugrundelag. Ihr Hintergrund war vor allem das griechische Theater, in dem als ‚prosopon‘ die Maske, auch die damit verbundene Rolle eines Schauspielers, bezeichnet wurde.“ (677) Falls es hier nicht nur um Etymologie und Theatermetaphorik geht, wäre wohl eine Erläuterung angebracht, was an den Personalpronomina vorbürgerlich und vordemokratisch sein soll und wie sich der Begriff im Bürgertum und in der Demokratie geändert haben könnte – ganz abgesehen von der Qualifizierung Athens als „vordemokratisch“, wo doch die Tragödie und die Demokratie gleichzeitig und nicht ohne inneren Zusammenhang entstanden. Die Griechen mögen noch keine supertolle Demokratie wie wir gehabt haben, aber das griechische Theater war keine aristokratische Veranstaltung. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 28.08.2013 um 20.27 Uhr |
|
Duden von 1955: - ; Duden von 1967: tendenziell; Mackensen: tendenziell.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.08.2013 um 09.23 Uhr |
|
"Rediscovery procedures" (nach Leonhard Lipkas witzigem Wort) sind besser als gar nichts, aber mich interessiert nur, "was hinten herauskommt" (nach Helmut Kohl). Wo sind die neuen Einsichten in die Sprache? Wenn die Linguisten sich wieder mit der Sprache statt mit der logischen Struktur von Sprachtheorien beschäftigen (Chomsky würde den Unterschied, nun ja, "leugnen") - um so besser. Die Schreibweise tendenziell dürfte mit der Entlehnungsgeschichte zusammenhängen. |
Kommentar von Andreas Blombach, verfaßt am 27.08.2013 um 23.13 Uhr |
|
Interessant – ich hielt das für alte/bewährte Rechtschreibung, die auch nach der Reform noch als Variante zugelassen sein sollte (wie potentiell, existentiell usw.). Ich finde auch zahlreiche Belege dafür, aber tendenziell ist offenbar seit jeher die gängige Schreibweise (http://books.google.com/ngrams/graph?content=tendentiell%2Ctendenziell&year_start=1800&year_end=2008&corpus=20&smoothing=0&share=); auch im Duden etwa wurde wohl schon vor der 96er-Reform nur tendenziell verzeichnet (meiner von 1958 enthält das Wort leider überhaupt nicht) – danke für den Hinweis.
|
Kommentar von Argonaftis, verfaßt am 27.08.2013 um 19.35 Uhr |
|
tendenziell statt tendentiell Nichts für ungut. |
Kommentar von Andreas Blombach, verfaßt am 27.08.2013 um 15.04 Uhr |
|
Ein Trend ist das wirklich, aber zumindest um Welten besser als der der generativen Grammatik. Abseits der stärkeren Formalisierung (z.B. dort, wo sich HPSG und Konstruktionsgrammatik treffen) gibt es auch einen Trend dazu, sich wieder stärker am tatsächlichen Sprachgebrauch zu orientieren ("usage-based"), was wenigstens tendentiell mit weniger Theorie und mehr Empirie einhergeht – generell scheint mir empirisches Arbeiten in der Linguistik wieder wichtiger zu werden. Das ist doch durchaus begrüßenswert, unabhängig davon, was man etwa von Goldbergs sonderbaren Konstruktionshierarchien nach Art der objektorientierten Programmierung halten mag.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.08.2013 um 05.16 Uhr |
|
Seit einiger Zeit rennt alles hinter der Fahne "Konstruktionsgrammatik" her. Wer weiterkommen will, sollte sich anschließen, auch wenn er weiß, daß es bloß eine Mode ist. "Optimalitätstheorie" ist auch noch schick. Am besten, man verbindet beides.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.08.2013 um 06.08 Uhr |
|
Ich dachte, ich hätte das folgende Werk schon besprochen, aber das war damals nur eine kurze Bemerkung gewesen (siehe hier), deshalb nun etwas ausführlicher (meine Mängelliste ist eigentlich noch länger): Hoffmann, Ludger (Hg.) (2007): Handbuch der deutschen Wortarten. Berlin (De Gruyter Lexikon). (Auf dem Einband: „Deutsche Wortarten“, ebenso schwankend die Gattungsbestimmung „Lexikon“ und „Handbuch“, die identische Studienausgabe 2009 hat den eigentlichen Titel auch auf dem Einband.) Die Beträge dieses „Handbuchs“ (das eher eine Aufsatzsammlung ist) sind sehr unterschiedlich nach ihrem theoretischen Ansatz und auch was die Lesbarkeit betrifft. Die meisten Artikel orientieren sich an der IDS-Grammatik (Zifonun et al.). Viele beziehen sich auf Ehlichs „Funktionale Pragmatik“, arbeiten also mit „Feldern“ und „Prozeduren“, die auf eine bestimmte Schule der Germanistik beschränkt geblieben sind. Das Vorgehen ist mentalistisch-psychologisierend mit fiktiver „Wissensprozessierung“ usw. Aus dem Rahmen fällt, wie schon in früheren Gemeinschaftswerken des IDS, Helmut Frosch mit seiner Kategorialgrammatik, die weniger am Deutschen als an Quantifikation in der formalen Logik interessiert ist. Dadurch ist der Bereich „Indefinitum und Quantifikativum“ praktisch verschenkt, der Leser erfährt nichts Genaueres über die deutschen Wörter dieser Klassen. Als Konnektivpartikeln werden „exemplarisch“ allerdings und jedenfalls behandelt, weil die Verfasserin zufällig darüber gearbeitet hat. Alle Beiträge sind in reformierter Rechtschreibung mit Ausnahme von Angelika Redder. Getrennt wird, wo immer es nach der Neuregelung möglich ist, so: Pers-pektive, monopers-pektivisch, Kons-titution, Subs-tanz, Subs-tantiv, Sy-nonym, Sy-nopse, Kons-trukt. In einem sprachwissenschaftlichen Buch wirkt das befremdlich. Die Reformorthographie ist unzureichend beherrscht,auch andere Fehler sind nicht selten: im übrigen, im einzelnen, zum zweiten, zum dritten, im wesentlichen, dasss, Jackendorf (mehrmals statt Jackendoff), Brøndahl, Vieles, eliziert, Strasse, methoche, nach bekannt werden der historischen Herkunft, des so zu Weg gebrachten verbalen Komplexes (die Neuregelung kennt fakultativ zu Wege bringen), Hyatus (zweimal), bedeutungsentlehrt. SchülerInnen usw. entspricht nicht der amtlichen Rechtschreibung, aber politische Korrektheit wird eben noch höher geschätzt als orthographische. Politisch korrekt ist auch das Beispiel: Patrick küsste Klaus und dann umarmte er ihn. Die Autoren sind also nicht „homophob“. Mit dem Griechischen und Lateinischen haben die Verfasser nicht viel im Sinn, hier häufen sich die Fehler, wie schon der „Hyatus“ zeigte. Onoma und rhema sind meros logou (statt merē). *hō dīe ist nicht „idg.“, sondern bestenfalls ein älteres Latein, noch ohne Kürzung des o. - epirrhema ist zweimal falsch geschrieben. Ludwig Eichinger behandelt Adjektiv und Adkopula. Der Beitrag ist schlecht gegliedert und wiederholungsreich. Die Beispiele sind alle aus Kehlmann, aber auf Reformschreibung umgestellt, allerdings nur Heyse. Gleichzeitig werden zufällige Satzinitialen der Quelle als Großschreibung übernommen. Ein Beleg aus der Schweiz behält die Schweizer ss-Reglung bei. Überhaupt scheint aber die Korpusbezogenheit beim bloßen Anführen alltäglicher Adjektivfornen unangebracht. Die „Adkopula“ wird nur ganz flüchtig nebenbei erwähnt, anscheinend trauen die IDS-Grammatiker ihrer eigenen Begriffsprägung nicht recht, sie wird ja auch in der übrigen Literatur nicht beachtet. „Der Terminus Adkopula scheint auch dazu geeignet zu sein, jene Elemente diffuser Wortartzugehörigkeit zu charakterisieren, wie sie sich häufiger beim Prozess der Univerbierung im Prädikatsbereich finden: Plötzlich tat Gauß ihm leid. Auf Univerbierung kommt er hier nur, weil die neueste Revision der RSR leidtun vorschreibt. Überhaupt ist unter „Univerbierung“ hier immer Zusammenschreibung zu verstehen, also nichts Grammatisches. Eichinger stellt fest, daß die Bezugsadjektive „eine allgemeine Beziehung der Zugehörigkeit ausdrücken. Wegen dieser Eigenschaft, die zur Folge hat, dass sie nur attributiv (und zum Teil adverbial) vorkommen, nennt man sie Zugehörigkeits- oder Relationsadjektive.“ Wieso folgt das? Man könnte doch auch Zugehörigkeit prädikativ ausdrücken. Die eindeutig adverbiale Natur von lange (dann schwieg er lange) hat Eichinger anscheinend nicht bemerkt. „Daneben gibt es eine Reihe von Lexemen, deren wortartmäßige Zuordnung unklar ist, bei denen im Zweifelsfall das Substantiv primär ist: Feind – feind; Ernst – ernst; Pleite – pleite; Bankrott – bankrott; Klasse – klasse; Scheiße – scheiße; Wurst – wurst.“ In dieser bunten Mischung gibt Eichinger nur die von den Rechtschreibreformern erfundenen Unklarheiten wieder. Was soll denn an bankrott zweifelhaft sein? Typologische Äußerungen über Sprachen, von denen man kein Wort versteht, sollte man unterlassen. Sonst kommt es schon orthographisch zu peinlichen Fehlern (zweimal chin. piaolang statt des sehr geläufigen piaoliang), die schlagartig die Unzulänglichkeit solcher Darlegungen enthüllen. Daß es im Tonga nur eine einzige Wortart gebe, im Tuscarora nur eine einzige syntaktische Funktion, ist natürlich Unsinn. Dann sind eben die Begriffe Wortart und syntaktische Funktion nicht anwendbar. Anna Wierzbickas Theorie ist falsch wiedergegeben und braucht nicht durch Belege aus dem Hausa (das die betreffende Verfasserin natürlich ebenfalls nicht beherrscht) widerlegt zu werden. Das subjektlose Reflexivpassiv wird keineswegs nur als „energische Aufforderung“ gebraucht (Jetzt wird sich endlich vertragen.) Es gibt auch einfache Aussagen in dieser Form: Meist wird sich ihnen intuitiv genähert. Beiden Positionen soll sich in diesem Buch gewidmet werden (aus Schriften von Hans Werner Eroms). Selbstgemachte, praktisch nie vorkommende Sätzchen wie Du ersparst ihm sich braucht man nicht zu analysieren. Die Lehre vom Genus der Substantive ist überholt, daher auch die von Thielmann angeführte Definition Ulrich Engels: „Nomina sind Wörter, die ein bestimmtes Genus haben.“ Dann wäre der Begriff des Substantivs schon auf so nahe verwandte Sprachen wie das Englische nicht anwendbar, ganz zu schweigen vom gelegentlich herangezogenen Ungarischen. Sehr originell auch die These desselben Autors, das Lateinische bilde keine Phrasen. Thielmann hält Arbeitsplanung für ein Rektionskompositum, was die rein semantische Betrachtungsweise belegt. Thielmann schreibt auch: „Von dem grundsätzlich geltenden Sachverhalt, dass jedes deutsche Substantiv genau ein Genus besitzt, existieren einige Ausnahmen, die in zwei Gruppen zerfallen: a) Ein Substantiv besitzt bei gleicher Bedeutung zwei Genera, deren Verteilung z. T. regionalspezifisch ist: die Butter vs. der Butter (bairisch) das Radio vs. der Radio (schwäbisch) b) Ein Substantiv besitzt zwei Genera, aber die Bedeutung ist nicht dieselbe: der Teil (im Sinne v. 'der Teil und das Ganze') vs. das Teil (im Sinne v. 'Ersatzteil') der Heide ('Nichtchrist') vs. die Heide ('baumlose Ebene')“ Aber das sind keine Ausnahmen. Dialekte sind verschiedene Systeme, und Homonyme sind verschiedene Wörter. Hans Altmann trägt einen guten Artikel über Gradpartikeln bei. Er spricht allerdings wieder von „Abtönungspartikelfunktion“ usw. - die übliche Vermischung von Kategorie und Funktion. Daher auch als erster Satz: „Vor 1976 werden die Gradpartikeln nicht als Wortkategorie bzw. syntaktische Funktion erkannt.“ Wie können Partikeln eine syntaktische Funktion sein? Sie können allenfalls die syntaktische Funktion der Graduierung (die aber eher eine semantische ist) haben. Der Herausgeber Hoffmann verstrickt sich in seinen eigenen Beiträgen in folk psychology nach diesem Muster: „Der Hörer baut in der Vorstellung ein Bild vom Gegenstand auf, das für ihn abgeschlossen und im Wissen verankert ist.“ „Der primäre Spracherwerb ist ein Prozess mentaler Konstruktion sprachlichen Wissens.“ Woher weiß der Linguist das alles so genau? Prachtvolle Grafiken sollen diese Psychologie erläutern. Hoffmann erfindet auch neue Ausdrücke wie „Kollustration“. das sonst in der Sprachwissenschaft unbekannt und daher in einem solchen Handbuch fehl am Platz ist. Die epistemische Lesart der Modalverben ist unzulänglich beschrieben: „Peter soll Fußball gucken = Es ist wahrscheinlich, dass Peter Fußball guckt.“ Dabei geht das Wesentliche verloren: Ein Dritter will, daß wir (Gesprächsteilnehmer) glauben, daß Peter Fußball guckt. Gabriele Graefen ist sprachgeschichtlich unsicher: „das aus dem Gotischen stammende jener“ – wie könnte das sein? so soll „aus dem idg. Pronominalstamm, der sich im Deutschen später zum bestimmten Artikel hin entwickelte“ stammen. Der bestimmte Artikel hat sich aus dem *to-Stamm entwickelt. - Das frz. on soll nach Graefen aus hominem stammen, aber das hat bekanntlich homme ergeben. Im Gefolge der Generativen Grammatik können sich manche Linguisten nicht mit der Apokoinou-Konstruktion anfreunden. Man kommt aber nicht darum herum: „Er sprah zi then es ruahtun“ (Otfrid) Auch die Darstellung des nachgestellten Demonstrativums beruht möglicherweise auf einem Mißverständnis der angegebenen Stelle bei Hermann Paul. Leider fehlt das bei einem solchen Handbuch unentbehrliche Stichwortverzeichnis. Natürlich findet man in einem so umfangreichen Buch auch manches Richtige. Insgesamt wirkt es aber unausgeglichen, fehlerhaft und überflüssig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.08.2013 um 05.00 Uhr |
|
Die erwähnte "Sprachgeschichte" von Petra Maria Vogel (Heidelberg 2012) ist auf den ersten Blick ganz ansprechend, auch wenn man sich fragt, warum die Studenten für viel Geld zu jedem einzelnen Kapitel einer Einführung in die Sprachwissenschaft ein eigenes Buch kaufen sollen, aber das ist es nun mal, was die Verlage seit "Bologna" auf den Markt werfen (Morphologie, Phonologie, Orthographie usw.). Die "Sprachgeschichte bringt das absolute Minimum für Germanistikstudenten und ist insofern ganz brauchbar. Man darf nur nicht zu genau hinsehen. „Die wichtigsten unterordnenden Konjunktionen sind dass, nachdem, weil, falls, obwohl, damit, indem.“ (52) Sind ob, wenn, da weniger wichtig? „Präpositionen stehen vor einem Substantiv, einem Pronomen oder einer Nominalphrase.“ (52) Sie stehen u. a. auch vor Adverbien. „Manchmal gehören dieselben Elemente verschiedenen Wortarten oder Unterwortarten an, abhängig von ihrer jeweiligen Bedeutung und Verwendung. Beispielsweise kann schön Modalpartikel oder Adjektiv sein (Das ist schön schwierig/Das ist schön), ja kann Modal- oder Antwortpartikel sein (Das ist ja schwierig/Ja (als Antwort auf eine Frage) (...)“ (53) Sehr fraglich, nicht nur wegen schön als „Modalpartikel“. Wenn man die Wortart von der „Verwendung“ abhängig macht, könnten auch Adjektive in adverbialer Verwendung Adverbien sein usw. – es sei denn, es gehe um banale Homonymie. „Partikeln zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie nicht als Satzglied fungieren und damit nicht alleine am Satzanfang vor dem Verb stehen können: *Sehr bin ich müde.“ (53) sehr ist hier ein Adverb und kann sowohl allein stehen (Sehr hat mich geärgert, daß...) als auch im Fokus anderer Partikeln: wie sehr / so sehr habe ich mich geärgert / sogar sehr (sehr sogar!) Sehr habe ich mich gefreut, in Klemm einen ganz besonders liebenswürdigen Menschen gefunden zu haben. (Nietzsche an Rohde 3. 11. 1867) Sehr hätte ich mir gewünscht, es wäre mehr daraus geworden. Das alles auf nur zwei Seiten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.07.2013 um 10.55 Uhr |
|
Von Jörn Stegmeier gibt es auch noch einen Aufsatz, der ebenfalls seine beschränkte Sicht auf Orthographie und Sprache dokumentiert, vor allem aber seine Arbeitsweise: „Grundlagen, Positionen und semantische Kämpfe in der Orthographiediskussion“ (Ekkehard Felder (Hg.): Sprache. Heidelberg 2009:287-315) Er schwebt wie Stenschke (den er auch anführt) hoch über den Diskussionen, an denen er sich selbst keineswegs beteiligen möchte. Über mich schreibt er unter anderem: »Ickler zeichnet sich durch eine besonders produktive und vehemente Kritik an den Reformbestrebungen aus. Gerade ein Titel wie „Falsch ist richtig“ knüpft in seiner Bewertungshaltung an eine schulmeisterliche Sprachbetrachtung an, wie sie in der Diskussion um die Rechtschreibung häufig anzutreffen ist.« (308) Er hat also weder diese noch eine andere Schrift von mir gelesen. Der Titel genügt ihm. Wenn jemand es wagt, in irgendeinem Zusammenhang von falsch und richtig zu sprechen, muß er ein "Schulmeister" sein – so ungefähr arbeitet die Automatik in solchen Köpfen. Daß ich seit 1996 gegen die schulmeisterliche Einstellung zur Rechtschreibung polemisiere (u. a. in dem genannten Buch, zusammen mit einem Doderer-Zitat), braucht man dann gar nicht mehr zu wissen. (Welcher meiner vielen tausend Einträge hier ist von einer "schulmeisterlichen Sprachbetrachtung" bestimmt? Und welche "Bewertungshaltung" – was immer das bedeuten mag – ist denn aus dem Titel "Falsch ist richtig" abzulesen?) Der Sammelband enthält Beiträge von sehr unterschiedlicher Qualität. Kurios ein weiterer Aufsatz von Herbert E. Wiegand mit noch viel weiter gehender "Formalisierung" als in der Einleitung zum neuen Dornseiff. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.07.2013 um 12.08 Uhr |
|
Die Phonetiker scheinen sich nicht ganz einig zu sein, was sie unter "Approximanten" verstehen wollen. Manche rechnen gleich alle Vokale dazu und unterscheiden dann konsonantische Approximanten, andere wollen nur die letzteren gelten lassen, also etwa die Halbvokale und das laterale l. Kurios ist folgendes aus einem neuen Einführungsbuch: „Ganz unten finden sich im Standarddeutschen die extrem offenen Approximanten (...), die 'sich (den Vokalen) Nähernden'.“ (Petra Maria Vogel: Sprachgeschichte. Heidelberg 2012:16) Aus demselben Buch: "So heißt das Präteritum zum Verb liften z. B. ich liftete mit Dentalsuffix, nicht ich laft mit Vokalwechsel (theoretisch möglich z. B. in Anlehnung an singen/ich sang)." (69) Das wäre auch „theoretisch“ nicht möglich, weil die Umgebungsbedingungen der Reihe IIIa der ablautenden Verben (Nasal + Konsonant) bei liften nicht gegeben sind. Die Muttersprachler wissen das intuitiv sehr genau. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.07.2013 um 17.45 Uhr |
|
Kein Einführungsbuch, aber auch Abfall: Jörn Stegmeier: Die Kriterien der Rechtschreibung. Eine vergleichende Analyse des neuen und des alten Regelwerks. Tübingen 2010. Der frühere Wahrig-Mitarbeiter legt seine Dissertation vor. Eine CD liegt bei, sie enthält das ganze Material in tabellarischer Form. Es ist nicht anzunehmen, daß irgend jemand diese vielen hundert Seiten durcharbeitet. Es ist nur wenig Fachliteratur verarbeitet (meistzitiert: Nerius), die früheren regeltechnischen Kritiken an der Reform sind nicht beachtet. Die Rechtschreibung ist eigenartig: graphisch, aber orthografisch, phonografisch usw. ... und logographische Schriften. Die Grundelemente Letzterer tragen Bedeutung ... Zum neuen Regelwerk heißt es abschließend: „Eine Differenzierung und Systematisierung hat in der Tat stattgefunden, allerdings auf Kosten der Anwendbarkeit.“ (109) Der Hauptmangel des Buches besteht aber darin, daß als „altes Regelwerk“ die Dudenregeln von 1991 zugrunde gelegt werden, die als populäre Anleitung nicht mit dem amtlichen Regelwerk der Reformer vergleichbar sind. Die ganze Arbeit ist also ziemlich sinnlos. |
Kommentar von Horst Ludwig, verfaßt am 20.07.2013 um 18.10 Uhr |
|
Zu #23708: Ja, man kann angehende Germanisten nicht genug vor dem Duden als Informationsquelle warnen! Das sollten die Leiter der Bibliographie-Kurse immer wieder betonen. Aber meine Studenten kamen von ihrem Studienaufenthalt in Deutschland in dieser Beziehung meist mit großem Blödsinn zurück, was mir zeigte, daß die akademischen Lehrer da keine Ahnung hatten von dem, was sie den Studenten alles eintrichterten.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.07.2013 um 17.07 Uhr |
|
In der Dudengrammatik (2005:420) werden bewirken, verursachen, veranlassen als "kausative Verben" bezeichnet. Das ist so, als würde ich helfen ein Hilfsverb und kopulieren ein Kopulaverb nennen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.07.2013 um 05.14 Uhr |
|
Alle mal herhören! wird bei Dürscheid „als Teil eines Verbzweitsatzes reanalysiert“: Ich möchte, dass alle mal herhören. (94) Dabei scheint sie zu übersehen, daß herhören im ersten Satz Infinitiv und im zweiten 3. Pers. Plural ist. Vgl. auch Alles aussteigen!- Wer dafür ist, bitte die Hand heben!
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 17.07.2013 um 14.43 Uhr |
|
Bei Wikipedia steht unter "Deutsche Deklination": Das natürliche Geschlecht („Mädchen“ ist eine weibliche Person, „Tisch“ ist ein Gegenstand) stimmt vor allem bei nicht-belebten Dingen meist nicht mit dem grammatischen Geschlecht überein („das Mädchen“ (neutrum), „der Tisch“ (maskulinum)). Was wäre dann das natürliche Geschlecht von "Tisch" oder anderer nicht-belebter Dinge? Soweit ich weiß, gibt es nur zwei natürliche Geschlechter, nicht-belebte Dinge haben gar keins. Noch mal zum Begriff der Markierung: Ist eigentlich der Genitiv oder das Genus eines weiblichen Substantivs im Sing. dadurch "markiert", daß es gerade keine Markierung hat? "Markiert" die Genitivendung -(e)s im Sing. das Genus, obwohl man daran nur nicht-weiblich ablesen kann, nicht aber das genaue Genus (männlich oder neutral)? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.07.2013 um 18.06 Uhr |
|
„Der Wortbestandteil -verb in der Bezeichnung 'Adverb' geht aber zurück auf die Bedeutung 'Wort', nicht auf 'Verb'. Ein Ad-verb ist also ein 'Bei-Wort', kein 'Bei-Verb' (vgl. Eisenberg 2006b:208f.)“ (Christa Dürscheid: Syntax. Grundlagen und Theorien. 6. Aufl. Göttingen 2012:38) Eisenberg verweist an der genannten Stelle (im 2. Band seiner Grammatik) auf Lyons, Matzel u. a. – Die Stelle bei Lyons (Introduction to theoretical linguistics. CUP 1969:325f.) kommt mir ziemlich unklar vor, ich will darauf aber hier nicht eingehen. Lat. verbum heißt zwar auch 'Wort", aber man kann doch nicht übersehen, daß die Römer mit adverbium einfach das griechische epirrhema übersetzten, und rhema heißt 'Verb'. Sowohl Dionysios Thrax als auch Apollonios Dyskolos, der dem Adverb eine eigene Abhandlung widmete, definieren das Epirrhema als ein unflektierbares Wort, das den Verbformen (enkliseis) hinzugefügt wird (nach manchen auch "nachgestellt", was aber nicht stimmen kann). Ich sehe nicht, was man da deuteln kann, auch wenn Apollonios die Verwendung des Adverbs zusammen mit anderen Wortarten hier nicht erwähnt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.07.2013 um 15.52 Uhr |
|
In dem genannten Buch findet man auch Sätze wie diesen: „Vergleichen wir hiermit kurz die Ergativsprachen.“ (33) Dürscheid scheint keine Ergativsprache zu beherrschen. Das ist aber kein Hindernis, solche Sprachen mal kurz mit dem Deutschen zu vergleichen. Auch das Koreanische wird immer wieder mal erwähnt. Ein anonymer Rezensent bei amazon übt scharfe Kritik an solchen Aussagen und hat wahrscheinlich recht. Man kann nicht genug davor warnen, sich über Sprachen zu äußern, die man nicht näher kennt. In einem anderen Buch derselben Verfasserin (Die verbalen Kasus des Deutschen. Untersuchungen zur Syntax, Semantik und Perspektive. Berlin, New York 1999:156ff.) geht es auch sehr anspruchsvoll zu: „Die Kãraka-Vibhakti-Theorie „Pãninis Kasustheorie bezeichne ich als Kãraka-Vibhakti-Theorie und nicht, wie in der Literatur üblich (so bei Rauh 1988, Czepluch 1996 oder Blake 1994), nur als Kãraka-Theorie.“ Hier erweckt Dürscheid den Eindruck, als könne sie eine eigenständige Interpretation der altindischen Grammatik geben, obwohl ihr dazu die Voraussetzungen fehlen. Die genannten Autoren kann man kaum als „die Literatur“ bezeichnen, denn von der wirklich sehr ausgedehnten Literatur zu Pânini sind sie weit entfernt. (Nur Gisa Rauh hat sich einigermaßen gründlich damit beschäftigt.) (Die Transkription des langen a mit einer Tilde statt des Längenstrichs im Namen Pânini usw. ist ganz unüblich. Die in einem Kasten vorgeführten Kasusformen von deva- sind ohne Längenzeichen und damit schwer irreführend transkribiert. Das ist, als wenn jemand im Griechischen den Unterschied von Omikron und Omega ignorierte.) Dürscheid behauptet, Pânini nehme nur für fünf der acht Vibhaktis (Kasusformen) eine Zuordnung zu Karakas vor, und zitiert (aus Böhtlingk) einige Sutren aus P. 1.4. Aber erstens werden dort nur die Karakas definiert und keine Zuordnungen zu Vibhaktis vorgenommen (von denen an einer ganz anderen Stelle die Rede ist), daher ist der Kasten mit der Überschrift „Vibhakti-Karaka-Relationen“ (158) irreführend, und die Ankündigung „Im folgenden soll gezeigt werden, wie die morphologische und die semantische Beschreibungsebene in der Grammatik des Pânini aufeinander bezogen werden“ ist gegenstandslos. Nach Rosane Rocher sind die Übersetzungen Böhtlingks an dieser Stelle durchweg falsch, weil Böhtlingk die Kasus ins Spiel bringt, wo es in Wirklichkeit nur um die Beschreibung der Handlung und der dazu notwendigen Handlungsbeteiligten geht. Zweitens sind es nicht fünf, sondern sechs Kârakas, die von Pânini definiert werden. „Auch dem Nominativ entspricht nach Pãnini kein spezifischer Kãraka.“ (kâraka ist eigentlich Neutrum.) Aber im Zusammenhang des ersten Buches wird der „kartr“ ebenso definiert wie die anderen Mitspieler: svatantrah kartâ; „Der aus eigenem Antrieb Handelnde heisst Kartr (Agens).“ (Böhtlingk 37) Und wiederum geht es hier nicht um den Nominativ, sondern um den Agens. Welche Rolle die Kârakas bei Pânini wirklich spielen, ist viel diskutiert worden, vgl. etwa S. D. Joshi: „Pânini's Treatment of Kâraka-Relations“ in: Charudeva Shastri Felicitation Volume. Delhi 1974:258-270. Dazu die kommentierte Ausgabe von Chandra Vasu Bd. I. – Besonders wichtig: Rosane Rocher: „Agent et objet chez Pânini“, JAOS 84 (1964):44-54. „Die vibhaktis werden der morphologischen Ebene zugeordnet. Diese Ebene setzt Pãnini in Beziehung zur semantischen Ebene, auf der die semantischen Relationen, in die die Nomina zum Verb treten, beschrieben werden.“ So könnte es scheinen, wenn man nur Böhtlingks Übersetzung zu Rate zieht. Der Orginaltext spricht von etwas anderem. „Während Fillmore von den Tiefenkasus ausgeht und fragt, wie diese syntaktisch umgesetzt werden könne, wählt Pãnini die vibhaktis als Ausgangspunkt und setzt diese in Beziehung zur semantischen Ebene.“ – Wo sollte das geschehen? Es trifft auch nicht zu, daß der Vokativ zu den von Pânini mit der Ordinalzahl durchnumerierten Kasusformen gehört (120). Unmittelbar vor dem Sutra über den Genitiv wird der Vokativ (sg.) als Sambuddhi bezeichnet. Einen „achten Kasus“ gibt es bei Pânini nicht. „Der Vokativ steht nicht in einer syntaktischen Beziehung zum Verb, er geht daher auch keine Kâraka-Relation ein.“ (158) Aber es geht nicht um syntaktische Beziehungen zum Verb. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.07.2013 um 15.17 Uhr |
|
Den Satz „Die Genusmarkierung am Substantiv ..." verstehe ich so: Pferdeflügel unterscheiden sich von Storchenflügeln in zwei wichtigen Punkten: erstens sind sie unbeweglich und zweitens gibt es sie gar nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.07.2013 um 14.56 Uhr |
|
Eine sehr wohlwollende Interpretation. Der Text fährt fort: "Mit anderen Worten: Ein Substantiv ist entweder Femininum oder Maskulinum oder Neutrum, eine Variation je nach syntaktischem Kontext gibt es nicht." Von Genusrektion ist nicht die Rede, die Substantive werden eben nicht genusflektiert, das ist in der Tat sehr sonderbar ausgedrückt. Auf Seite 28 steht außerdem: "„Das Substantiv steht immer in der dritten Person.“ Was soll das nun wieder heißen? Im Unterschied zu Verben haben Substantive keine Personalform, also auch nicht die dritte. Substantivgruppen (oder wie auch immer man sie nennen will) können mit jeder Personalform des Verbs konstruiert werden: Ich Dummkopf verstehe das nicht usw. |
Kommentar von Jan-Martin Wagner, verfaßt am 16.07.2013 um 13.37 Uhr |
|
Aber sie spricht doch gar nicht vom Genus an sich, sondern von dessen Markierung. Davon sagt sie, daß sie anders ist als die Markierung von Numerus und Kasus: inhärent und invariant. Dabei verstehe ich (bzw. bin ich bereit, es als solches zu verstehen) "invariant" als gleichbedeutend mit "sie regieren es" und "inhärent" als "keine explizite Markierung". Also nicht unbedingt falsch, mit Sicherheit aber unnötig kompliziert bzw. mit nur geringer Klarheit. Von der Logik her sollte zudem die Reihenfolge umgedreht werden: Erst die Eigenschaften an sich benennen (hier: Inhärenz und Invarianz), erst danach die sich daraus ergebenden Folgerungen diskutieren (hier: Unterschied zu Numerus- und Kasusmarkierung) – und dann auch begründen, warum eine solche weitergehende Aussage relevant ist, bzw. einen Zusammenhang herstellen, aus dem die Relevanz hervorgeht; sonst ist es leeres Faktengeschwätz. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.07.2013 um 12.23 Uhr |
|
„Die Genusmarkierung am Substantiv unterscheidet sich von der Numerus- und der Kasusmarkierung in zwei wichtigen Punkten: Sie ist dem Substantiv inhärent, und sie ist invariant.“ (Christa Dürscheid: Syntax. Grundlagen und Theorien. 6. Aufl. Göttingen 2012:27) Der alte Unsinn. Substantive haben kein Genus im gleichen Sinne wie die genusflektierenden Wörter, sondern sie regieren es. Von Verben sagt man ja auch nicht, daß sie einen bestimmten Kasus haben, der aber inhärent markiert (also gar nicht markiert) sei. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.06.2013 um 15.54 Uhr |
|
Wikipedia schreibt unter "Adjektiv": Das Adjektiv kann syntaktisch in vier Verwendungen vorkommen: (...) satz-adverbial: „Er weint schnell.“ (es kommt schnell dazu, dass er weint – schnell bezieht sich auf den ganzen Restsatz) — Das ist falsch. Satzadverbien wären leider, vermutlich, wahrscheinlich. Das schnell bedeutet zwar nicht, daß er in hohem Tempo weint, aber es gehört trotzdem zum Sachverhalt selbst, etwa im Sinne von "bald". Er hat eben nahe am Wasser gebaut. Die Paraphrase beweist nichts, vgl. Er steht früh auf = Es kommt früh dazu, daß er aufsteht. Hier würde niemand von einem Satzadverb sprechen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.05.2013 um 13.02 Uhr |
|
„Silbenschriftlich ist zum Beispiel die koreanische Hangul-Schrift.“ (Peter Stein: Schriftkultur. Eine Geschichte des Schreibens und Lesens. Darmstadt 2006:55) Schon ein flüchtiger Blick zeigt, daß das nicht stimmt. Richtig dagegen Wikipedia („Koreanische Schrift“): "Das koreanische Alphabet (Chosŏn’gŭl / Hangeul) ist eine Buchstabenschrift, die für die koreanische Sprache verwendet wird. Es handelt sich weder um eine logografische Schrift wie bei den chinesischen Zeichen noch um eine Silbenschrift wie die japanische Hiragana oder Katakana. Die einzelnen Buchstaben werden jeweils silbenweise zusammengefasst, so dass jede Silbe in ein imaginäres Quadrat passt." Vor 40 Jahren habe ich mich mit koreanischen Freunden gestritten, die noch die Nationallegende glaubten, wonach ein König die neue Schrift sozusagen aus dem Nichts geschaffen habe. Man sieht ja gleich den Zusammenhang mit indischen Schriften. Eine tolle Leistung bleibt es trotzdem. Näheres im Wikipedia-Eintrag. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.03.2013 um 05.33 Uhr |
|
Alwin Frank Fill: Linguistische Promenade. Wien, Berlin 2012. Eine weitere Einführung in die Sprachwissenschaft, eher für Laien als für Studenten gedacht und auf einen munteren Ton getrimmt: Saussure als der Mann, der die Junggrammatiker alt aussehen ließ usw. (was ja auch inhaltlich fragwürdig ist). Sonderbar sind einige Irrtümer: Konrad Mauthner statt Fritz, auch im Register falsch. Das Buch ist stark eurozentrisch angelegt, alles fängt bei den Griechen an, die aber auch nicht gut bedient werden: meieutisch (mehrmals) Pheidipides (mehrmals) Die Reformschreibung führt zu ein ander Mal usw. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.02.2013 um 08.47 Uhr |
|
Augustin Speyer: Deutsche Sprachgeschichte. Göttingen 2010 (UTB Profile) Das Buch ist für Anfänger gedacht und tatsächlich streckenweise sehr einfach geschrieben, aber dann kommen wieder Seiten, auf denen der Verfasser unnötigerweise die technische Darstellungsweise der generativen Grammatik und sogar nicht erläuterte Formalismen anwendet. Außerdem werden Spezialfragen, mit denen sich der Verfasser anderswo beschäftigt hat, übertrieben ausführlich behandelt. Zum Beispiel das 8. Kapitel „Auf dem Weg zum modernen Deutsch“ beginnt Speyer mit einem Abschnitt „Die Entrollung des /r/“: „Ein Lautwandel in in diesem Zusammenhang hervorzuheben, nämlich der Wandel in der Artikulation des /r/-Phonems.“ (102) Auch werden – für ein Einführungsbuch unpassend – immer wieder mehr oder weniger spekulative neuere Theorien eingeführt. Auf inhaltliche Probleme gehe ich nicht ein, die Unausgewogenheit des Ganzen macht es für die Zielgruppe unbrauchbar. Die Silbentrennung geht so: Obst-ruenten, Res-tandardisierung. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.01.2013 um 14.45 Uhr |
|
Saussure wird also überall gepriesen als Begründer der modernen Sprachwissenschaft. Inzwischen wissen wir: Nach seinem Jugendwerk, das er mit 21 veröffentlichte, kam praktisch nichts mehr. Der postum veröffentlichte "Cours", vermeintliche Grundschrift des Strukturalismus, ist die Nachschrift einer Vorlesung, an der die Verfasser (Bally und Sechehaye) selbst gar nicht teilgenommen hatten. Das Werk enthält, wie Lösener vor einiger Zeit (aber nicht als einziger) gezeigt hat, fast in jeder Hinsicht das Gegenteil dessen, was Saussure wirklich gesagt, geschrieben und gemeint hat (http://sprachtheorie.de/wp-content/uploads/2012/09/L%C3%B6sener-Saussure1.pdf). Die kolossale Wirkung dieses Buchs, an dem schon zeitgenössische Kritiker bemängelten, daß es nichts Neues enthalte, beruht also auf einem Mißverständnis. Daß aber der wahre Saussure, den wir z. B. aus den Nachlaßnotizen kennen (hg. und übers. von Johannes Fehr), nun die große befreiende Lehre biete, ist wohl auch eine vergebliche Hoffung. Paradox genug: Der weltbekannte, einflußreiche Saussure ist eine Fälschung oder wenigstens Verdrehung des wirklichen, der echte, aber unbekannte hat naturgemäß bisher keine Wirkung entfalten können. Jede Einführung in die Sprachwissenschaft zollt dem "Genfer Meister" Tribut, aber hütet sich, darauf zurückzukommen oder seine Lehren anwenden zu wollen. Das geht nämlich gar nicht. Dabei ist jenes Frühwerk eine wirklich strukturalistische Arbeit: die Rekonstruktion des idg. Vokalsystems und Ablauts aufgrund von Symmetriebetrachtungen. So neu war das Verfahren aber damals nicht, man denke an die Proportionsgleichungen der Junggrammatiker. Komischerweise findet man bei genauer Lektüre von Hermann Paul, daß dieser ein "Strukturalist ante litteram" war. Wie denn nicht! Das war damals jeder. Saussure war ein unglücklicher Mensch: Eigentlich interessierten ihn die Einzelheiten der verschiedenen Sprachen, aber vor lauter Systematisierungssucht kam er nicht dazu, sich daran zu erfreuen. Das hat er selbst messerscharf erkannt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.12.2012 um 04.56 Uhr |
|
Bei amazon habe ich folgende Kurzbesprechung veröffentlicht: Ludger Hoffmann: Deutsche Grammatik. Grundlagen für Lehrerausbildung, Schule, Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache. Berlin 2013 (Erich Schmidt) Zunächst zum Buchtechnischen, das hier leider ein ernstes Problem geworden ist. Das Werk ist in einer sehr dünnen serifenlosen Schrift gedruckt, die das Auge übermäßig anstrengt. Ich verstehe nicht, daß Verlage heute noch solche Fehler machen. Positiv ist zu vermerken, daß Hoffmann mit authentischen Belegen arbeitet, die auch in der ursprünglichen Orthographie belassen werden. Er selbst verwendet die reformierte, und zwar einschließlich der übertriebenen Großschreibung, die 2004 in die Neuregelung eingeschleust wurde: "Sie hat Weniges übernommen." "das muss man erfahren und Anderen erfahrbar machen". Vorgeschrieben ist sie nicht, man fühlt sich in die Mitte des 19. Jahrhunderts versetzt. Hoffmann hält es für richtig, eine eigene Begrifflichkeit einzuführen, z. B. den Begriff der „Installation“, der sonst in der Germanistik unbekannt ist, außerdem „Felder“ und „Prozeduren“ nach Konrad Ehlich. Da dieses Begriffssystem außerhalb des Ehlich-Kreises nicht gebräuchlich ist, eignet es sich auch nicht in einem Handbuch für Lehrer. Die zahlreichen graphischen Modelle sind – wie schon in früheren Werken Hoffmanns – eher verwirrend als erklärend. „Die Freude von Kindern an sprachlichen Spielen zeigt, dass im kreativen Umgang mit Sprache schon ein menschliches Belohnsystem aktiviert wird.“ - Das ist ein neurologistischer Schnörkel, wie heute üblich, ohne etwas zu erklären. Im übrigen bedient sich der Verfasser einer „Handlungs“-Begrifflichkeit, die vor einigen Jahrzehnten unter Didaktikern sehr beliebt war: Sprechen ist Handeln, das war der Renner der „pragmadidaktischen“ 70er Jahre, als auch Habermas die Sprechakttheorie aufgriff. Immer wieder wird die türkische Grammatik zum Vergleich herangezogen, weil das Türkische die meistgesprochene Zweitsprache in Deutschland ist. Einen systematischen Sprachvergleich kann und soll das nicht ersetzen, für die meisten Leser wird es nur störendes Beiwerk sein, dessen wirkliche Begründung eher in persönlichen Voraussetzungen des Verfassers liegen dürfte. Es gibt auch Übungsaufgaben. Das Werk ist eben eher didaktisch als linguistisch konzipiert. Zum Nachschlagen ist es erklärtermaßen nicht geeignet, aber durchlesen wird man es wegen seiner Weitschweifigkeit auch nicht. Hoffmann konnte sich offenbar nicht entscheiden, ob er wirklich eine "deutsche Grammatik", die der Titel verspricht, oder eine Anleitung zum Grammatikunterricht schreiben wollte. Herausgekommen ist ein eigenwilliger Zwitter. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.12.2012 um 16.22 Uhr |
|
Nicht schlecht, aber verbesserungsbedürftig ist folgendes Werk: Klaus-Peter Wegera/Sandra Waldenberger: Deutsch diachron. Eine Einführung in den Sprachwandel des Deutschen. Berlin 2013. (Den schiefen Untertitel Sprachwandel des Deutschen hatte ich schon kommentiert.) Zur Orthographie: das Vater Unser (22) Sprechen ist immer auf Andere bezogen (27) zur Impuls gebenden Region (109) Der amerikanische Germanist hieß Twaddell, nicht Twaddel (mehrmals). eines der meist diskutierten Phänomene (117) so genannte (stets so) präsens pro futuro (193) (Das Zitatwort sollte dann konsequent lateinisch geschrieben werden.) Zum Stil: Umständliche, durch zahllose „Prozesse“ aufgeblähte Ausdrucksweise: Unter Dehnung versteht man den Prozess der Veränderung der relativen Kürze in relative Länge bei der Artikulation von Vokalen. (112) -prozess wird auch fast zwanghaft an unzählige Wörter angehängt: Leninisierungsprozess, Wandelprozess, Entlehnungsprozess usw. dass die Bedeutungen von Wörtern Wandelprozessen unterliegen (241) = sich verändern. Teil des Verschmelzungsprozesses der Flexion ... (167) Eine besondere Art der Verdichtung von Wörtern (durch Zusammenziehung) stellt der syntagmatische Lautwandel der Kontraktion dar (...) (109) Verdichtung durch Zusammenziehung IST die Kontraktion, keine besondere Art davon. Außerdem lieben die Verfasser darstellen anstelle der einfachen Kopula. Ekthlipsis (113) wird nicht erklärt - ein auch unter Sprachwissenschaftlern kaum bekannter Terminus. Zum Inhalt: Viele Details und die Literaturangaben dazu (manchmal Dutzende) passen eher in ein Handbuch als in eine Einführung. Die Präsensform ist nicht mehr, sondern weniger markiert als das Präteritum (34). Die Hand heißt auf gotisch natürlich nicht hundus (144). 31: Sprachwandel als kognitives Phänomen - solche psychologistischen Einschübe finden sich immer wieder. Was das Kognitive sein soll, lassen die nichtpsychologischen Verfasser im Dunkeln. Drei wesentliche kognitive Prozesse auf der lexikalischen Ebene sind Metapher, Metonymie und Synekdoche. (37) Die kognitivistische Metapherntheorie Lakoffs wird kritiklos übernommen, bleibt aber folgenlos. Paul nimmt (...) Kernideen der modernen Metapherntheorie vorweg (vgl. bes. Lakoff/Johnson 1980). (245) So kann man es natürlich ausdrücken. Die Verfasser glauben offensichtlich, daß es eine „moderne Metapherntheorie“ gibt, wie Lakoff/Johnson es von ihrer eigenen Theorie behaupten. Die chinesische Schrift wird als logographisch bezeichnet (80), dies wird im Glossar als wortbezogen erklärt; die chinesische Schrift ist aber am ehesten Morphemschrift. In freier Verwendung bestimmt das Verb, aus dem das Partizipialattribut (gemeint ist wohl -adjektiv) gebildet ist, den Kasus der eingebetteten NP (z.B. den Vertrag betreffend, hier Akkusativ), als Präposition regiert betreffend den Genitiv (betreffend des Vertrages). Damit spiegelt sich ein Unterschied in der Funktion auch in einem Unterschied der syntaktischen Struktur wider. (Dies nach einer Arbeit der Mitverfasserin Waldenberger.) Das Ganze ist tautologisch: erst wenn nicht mehr die Rektion des Verbs vorliegt, gibt es überhaupt einen Grund, von einer neuen Präposition zu sprechen. Unter einer Konjugationstabelle, die aus Braune/Mitzkas Althochdeutscher Grammatik übernommen ist, steht nun: Entwicklung der Flexivik der Plural-Personalendungen. Wieso Flexivik, und was heißt das überhaupt? (Es gibt nur wenige Belege für dieses Wort.) Es handelt sich einfach um die Entwicklung der Personalendungen. Das ursprünglich lokale und temporale Adverb da – do wird partiell zu einer kausalen Konjunktion verschoben. (203) Das wird noch weiter ausgeführt, aber der kausale Charakter von da ist fraglich. Die Lehre von der Satzklammer wird in der üblichen Weise dargestellt. Die Bedeutung eines neu gebildeten Wortes ist zunächst in der Regel transparent aus den Bedeutungen seiner Bestandteile und ihrer Kombination (dem Wortbildungsverfahren) ableitbar. (230) Erst danach soll es zur Idiomatisierung kommen können. Diese Behauptung wird aber durch die folgenden Absätze widerlegt, ohne daß die Verfasser den Widerspruch bemerken. Ein Zitat von Hermann Paul aus den „Prinzipien“ von 1880 stellt den Sachverhalt klar: „Es gibt auch eine Art von Spezialisierung, die gleich ihren Anfang nimmt, sobald das Wort überhaupt gebraucht wird. Diese findet sich bei Wörtern, die aus anderen üblichen Wörtern nach den Bildungsgesetzen der Sprache beliebig abgeleitet werden können, aber doch nur dann wirklich zur Verwendung kommen, wenn ein besonderes Bedürfnis dazu treibt. Solche Wörter sind vielfach von Anfang an nur mit einer spezielleren Beziehung zum Grundwort nachzuweisen, als sie die Ableitung an sich ausdrückt.“ (230f.) Man kann also gerade umgekehrt sagen: Die Bedeutung eines neu gebildeten Wortes ist in der Regel nicht ableitbar, man muß jeweils den konkreten Anlaß seiner Neubildung kennen. So sind auch die zuvor angeführten Neologismen wie Tanzbodensmasher oder Zwangspaypalisierung keineswegs durchsichtiger als die späteren Cocktailphantasie oder Wolkenhandy. Der Hörer ist (...) nicht nur ein passiver Empfänger, der entweder richtig oder falsch versteht. Vielmehr ist Verstehen ein aktiver kognitiver Prozess eines Individuums, das eigene Ziele verfolgt, die sich im Normalfall von denen des Sprechers unterscheiden.(242) Ein weiterer Fall der beliebten Rede von „aktiven“ und „passiven“ Prozessen (hier sogar „Prozessen eines Individuums“, was immer das sein mag); der Unterschied ist noch von keinem Psychologen erklärt worden; es ist eben sinnlos, auf der Ebene von Prozessen von Aktivität und Passivität zu sprechen. Fazit: Für Anfänger zu schwer lesbar, zum Teil wegen des Jargons. Fortgeschrittene könnte das Buch zur Wiederholung benutzen, aber an die Klassiker (wie Pauls Prinzipien) kommt es nicht heran. Störend auch, daß altbekannte Tatsachen fast immer mit neuesten Autoren (Nübling, Szczepaniak) belegt werden, als hätten diese sie entdeckt. |
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 27.11.2012 um 13.02 Uhr |
|
Wenn wir einem Außerirdischen alle Dinge, die es auf der Erde gibt, ausgenommen Katzen, genauestens beschreiben würden, wüßte er immer noch nicht, was eine Katze ist. Solange er das aber nicht weiß, können wir uns die Beschreibung der anderen Dinge sparen, weil wir dann ja auf die angeblich notwendige Abgrenzung zur Katze verzichten müßten. Natürlich muß das Zeichen Rot bei einer Ampel anders sein als die Zeichen Gelb und Grün, aber nur dann, wenn man den verschiedenen Farben verschiedene Bedeutungen zuweist. Theoretisch könnte man sich auch darauf verständigen, daß jegliches Lichtzeichen, gleich welcher Farbe, an einer Kreuzung ein Haltegebot signalisiert. Für mich ist das eine positive Festlegung. Natürlich kann man die nun wieder umdeuten als negative Festlegung der Art »nicht kein Lichtzeichen«, aber ist das nicht furchtbar trivial? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.11.2012 um 09.34 Uhr |
|
Zu den fatalen Folgen Saussures gehört das strukturalistische Dogma von der Negativität des Zeichens. Bei Saussure finden sich Formulierungen wie diese: "Was die Phoneme charakterisiert, ist nicht ihre eigene und positive Qualität, sondern die Tatsache, daß sie sich nicht untereinander vermengen." Heute liest sich das ungefähr so: "Die Bedeutung eines Zeichens besteht in der Abgrenzung gegenüber den Bedeutungen aller anderen Zeichen". (Heinz Vater: Das System der Artikelformen im gegenwärtigen Deutsch. Tübingen 1963:5) Aber aus lauter negativen Bestimmungen läßt sich kein System bilden. Eugenio Coseriu bemerkt kühl: "Es ist absurd zu behaupten, die Katzen seien Katzen, nur weil sie keine Hunde sind." Im Grunde meint man es auch gar nicht ernst: „Ein Zeichen muß vor allen Dingen von anderen Zeichen verschieden sein. Es muß distinktiv sein, wie man in der allgemeinen Zeichentheorie zu sagen pflegt. Es ist nicht nur es selbst, sondern es ist zugleich NICHT die anderen Zeichen. Rot bei der Verkehrsampel, um es an einem einfachen Beispiel zu erläutern, könnte auch Rosa oder Violett sein, aber es muß vor allen Dingen NICHT GELB und NICHT GRÜN sein.“ (Harald Weinrich: Sprache in Texten. Stuttgart 1976:325) Das ist natürlich gemogelt. Rosa und Violett liegen noch nahe genug bei Rot, um als Varianten gelten zu können. Wie wäre es mit Blau oder Weiß? Die Verschiedenheit genügt also keineswegs. Auf die Sprache übertragen, wirkt das Dogma sofort absurd. Natürlich kann ich in einem Text jedes a durch ein Sternchen ersetzen, aber nur, weil die Schrift und die Sprache redundant genug sind, so daß eine geringfügige Entstellung meist rückgängig gemacht werden kann. Verschiedenheit ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Zeichen. Muß man darüber diskutieren? Von derselben Trivialität sind die übrigen Lehren des Strukturalismus. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.11.2012 um 09.01 Uhr |
|
Die KMK hat bekanntlich ein ab und zu überarbeitetes Verzeichnis grammatischer Fachausdrücke für die Schulen herausgegeben. Das sprachliche Zeichen wird so definiert: "Verbindung von Lautbild/Schriftbild und Bedeutung" Das ist natürlich nachgeplapperter und nochmals vereinfachter Saussure. Verkorkster geht es nicht. Sprachliche Zeichen sind Verhaltenseinheiten mit einer Funktion. Die Funktion wird ihnen durch Konditionierung verliehen. (Kinder lernen, wie man Wörter gebraucht.) Im Grundkurs der philologischen Studienfächer lernen die Erstsemester denselben Unsinn, zum Teil noch schlimmer, alles völlig unkritisch auf den Verrückheiten Saussures aufgebaut, die von einer Generation zur anderen nachgesprochen werden. Kritische Nachfragen sind nicht erwünscht, sie halten den knapp kalkulierten Semesterplan auf. Gerade weil Saussures Zeichenbegriff praktisch folgenlos bleibt, wird er dogmatisch beibehalten. Es gibt praktisch kein Einführungsbuch, das nicht mit absurden Zeichenmodellen beginnt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.11.2012 um 15.42 Uhr |
|
"J'ai toujours eu la rage de faire des systèmes avant d'avoir étudié les choses par le détail." Man könnte meinen, das habe ein einsichtsvoller Gelehrter selbstkritisch am Ende seiner Karriere gesagt. Aber Saussure war 15, als er es schrieb! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.10.2012 um 06.16 Uhr |
|
Der Anglist Heinrich F. Plett hat vielgelesene Bücher verfaßt, darunter "Textwissenschaft und Textanalyse", Heidelberg 1975. Zum Zeichenbegriff sagt er u. a.: "Ein Zeichen beruht auf sozialer Konvention." Das schließt zunächst einmal alle natürlichen Zeichen aus.Weder die Vögel noch die Bienen haben etwas vereinbart. Aber auch menschliches Zeichenverhalten beruht größtenteils nicht auf "Konvention", falls dieser Begriff noch einen Sinn haben soll." "Ein Zeichen steht für etwas, das es ersetzt." Wofür steht das ausdrücklich erwähnte Verkehrszeichen (rotes Licht für Halt!), was ersetzt es? Auch Anaphorik wird als Ersetzung definiert. Aber in dem Beispiel Hans liest ein Buch. Es handelt von der Textlinguistik ist Ersetzung in keiner Richtung möglich. Wie kann man denn das übersehen? "Zeichen sind organisiert in Zeichenklassen." Das ist die Saussuresche Doktrin vom System, das sogar Vorrang vor dem Einzelzeichen haben soll. Auch Bierwisch glaubt daran. Aber ich kann einem Hund ein einzelnes Zeichen beibringen (Sitz!), ohne jedes System. Generationen von Studenten lernen so krauses Zeug, das man mehr oder weniger in sämtlichen Einführungsbüchern findet. Auf Pletts Homepage liest man übrigens: Universität Duisburg-Essen, Campus Essen Fakultät für Geistesiwissenschaften (!) Institut für Anglophone Studien Universitätsstraße 12 45141 Essen Daß die Anglistik neuerdings "Anglophone Studien" heißt, ist mir neu und kommt mir sprachlich falsch vor. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.05.2012 um 09.11 Uhr |
|
Christine Römer/Brigitte Matzke: Der deutsche Wortschatz. Struktur, Regeln und Merkmale. Tübingen (Narr) 2010. Studienbücher werden nach der Bologna-Reform am Fließband produziert, und die Verlage drucken alles, ohne auch nur einen Blick darauf geworfen zu haben. Das vorliegende Buch ist eine wirre Zusammenstellung aller möglichen Einfälle, die oft kaum mit dem Thema zu tun haben, aber stets durch Zitatschnipsel belegt werden. Für Studenten ist es weitgehend unverständlich, und der Fachmann erkennt überall die Banalität oder Verkehrtheit hinter dem Wortschwall. Unkonzentriert wie das ganze Buch wirkt gleich der erste Satz des Vorworts: „Das Lehrbuch (...) stellt das komplexe Phänomen 'deutscher Wortschatz' vor, indem dieses aus verschiedenen inhaltlichen und methodischen Perspektiven betrachtet wird.“ (V) Die hilflose Verknüpfung mit „indem“ ist so bezeichnend wie die Aufblähung des nichtigen Inhalts durch pseudowissenschaftliche Ausdrücke. Typisch für den Stil des ganzen Buches ist auch dieser Abschnitt: „Neben dem kognitiven Wissenssystem sind auch die Prozesse der Sprachverarbeitung (Sprachproduktion und Sprachverstehen) für die Sprachfähigkeit konstitutiv. Außerdem kann eine funktionierende Kommunikation nicht nur auf der Basis des Sprachwissens erfolgen, sie resultiert vielmehr aus dem Zusammenwirken mehrere kognitiver Fähigkeitssysteme, die eigene Regeln haben.“ (76) Man sollte nicht versuchen, über den Sinn solcher Sätze, insbesondere des „neben“ und „außerdem“ oder auch nur „kognitiv“ genauer nachzudenken. Wie schon im Morphologie-Buch Römers werden Bruchstücke aus allen möglichen Theorien und Bereichen der Sprachwissenschaft durcheinandergemischt. So ist die Seite über „Das syntaktische Wort“ praktisch unverständlich. Fast jede Aussage, sei sie noch so banal, wird durch ein Zitat oder einen Literaturverweis belegt. „Nach Fritz (1998) hat seit Beginn der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die wissenschaftliche Beschäftigung mit der historischen Semantik international deutlich zugenommen.“ (211) Aber die Bedeutungsgeschichte ist seit Beginn der historischen Sprachwissenschaft eines ihrer Hauptthemen und hat, wenn man von der generativen Grammatik absieht, nie nachgelassen. Sehr viele oberflächliche und oft geradezu falsche Aussagen. „Phraseologismen im engeren Sinne sind häufig bildhaft und haben bewertenden Charakter.“ (19) In Steckt niemals den Sand in den Kopf soll ein „Verstoß auf syntaktischer Ebene“ vorliegen, und zwar gegen Reihenfolgeregeln. (4f.) Aber die Syntax ist ganz in Ordnung. Die Terminologien der Fachsprachen werden überraschenderweise unter „temporäre Lexik“ subsumiert: „Temporäre Soziolekte betreffen nur eine ‚gewisse Zeit im Tages- oder Jahresablauf [...] Freizeitgruppen, Hobbygemeinschaften, andere Tages- oder Nachtvergnügungsgruppen mit eigenem Jargon oder Wortschatz (Löffler, 1994). Hierher gehören auch die Berufs-(Fach-)Sprachen.“ Seltsamer ist Fachsprache wohl noch nie eingeordnet worden. Römer scheint von der Tatsache beeindruckt zu sein, daß der Fachmann nicht Tag und Nacht Fachsprache spricht. Unter dem Titel „Politisch ‚korrekte‘ Motivierungen“ streut Römer eigene politische Meinungen aus: „Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Rüttgers verunglimpfte 2009 in einer Rede alle rumänischen Arbeiter. Er hatte bei einem Wahlkampfauftritt in Duisburg mit Blick auf die Verlegung des Bochumer Nokia-Werkes gesagt, die Beschäftigten in Rumänien kämen zur Arbeit, ‚wann sie wollen, und sie wissen nicht was sie tun‘. Damit bereitete er den Nährboden für Fremdenfeindlichkeit‘.“ (Letzteres ist ein Zitat aus der Süddeutschen Zeitung, deren Meinung als Tatsachenbehauptung übernommen wird.) Römer fährt fort: „2005 hatte Steuber (!) als Ministerpräsident von Bayern im Wahlkampf geäußert: ‚Ich akzeptiere nicht, dass der Osten bestimmt, wer in Deutschland Kanzler wird. (....) Diese pauschalen Beleidigungen aller Ostdeutschen löste (!) damals zu Recht eine große Empörung aus.“ (68) - Was das alles mit dem deutschen Wortschatz zu tun hat, ist nicht erkennbar. In diesem Kapitel schreibt sie „ausserdem“ und „heisst“. Der Plural von „Etymon“ soll „die Etymone“ heißen. (104) Das Buch ist völlig unbrauchbar und gehört nicht in einen sprachwissenschaftlichen Verlag. Studenten bringt es in Gefahr, ihre knappe Bologna-Workload-Zeit mit Grübeleien über den Sinn des Gelesenen zu vergeuden, weil sie nicht gleich erkennen können, daß es einen solchen Sinn gar nicht gibt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.02.2012 um 17.01 Uhr |
|
Jochen Geilfuß-Wolfgang: Worttrennung am Zeilenende. Tübingen:Niemeyer 2007 Die Dissertation behandelt fast nur silbenphonologische Aspekte und didaktische Fragen. Zur morphologischen Trennung besonders bei Fremdwörtern findet man fast gar nichts. Nur eine Fußnote: „Hierzu gibt es eine hübsche Bemerkung in Kohrt (1992): 'Wer sein Bildungsbürgertum unbedingt beweisen will, der soll auch fürderhin ein Wort wie Diphthong als (Di-phthong) trennen können und es nicht als (Diph-thong) auf zwei Zeilen verteilen, aber allen anderen sollte zugleich ausdrücklich die andere Lösung gestattet sein.' Das ist jetzt glücklicherweise der Fall.“ (68) So einfach ist das nicht (abgesehen davon, daß fast alle heutigen Sprachwissenschaftler sowieso „Diphtong“ schreiben, also schon weit diesseits der Frage nach dem Bildungsbürgertum versagen). Wie wir wissen, hat sich die Fremdworttrennung in vielen Fällen zu einer Zweiklassenorthographie entwickelt. Das „Bildungsbürgertum“ ist übrigens aus unerfindlichen Gründen zum Haßobjekt von Leuten geworden, die sich eigentlich dazu rechnen müßten. Ich weiß nicht, ob Soziologen es überhaupt noch verwenden. Daß die reformierte Worttrennung bildungspolitische Fragen aufwirft, haben wir anderswo diskutiert. Der Verfasser kann sich offenbar nicht vorstellen, daß es für einen Menschen, dem das Wort „Diphthong“ leicht von den Lippen geht, auch noch andere Gründe als Bildungsprotzerei geben könnte, es morphologisch zu trennen. Er reiht ja auch Am-nesie und Gym-nasium aneinander, als handele es sich um gleichartige Fälle. (27) Noch eine Fußnote: „Ich verstehe nebenbei bemerkt nicht, warum man o zwar nicht im Kompositum Biomüll abtrennen dürfen soll, aber in der Ableitung Maoist.“ (65) Wenn er wenigstens einen guten Grund für sein Unverständnis hätte, nämlich den volkspädagogischen, der mich in meinem Wörterbuch dazu bewogen hat, „Mao“ als einsilbiges Wort zusammenzuhalten, damit die lieben Deutschen sich endlich mal an eine passable Aussprache gewöhnen. Kurzum: Für jemanden, der sich jahrelang wissenschaftlich mit der Worttrennung beschäftigt hat, wirkt das Buch doch recht unbedarft. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 06.02.2012 um 18.24 Uhr |
|
Leider gibt es nur im Spanischen die auf den Kopf gestellten Frage- und Ausrufezeichen vor direkten Frage- und Ausrufesätzen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.02.2012 um 18.00 Uhr |
|
Ursula Bredel: Interpunktion. Heidelberg 2011. Das Büchlein ist eine vereinfachte Kurzfassung der Habilitationsschrift: Die Interpunktion des Deutschen. Ein kompositionelles System zur Online-Steuerung des Lesens. Tübingen 2008. Bredel will die deutsche Interpunktion als System darstellen. Sie beschreibt daher nur solche Verwendungsweisen der Satzzeichen, die in das angenommene System passen. Formal werden die Zeichen durch Merkmalpaare charakterisiert. Das überzeugt nicht immer: Die Auslassungspunkte werden zu den Zeichen ohne Grundlinienkontakt gezählt (Merkmal LEERE), weil sie das früher einmal waren. (16: „ansetzend an ihrer historisch frühen Form“) Das ist ein methodischer Fehler, weil das System nur synchron beschrieben werden darf. Der Gedankenstrich wird ohne Begründung zu den reduplizierenden Zeichen gerechnet, obwohl er nicht aus mindestens zwei sich wiederholenden gleichen Basiselementen besteht. (Die in vielen Schriften unterschiedliche Form von doppelten An- und Abführungszeichen wird nicht berücksichtigt.) Vielleicht sieht Bredel im Gedankenstrich einen verdoppelten Trennungsstrich? Einfache Anführungszeichen kommen in Bredels System gar nicht vor. Durch diese Entscheidungen werden die „Markiertheits“-Verhältnisse stark beeinflußt. Und umgekehrt: Obwohl die Verfasserin das gewachsene System und nicht die verordnete Norm untersuchen will, nimmt sie immer wieder reformierte Regeln unkommentiert auf, z. B. den neuen Apostroph in Adjektiven, die von Eigennamen abgeleitet sind. Die Verfasserin übernimmt auch den heute verbreiteten Psychologismus (mentale Zustände, Wissenssuche, Sprachverarbeitungsprozess usw.). Daß Scanning und Processing nur Simulationen sein können, scheint sie entweder nicht zu bemerken oder nicht anzuerkennen. Dem alten Duden (1991) wirft sie vor, das Fragezeichen auf den „direkten Fragesatz“ zu beziehen, der jedoch formal definiert sei. Dadurch würde die Interpunktion in Karl kommt schon wieder zu spät? nicht erfaßt. Aber im Duden ist der direkte Fragesatz gar nicht so definiert. Wahrscheinlicher ist, daß er ihn als syntaktisch unabhängige, nicht hypotaktische Frage verstanden wissen wollte. Sowohl aus der Dudengrammatik von 1995 (S. 594) als auch aus Duden Bd. 9 von 1985 (S. 255) geht hervor, daß der indirekte Fragesatz der unabhängige und der indirekte der abhängige sein soll: „Neben dem selbständigen oder direkten Fragesatz steht als Nebensatz der indirekte Fragesatz.“ Bredel versteht unter „indirekter Frage“ gerade solche Sätze wie Karl kommt schon wieder zu spät? – also die Intonations- oder Assertionsfrage. „Das Fragezeichen macht den Leser zum Wissenden, das Ausrufezeichen macht ihn zum ausgezeichneten Nicht-Wissenden.“ (56) Frage und Ausrufezeichen „weisen Schreibern/Lesern verschiedene Wissenszustände zu.“ (65) Ist damit die Verwendung erklärt? Es ist doch nicht die Funktion des Fragezeichens, dem Leser ein Wissen zuzuschreiben. Diese Zuschreibung ist die Voraussetzung des Fragens. Zur Stammkonstanzschreibung: „Die Reformer von 1996 haben dieses Prinzip gestärkt: So wurde der Stengel zum Stängel, selbständig zu selbstständig etc.“ (33) Das ist teils falsch, teils einseitig. Übrigens verstößt die Verfasserin hier gegen ihre eigene Regel, daß Zitate manchmal ohne Artikel stehen müssen: „„Fräulein“ wird nicht gebeugt vs. *Das „Fräulein“ wird nicht gebeugt.“ (59) Ob Anführungszeichen oder die in der heutigen Philologie übliche Kursivierung – das ändert ja nichts am Zitatcharakter des objektsprachlichen Materials. Über den Ergänzungsgedankenstrich wie in Du bist ein –! schreibt sie, er sei seit 1996 „nicht mehr lizenziert“ (mit einem modischen Ausdruck aus der generativen Grammatik). Nun, er wird in der Neuregelung nicht erwähnt, und man könnte hier die neuere Auskunft des Rechtschreibrates zum feministischen Binnen-I heranziehen: daß es nicht erwähnt werde, bedeute nicht, daß es unzulässig sei. Beim Worttrennungsstrich erwähnt sie leider nicht die reformierte Nichttrennung des ck, so daß man auch eine Einschätzung dieser neuen Vorschrift vermißt; es wäre ganz interessant gewesen (39). Primus soll zuerst die drei Kommaverwendungen (satzinterne Satzgrenze, Koordination, Herausstellung) identifiziert haben (68). Das haben aber andere unter anderen Bezeichnungen auch schon getan (hypotaktisches Komma, Aufzählungskomma, appositives Komma). S. 71: Kritik der reformierten Kommasetzung bei Infinitivsätzen, durchaus berechtigt. Hingegen sei das Komma bei mit und verbundenen Hauptsätzen mit Recht freigestellt worden, weil es eine zusätzliche Markierung der Syndese sei – was zwar stimmt, aber wegen der vielen Mißverständnismöglichkeiten war es trotzdem sinnvoll! (Vgl. § 19 (3) in meinem Rechtschreibwörterbuch.) „Dem Punkt wurde überall die Funktion zugesprochen, den Satzschluss zu markieren.“ (78) Bei mir nicht! (Aber Kritiker der Rechtschreibreform liest man ja nicht ... Bei Bredel ist kein einziger Reformkritiker verarbeitet.) Für den Bindestrich (Divis genannt) wird eine einheitliche Funktion angenommen (wie bei mir). Das Buch enthält zahlreiche orthographische Fehler. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.11.2011 um 09.55 Uhr |
|
Das erwähnte Buch von Ursula Bredel ist übrigens ein Sammelsurium von Theoriefetzen, wie man es bei Sprachdidaktikern nicht selten findet, außerdem zwar reformiert-orthographisch und politisch korrekt, aber in schwerfälliger Sprache geschrieben. Immer wieder solche Sachen: Formen der Verfügbarkeit über grammatische Strukturen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.11.2011 um 09.39 Uhr |
|
Die arabische Sprachwissenschaft hat mich schon vor Jahrzehnten sehr interessiert, zumal wegen der feinen Lehre von der Determination, auf die ich durch einen damals gerade erschienenen Aufsatz von Helmut Gätje aufmerksam geworden bin (in: Arabica 17, 1970:225-251). Ich habe damals über Deixis gearbeitet, im Anschluß an Bühler, und die Araber haben mich auf gute Gedanken gebracht, über die ich mich auch mit meinem Lehrer und Freund Otto Rössler austauschen konnte. Aber bei aller Hochschätzung der Eigenleistung ist die arabische Nationalgrammatik offensichtlich von der griechischen abhängig. Deshalb habe ich sie nicht eigens erwähnt.
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 07.11.2011 um 18.55 Uhr |
|
Laut Thomas Bauer, Arabistik-Professor an der Uni Münster, gab es im Mittelalter eine hochentwickelte arabische Sprachwissenschaft. Hundert Jahre nach Mohammeds Tod war im ganzen Reich eine einheitliche funktionstüchtige Verwaltungssprache durchgesetzt.Das erste "richtige" arabische Buch (vom Koran abgesehen) war eine arabische Grammatik anhand der Normen der Sprache der arabischen Beduinen.Es gab eine alphabetisch geordnete Sammlung des altarabischen Beduinenwortschatzes. In Europa kam die Lexikographie erst im 19. Jahrhundert auf das Niveau, auf dem es in der arabischen Welt schon fast ein Jahrtausend früher angekommen war. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gab es in Europa keine Sprachwissenschaft auf einem Niveau, das eine Rezeption der arabischen Theorien ermöglicht hätte. Im 19. und 20. Jahrhundert, als eine solche Rezeption möglich gewesen wäre, war der Westen so sehr von seiner Überlegenheit über alle anderen Kulturen überzeugt, daß er auch auf die arabische Linguistik nur noch einen ethnologischen Blick werfen konnte, aber nicht mehr mit der Möglichkeit rechnete, von einer anderen Kultur auf dem Gebiet der Wissenschaft etwas lernen zu können.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.11.2011 um 12.26 Uhr |
|
Ursula Bredel: Sprachbetrachtung und Grammatikunterricht. Paderborn 2007. Darin S. 38: „Umso mehr mag überraschen, dass die Ausdrücke Wort und Satz nach dem, was man bisher weiß, nur in solchen Kulturen vorkommen, die verschriftet sind.“ - „Orate Kulturen 'kennen weder eine Linguistik, noch kennen sie deren 'Gegenstände' in der uns selbstverständlich vertrauten Form' (Knobloch 2003:107) Das schreibt einer vom anderen ab, aber richtiger wird es dadurch auch nicht. Die unglaublich hoch entwickelte altindische Sprachwissenschaft ist rein mündlich entwickelt worden; sogar die künstlichen Symbole, die Panini für grammatische Zwecke verwendet, sind auf Sprechbarkeit angelegt und unterliegen beispielsweise dem Sandhi. Dagegen haben die schriftbestimmten Chinesen kaum eine Sprachwissenschaft entwickelt, allenfalls lexikographische Werke hervorgebracht. Wie viele Sprachwissenschaften sind denn unabhängig voneinander entwickelt worden, daß eine solche pauschale Aussage überhaupt möglich wäre? Ich kenne nur zwei, die griechische und die indische, und aus deren Zusammenführung um 1800 entstand die heute weltweit betriebene Linguistik. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.07.2011 um 10.17 Uhr |
|
Wie ich gerade sehe, kann man einen Teil von Römers Buch online lesen: http://downloads-grammatik.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/morphologiekap.1-3.pdf |
Kommentar von stefan strasser, verfaßt am 08.10.2008 um 21.39 Uhr |
|
Tolle Wortkreationen: Sprechtätigkeit, Klavierspieltätigkeit Statt 'ich spreche' kann man auch sagen: ich übe die Sprechtätigkeit aus und statt ich kann nicht klavierspielen: ich tu mir mit der Ausübung der Klavierspieltätigkeit sehr schwer. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.10.2008 um 17.50 Uhr |
|
Oft habe ich mich gefragt, was die Sprachwissenschaft so wehrlos gemacht hat, daß sie sogar die Zumutung "Rechtschreibreform" widerstandslos hinnahm. Eine Teilantwort: Ein Jahrhundert Strukturalismus und fast ein halbes Jahrhundert generative Grammatik haben das Interesse an den Tatsachen sehr gemindert. Nach Chomsky ist ja die Sprache, die wir hören und lesen können, nicht die eigentliche, sondern die eigentliche Sprache (I-language) spielt sich "im Geist" ab. Das Desinteresse an den Tatsachen haben schon viele beanstandet, z. B. Esa Itkonen (Verschiedenes zum Herunterladen, sehr gut seine Chomsky-Kritik). In einem vielbenutzten und sonst gar nicht so schlechten Einführungsbuch war zu lesen: „Da auf die menschliche Sprechtätigkeit und Sprechfähigkeit zutrifft, daß sie in ihrem Ablauf nicht beobachtbar sind ...“ (Heidrun Pelz 1996:43) Eine Sprachwissenschaft, die mit der Behauptung anfängt, die Sprechtätigkeit sei nicht beobachtbar, ist wohl nicht besonders gut gerüstet, einem solchen Humbug wie der RSR entgegenzutreten. (Ist etwa die Klavierspieltätigkeit auch nicht hörbar? Warum gehen denn die Leute ins Konzert?) |
Kommentar von Germanist/Red., verfaßt am 07.10.2008 um 13.25 Uhr |
|
In dem (kürzlich wieder gesendeten) Film "Die Abenteuer des braven Soldaten Schweik" . . . Hiermit möchten wir Sie bitten, sich wegen einer Anmeldung zum Forum mit uns in Verbindung zu setzen (E-Mail-Adresse "info AT sprachforschung.org", in der Betreffzeile bitte als erstes "S&R" angeben, damit Ihre Mail bei eventuellen Problemen mit dem Spamfilter nicht verlorengeht). Nach der Anmeldung können Sie Ihren Kommentar (welchen die Redaktion für Sie aufgehoben hat) an der passenden Stelle eintragen. Mit freundlichen Grüßen; Redaktion "Schrift & Rede" |
Kommentar von Borne, verfaßt am 19.09.2008 um 00.53 Uhr |
|
"Das Buch ist in der amtlichen Orthografie abgefasst." Diese bedingungslose Staatstreue ist einfach ekelerregend. Ich erinnere mich gerade an meinen ehemaligen Linguistik-Professor. Bei ihm handelt es sich um einen Gelehrten der "alten Schule", den ich auch unabhängig von seiner fachlichen Kompetenz sehr bewundere und schätze. Er sagte vor vier Jahren wörtlich in einem Hauptseminar: "An dem Tag, an dem man mich zwingt, diese Stußschreibung/Stussschreibung zu verwenden, werde ich meinen Dienst quittieren." (Er war auch einer der Mitunterzeichner der 'Gemeinsame Erklärung von Professoren und Professorinnen der Sprach- und Literaturwissenschaft zur Rechtschreibreform'.) |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 15.09.2008 um 15.59 Uhr |
|
Immerhin erfüllt "ich möchte" eine Anwendungsform des Konjunktiv II, nämlich die "vorsichtige Feststellung", die dem Angesprochenen die Möglichkeit der Ablehnung läßt. Allerdings gibt es auch Anwendungen des Konjunktiv II, die tatsächlich Indikative bedeuten: "Ich würde sagen, meinen u. ä."
|
Kommentar von Kelkin, verfaßt am 15.09.2008 um 07.51 Uhr |
|
Gestatten die Nachfrage eines interessierten Laien: Wenn 'möchten' ein Verb ist, müsste es dann nicht auch eigene Konjunktive und eigene Zeiten bilden? Meines Wissens ist kein einziges deutsches Verb so defektiv, daß es nur Formen im 'Präsens aktiv' hat. Außerdem kann man keinen Infinitiv 'möchten' mit Hilfs- oder Modalverben verbinden. In manchen Beiträgen liest man, dem Konjuntiv 'möchte' von 'mögen' würde 'Vollverbcharakter' zugebilligt. Das scheint mir ein eleganter Kompromiss, denn wenn man Ausdrücke wie "Möchten Sie ein Eis?" nicht mehr als Konjunktiv begreift, dann deswegen, weil andere Verben ihn in vergleichbarer Verwendung nicht mehr bilden ("Hülfen Sie mir bitte aus?"). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.09.2008 um 08.37 Uhr |
|
Der Infinitiv "möchten" ist vielfach belegt (leider finde ich meine Belegsammlung gerade nicht); er zeigt die Verselbständigung gegenüber "mögen" an. Die Literatur zu den Modalverben (Öhlschläger u.a.) tut recht daran, den analog gebildeten Infinitiv zu behandeln.
|
Kommentar von Christoph Schatte, verfaßt am 13.09.2008 um 23.27 Uhr |
|
Übrigens: Die Autorin dieser Einführung hat sich lange vor dieser hinreichend zu erkennen gegeben, so daß man über diese weitere (als Qualifikationsschrift gesetzte) Epistel eher den Mantel betretenen Schweigens breiten sollte.
|
Kommentar von Christoph Schatte, verfaßt am 09.09.2008 um 22.56 Uhr |
|
Herrn Kelkin fiel auf, daß die deutschen Morphologen es halten wie Nolte. So übte sich einst Motsch in einem gut rezipiertem Aufsatz in der heimlichen Vertauschung von Determinans und Datermidandum, tarnte sich aber um die Entdeckung des so kreierten baren Unsinns mit Scheinformalismen herum, die mittelmäßig ausgerüstete Studenten ad absurdum führen können. Das ficht Fleischer & Barz indessen nicht an. Sie "umschreiben" usw. deutsche Nominalkomposita, wie ihnen der Geist (egal welcher) es eingegeben hat. Wo sie nicht weiterkommen, ist die linear zweite Komponente zuweilen Bestimmungswort. Daß dies keine linguistischen oder semiotische Lachanfälle auslöst, stimmt bedenklich. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 09.09.2008 um 13.29 Uhr |
|
Für Deutsche ist es gewöhnungsbedürftig, daß "ich möchte" in andere Sprache meist mit dem Konjunktiv II von wollen übersetzt werden muß, damit es nicht unhöflich wirkt.
|
Kommentar von Kelkin, verfaßt am 09.09.2008 um 10.14 Uhr |
|
Ad „Wenn die Modalverben wollen und sollen (...)“ (96) Hier muß es statt sollen anscheinend möchten heißen, sonst gibt der Satz keinen Sinn. Gibt es ein Verb 'möchten'? Ich hielt 'möchte' immer für den Konjunktiv II von 'mögen'. Von der Form 'möchten' kann man keine Konjunktive ableiten. Ad Strumpfhose wird als „Strumpf in Hosenform“ gedeutet und damit als Beispiel umgekehrter Determinationsrichtung. Das ist aber unnötig, „Hose in Strumpfform“ ist völlig normal. Man sollte vorab klären, ob der 'Archistrumpf' einbeinig ist und die 'Archihose' zweibeinig oder umgekehrt. Da dieses Beispiel zu sehr von der Interpretation einer außersprachlichen Wirklichkeit abhängt, schlage ich z.B. 'CD-ROM' vor. Man kauft keine ROM sondern eine CD. Vielleicht auch 'Forelle blau' oder 'Arbeitslosigkeit Ost'. |
