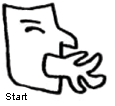


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
31.10.2013
Das „bilaterale Zeichen“
Bemerkungen über Saussures schweres Erbe
Es gibt kaum eine Einführung in die Sprachwissenschaft, die nicht zu Beginn unter Berufung auf Ferdinand de Saussure den „bilateralen Zeichenbegriff“ als semiotische Grundlage vorstellte. (Die kleine sprachliche Härte – statt „Begriff des bilateralen Zeichens“ – ist wohl hinnehmbar.)
Dieser Begriff und die damit verbundene Lehre sollen hier kritisch betrachtet werden. Dabei geht es nicht um die wissenschaftsgeschichtliche Frage, was Saussure wirklich gesagt und gemeint hat (Saussure-Exegese ist eine Wissenschaft für sich), sondern um die heute weithin herrschenden Ansichten und Redeweisen; sie stützen sich auf die postume Kompilation der Vorlesungsnachschriften, im Deutschen in der Übersetzung Hermann Lommels.
Ich skizziere vorweg den Zeichenbegriff einer naturalistischen Zeichen- und Sprachtheorie.
Zeichenmodelle versuchen der Tatsache gerecht zu werden, daß ein Zeichen sich nicht in seiner physischen Beschaffenheit erschöpft, sondern etwas bedeutet oder bezeichnet oder auf etwas anderes verweist. Aus naturalistischer Sicht erklärt sich diese Tatsache als Folge der Zeichenentstehung. Ein morphologisches Merkmal oder ein Verhalten eines Lebewesens löst bei einem anderen Lebewesen - das nicht derselben Art angehören muß - ein Verhalten aus, das sich arterhaltend auf ersteres auswirkt. Wenn die Bienen „lernen“, daß bestimmte Blütenformen und -gerüche auf Nektar hinführen, geraten die Blüten, deren Bestäubung dadurch wahrscheinlicher wird, unter Selektionsdruck (wie man mit einer harmlosen Metapher sagt). Sie werden prägnanter, auffälliger, unverwechselbarer. Handelt es sich um das Verhalten, so spricht man von „Ritualisierung“.
Auch in der ontogenetischen, lerngeschichtlichen Dimension können Zeichen durch solche „empfangsseitige Semantisierung“ (Wolfgang Wickler) entstehen. An die Stelle der natürlichen Selektion tritt die Konditionierung. Eine Taube lernt in kurzer Zeit, daß sie durch Picken auf eine Scheibe zu Futter gelangen kann. Die Scheibe bekommt einen Signalwert, den sie zuvor nicht hatte, hört aber deshalb nicht auf, ein Reiz wie jeder andere zu sein. Die Reaktion kann von weiteren diskriminierenden Reizen abhängig gemacht werden. Der etwas andersartige Ablauf beim klassischen (Pawlowschen) Konditionieren ist bekannt. Skinners „Verbal Behavior“ stellt die Entwicklung des Sprachverhaltens nach diesem Muster dar. Wenn wir aus Gründen der Vereinfachung zunächst von schriftlichen Texten und anderen Hinterlassenschaften absehen, sind sprachliche Zeichen Verhaltensabschnitte, denen durch die Reaktion eines Partners eine bestimmte Funktion zugewachsen ist. Skinner faßt zusammen:
„Meaning or content is not a current property of a speaker's behavior. It is a surrogate of the history of reinforcement which has led to the occurrence of that behavior, and that history is physical.“ (B. F. Skinner in A. Charles Catania/Stevan R. Harnad (Hg.): The selection of behavior. The operant behaviorism of B. F. Skinner: Comments and consequences. Cambridge u.a. 1988:238)
Die phänomenologische Sicht der traditionellen Semiotik, zu der sich auch Saussure rechnen läßt, verzichtet auf diesen „genetischen“ oder „historischen“ Aspekt, versucht die Bedeutung als gegenwärtige Eigenschaft des Zeichens zu begreifen und steht daher vor der „Bedeutung“ der Zeichen als einem Rätsel, dem „Wunder des Bedeutens“ (Hans Lenk: Von Deutungen zu Wertungen. Frankfurt 1994:40). Der bilaterale Zeichenbegriff ist ein Versuch, dieses Rätsel zu lösen. Nach Saussure besteht das sprachliche Zeichen aus zwei Komponenten, einer Lautvorstellung (dem Bezeichnenden, signifiant) und einer Gegenstandsvorstellung (dem Bezeichneten, signifié), die – als Vorstellungen – beide psychischer Natur sind. Mit seinen eigenen Worten:
„Wir haben beim Kreislauf des Sprechens gesehen, daß die im sprachlichen Zeichen enthaltenen Bestandteile alle beide psychisch sind, und daß sie in unserem Gehirn durch das Band der Assoziation verknüpft sind. (...) Das sprachliche Zeichen vereinigt in sich nicht einen Namen und eine Sache, sondern eine Vorstellung und ein Lautbild.“ (Ferdinand de Saussure: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Berlin 1967:77)
„Stellen wir uns vor, daß eine gegebene Vorstellung im Gehirn ein Lautbild auslöst: das ist ein durchaus psychischer Vorgang, dem seinerseits ein physiologischer Prozeß folgt: das Gehirn übermittelt den Sprechorganen einen Impuls, der dem Lautbild entspricht“ usw. (ebd. 14)
(Zwischenbemerkung: Manche sprechen auch von „trilateralen“ Zeichenmodellen, etwa bei Peirce, Ogden/Richards oder Morris – die aber auch für ein „monolaterales“ Modell in Anspruch genommen werden – und Bühler, schließlich von „monolateralen“ wie dem behavioristischen Skinners, aber das ist wenig sinnvoll und soll hier nicht weiter berücksichtigt werden.)
Wie man sieht, bewegt sich Saussure innerhalb einer Psychologie, wie sie damals allgemein üblich war („Band der Assoziation“), und ersetzt auch das Psychische umstandslos durch das „Gehirn“. Diese psychologische oder gar neurologische Deutung des bilateralen Zeichens ist aber nicht zwingend mit der Zweiseitigkeit verbunden, und nicht alle Nachfolger sind Saussure in diesem Punkt gefolgt. Louis Hjelmslev zum Beispiel, der die verbreitete Terminologie von Ausdrucks- und Inhaltsseite eingeführt hat, enthält sich psychologischer Spekulationen.
Die Formulierungen des bilateralen Modells wechseln gerade in dieser Hinsicht. Manche kommen – jedenfalls stellenweise – ohne psychologisches Vokabular aus:
„(...) the link between sound and meaning that language provides“ (Wallace Chafe: Meaning and the Structure of Language. Chicago 1970:3)
„Sprache als System, das Ausdrücke und Inhalte einander zuordnet“ (Edda Weigand: Die Zuordnung von Ausdruck und Inhalt bei den grammatischen Kategorien des Deutschen. Tübingen 1978:1)
„It is generally assumed by linguists that the function of a grammar is to link meaning with sound.“ (Renate Bartsch/Theo Vennemann: Semantic structures: a study in the relation between semantics and syntax. Frankfurt 1972:3)
„(...) daß die Grammatik das System der Zuordnungen zwischen Lauten und Bedeutungen modelliert, daß die Grammatik (ebenso wie die Lexik) Form und Bedeutung, Ausdrucks- und Inhaltsebene miteinander verbindet.“ (Gerhard Helbig: Studien zur deutschen Syntax I. Leipzig 1983:9)
„Eine Sprache beschreiben heißt, eine Grammatik angeben, die in der Syntax die wohlgeformten Ausdrücke dieser Sprache definiert und in der Semantik diesen Ausdrücken bestimmte Entitäten, genannt Bedeutungen, zuordnet.“ (Dietmar Zaefferer in Grewendorf (Hg.): Sprechakttheorie und Semantik. Frankfurt 1979:387)
„Jedes Wort hat eine Formseite und eine Inhaltsseite (Bedeutung). (...) Die Grammatik legt dar, welchen Regularitäten der Bau der Formen und der Bau der Bedeutungen folgt.“ (Dudengrammatik 2005:19)
„Seit geraumer Zeit ist es allgemein gültiges Wissen, dass Sprachzeichen aus zwei Hauptkomponenten bestehen: aus einer Laut- und einer Bedeutungsseite.“ (Christine Römer: Morphologie der deutschen Sprache. Tübingen 2006:3)
„Durch ein Zeichen wird eine Form mit einer Bedeutung, oder anders gesagt: eine Bedeutung mit einer bestimmten Form in Beziehung gesetzt.“ (Ralf Pörings/Ulrich Schmitz [Hg.]: Sprache und Sprachwissenschaft. Eine kognitiv orientierte Einführung. 2. Aufl. Tübingen 2003:2)
„Die Sprache ist ein Zeichensystem, d. h. ein symbolisches System, in dem Formen und Bedeutungen sowohl auf lexikalischer Ebene als auch auf der Ebene grammatischer Konstruktionen konventionell gepaart sind.“ (Deutsche Gesellschaft für Kognitive Linguistik)
„Sprache ist eine Verbindung von Form und Inhalt.“ (Wolfgang Meid: Germanische Sprachwissenschaft III: Wortbildungslehre. Berlin 1967:9)
„Approaches to language in the Cognitive Linguistics tradition take linguistic units to be pairings between form and meaning (e.g. Langacker 1991).“ (http://www1.icsi.berkeley.edu/ ~nchang/research/pubs/MaiaChang01.pdf)
„Eine menschliche Sprache ist ein Zeichensystem, bei dem - etwas vereinfacht gesagt - Schall mit Bedeutung verknüpft wird.“ (Henning Wode: Psycholinguistik. Eine Einführung in die Lehr- und Lernbarkeit von Sprachen. München 1993:36)
Andere übernehmen die psychologische Deutung:
„Das Sprachsystem kann seine gesellschaftlich-kommunikative Funktion nur erfüllen, wenn es sich darstellt als System von Zuordnungen zwischen Bewußtseinsinhalten und materiellen Signalen.“ (Gerhard Helbig: Sprachwissenschaft – Konfrontation – Fremdsprachenunterricht. Leipzig 1981:83)
„Die Verwendung von Sprache in der Kommunikation erfordert sowohl auf der Seite des Sprechers als auch auf der Seite des Hörers die Zuordnung einer Menge von Ausdrucksstrukturen zu einer Menge von Inhalts- oder Bedeutungsstrukturen.“ (Thomas Kotschi: Probleme der Beschreibung lexikalischer Strukturen. Tübingen 1974:1)
„In the minimal case, a word is an arbitrary association of a chunk of phonology and a chunk of conceptual structure, stored in speakers’ long-term memory (the lexicon).” (Steven Pinker/Ray Jackendoff: „The Faculty of Language: What’s Special about it?“ Cognition 95, 2005:201-36.)
„Die Grundstruktur des lexikalischen Wissens besteht (...) in einer Zuordnung zwischen zwei Mengen: der Menge von Wortformen (dem physikalischen Aspekt der Wörter) und der Menge von Wortbedeutungen.“ (George A. Miller: Wörter. Heidelberg 1993:33)
„Ein sprachlicher Ausdruck ist eine Verbindung eines Ausdrucksträgers und einer Bedeutung, die einander konventionell zugeordnet sind.“ (...) „Grundsätzlich ist eine solche Bedeutung (...) immer eine abstrakte Entität, die irgendwo im Gehirn gespeichert ist, die sich auf Dinge der Außenwelt beziehen kann, aber nicht muss, und die sich mit bestimmten Methoden beschreiben lässt.“ (Angelika Becker/Wolfgang Klein: Recht verstehen. Berlin 2008:8)
In einigen Theorien wird das Modell als Beschreibung des Erzeugens und Verstehens von Sprache durch den Sprecher oder Hörer gedeutet:
„Language enables a speaker to transform configurations of ideas into configurations of sounds.“ (Wallace Chafe: Meaning and the Structure of Language. Chicago 1970:3)
„The act of speaking consists of a chain of events which links physiological and logical operations.“ (Frieda Goldman-Eisler: Psycholinguistics. Experiments in spontaneous speech. New York 1968:6)
„A speaker’s ability to use a language requires a systematic mapping between an unlimited number of thoughts or meanings and an unlimited number of sound sequences (or, in the case of signed languages, gesture sequences).“ (Ray Jackendoff: What is the human language faculty? Two views)
„Was tut ein sprachfähiger mensch, der seine sprache benutzt? Er setzt bedeutungen zum zweck der kommunikation - mit anderen oder mit sich selbst - in laut oder schrift um.“ (Theo Vennemann: „Warum gibt es syntax?“. ZGL 1/1973:257-283; S. 257)
Die Beziehung zwischen Ausdruck und Inhalt wird teilweise als Übersetzung oder als Transformation gedeutet:
„A language is a system for translating meanings into signals.“ (James R. Hurford: The Origins of Meaning. Oxford 2007:3)
„(...) that sound and meaning are related transformationally“ (George A. Miller/Philip N. Johnson-Laird: Language and perception. Cambridge 1976:186)
Solche Unterschiede zwischen den verschiedenen Darstellungen sind aber wohl nicht besonders ernst zu nehmen, da es sich meistens nur um undurchdachte Variationen des Wortlauts handelt.
1. Begriffliche Schwierigkeiten
Das Verständnis scheitert oft schon an der Unklarheit der Ausdrucksweise. In einem vielbenutzten Fachlexikon heißt es:
„Jedes Zeichen besteht aus der Zuordnung von zwei Aspekten, dem materiellen (lautlich oder graphisch realisierten) Zeichen-Körper (= Bezeichnendes) sowie einem begrifflichen Konzept (= Bezeichnetes)“ (Bußmann)
Diese „Zuordnung“ ist aber nicht wahrnehmbar. Und wieso sind Körper und Konzepte „Aspekte“? Konzept heißt Begriff, ein begriffliches Konzept wäre also ein begrifflicher Begriff.
Damit Form und Bedeutung einander zugeordnet werden können, müßten sie zunächst unabhängig voneinander existieren. „Form“ und „Bedeutung“ sind aber relationale Begriffe, Form ist immer Form von etwas, Bedeutung immer Bedeutung von etwas. Dieses Problem wird kaum erkannt, erst recht nicht gelöst.
Die Rede von der „Inhaltsseite“ ist außerdem eine Kontamination zweier Metaphern: Das Zeichen könnte ein Gegenstand mit Vorder- und Rückseite sein oder aber aus Verpackung und Inhalt bestehen. Das macht das Verständnis nicht einfacher.
Nicht nachvollziehbar sind Aussagen wie die von Goldman-Eisler: „The act of speaking consists of a chain of events which links physiological and logical operations.“ Es gibt ja nicht physiologische und logische Operationen, die man miteinander verbinden könnte, sondern das Logische ist eine bestimmte Funktion des Physiologischen.
2. Immanentismus
Wenn die Beziehung zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem innerhalb des Zeichens verbleibt, wie kann man dann mit einem solchen selbstgenügsamen „Zeichen“ noch etwas anderes bezeichnen, das außerhalb seiner selbst liegt? Für dieses herkömmlicherweise einfach so genannte Bezeichnen müßte ein anderer Begriff erfunden werden. Das wird meist gar nicht erörtert.
3. Psychologismus
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts herrschte ein Psychologismus, der in naiver Weise von „Vorstellungen“, deren „assoziativer“ Verknüpfung usw. redete und alsbald den Behaviorismus hervorriefe, dem solche Scheinerklärungen nicht genügten. Voll ausgebildet sehen wir den Psychologismus etwa bei Hermann Paul; als Beispiel sei seine Definition des Satzes erwähnt: „Der Satz ist der sprachliche Ausdruck, das Symbol dafür, dass sich die Verbindung mehrerer Vorstellungen oder Vorstellungsgruppen in der Seele des Sprechenden vollzogen hat, und das Mittel dazu, die nämliche Verbindung der nämlichen Vorstellungen in der Seele des Hörenden zu erzeugen.“ (Prinzipien § 85)
Saussures Psychologisierung des Zeichens geht über den eher harmlosen zeitgenössischen Psychologismus hinaus, gerade weil Saussure die unerhörte Behauptung aufstellt, seine Vorgänger und Zeitgenossen hätten den eigentlichen Gegenstand der Sprachwissenschaft, die Sprache und die Natur des Zeichens, bisher nicht erkannt. Ogden und Richards wenden ein:
Unfortunately this theory of signs, by neglecting entirely the things for which signs stand, was from the beginning cut off from any contact with scientific methods of verification. (Charles K. Ogden/Ivor A. Richards: The meaning of meaning. London 1953:6)
Das Psychische, Mentale, Seelische, der Geist – das sind allzu vertraute bildungssprachliche Bezeichnungen für ein Niemandsland, das sich einer wissenschaftlichen Objektivierung entzieht. Aus einer vielgelesenen Einführung in die Semantik lernen die Studenten:
„Die Sprache ist (...) rein psychischer Natur: sie setzt sich aus Eindrücken von Lauten, Wörtern und grammatischen Merkmalen zusammen, die wir im Gedächtnis gespeichert dauernd zur Verfügung haben.“ (Stephen Ullmann: Einführung in die Semantik, Frankfurt 1982:27)
Woher Sprachwissenschaftler das wissen, wäre auch noch zu fragen.
Der nächstliegende Einwand gegen einen Zeichenbegriff, der die beiden Seiten oder Komponenten des Zeichens vollständig ins Psychische verlegt, ist: Wie kann ein solches – in einem radikalen Sinn „privates“ - Gebilde noch zur Kommunikation zwischen Menschen benutzt werden? Hier wiederholt sich das Bedenken gegen den Immanentismus. Rein sprachlich fängt Saussure diesen Einwand auf, indem er das sprachliche Zeichen als gesellschaftlich (fait social) bezeichnet, aber wie das mit dem innerpsychischen Charakter zusammenpaßt, bleibt unklar – darauf weisen u. a. Gauger und Fehr hin.
Sieht man einfach hin, wie die Theoretiker verfahren, so erkennt man in vielen Fällen, daß die „Bedeutungen“ in Wirklichkeit wiederum Ausdrücke sind, Synonyme, Paraphrasen oder Definitionen der Wortformen, deren Bedeutungen sie sein sollen. Vorbild ist das Wörterbuch. Das wird gelegentlich auch offen ausgesprochen:
„Offensichtlich enthält das mentale Lexikon einen Speicher für Wortbedeutungen und einen Speicher für Wortformen.“ (Jürgen Dittmann/Claudia Schmidt (Hg.): Über Wörter. Freiburg 2002:286)
„Dass das Lexikon der Wortbedeutungen eine alphabetische Struktur haben könnte, erscheint schon heuristisch unplausibel.“ (Ebd. 290) Dann führt der Verfasser an, daß bedeutungsähnliche Wörter nicht alphabetisch aufeinander folgen müssen. Aber Bedeutungen haben keinen Anfangsbuchstaben, können also schon aus begrifflichen Gründen nicht alphabetisch geordnet werden. Das ist nicht heuristisch unplausibel, sondern begrifflich unmöglich. In Wirklichkeit ist wohl an Synonyme gedacht, also Ausrücke einer zweiten Sprache (Metasprache?).
Hierher gehört es, daß die naive Alltagspsychologie das sogenannte „Denken“, dessen Ausdruck die Sprache sein soll, seinerseits als ein Sprechen konzipiert. Das zeigt sich darin, daß das Denken in wörtlicher (oder auch in indirekter Rede) zitiert werden kann, also offenbar einen Wortlaut hat:
„Unter direkter Rede verstehe ich die Erscheinung, daß die Rede, der Gedanke eines Menschen genau in der Form und in dem Sinn wiedergegeben wird, wie er sie selbst ausspricht oder denkt.“ (Otto Behaghel: Deutsche Syntax III. Heidelberg 1928:695)
„Von Redewiedergabe spricht man dann, wenn in einem Sprachspiel ein anderes Sprachspiel als Referenz eingeblendet ist. 'Rede' wird dabei im weitesten Sinne des Wortes verstanden und umfaßt nicht nur lautsprachliche Äußerungen, sondern auch Bewußtseinsinhalte aller Art.“ (Harald Weinrich: Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim 1993: 895)
Daher:
„Wenn nur schon alles vorüber wäre“, dachte Petra. (Beispiel für Anführungszeichen nach Duden 1991, R. 10: „Anführungszeichen stehen vor und hinter einer wörtlich wiedergegebenen Äußerung (direkten Rede). (...) Dies gilt auch für wörtlich wiedergegebene Gedanken.“ [!] Vgl. Neuregelung der deutschen Rechtschreibung § 89: „Das war also Paris!“, dachte Frank.)
Nur diese Auffassung des Denkens als innere Rede erlaubt es, von „Übersetzung“ zu sprechen:
„Wenden wir uns nun dem Vorgang der Übersetzung gedanklicher in sprachliche Inhalte zu.“ (Hans-Georg Bosshardt: „Morpho-syntaktische Planungs- und Kodierprozesse“, in: Theo Herrmann/Joachim Grabowski, Hg.: Sprachproduktion. Göttingen 2003:449-482, hier 458)
Eine vielbenutzte Einführung in die Linguistik versteigt sich gar zu folgender Behauptung:
„Da auf die menschliche Sprechtätigkeit und Sprechfähigkeit zutrifft, daß sie in ihrem Ablauf nicht beobachtbar sind ...“ (Heidrun Pelz: Linguistik. Eine Einführung. Hamburg 1996:43)
Hier ist alles, sogar die „Sprechtätigkeit“, ins Psychische verlegt, in letzter Konsequenz der Saussureschen Überlieferung.
4. Sprachproduktionsmodell
Aus einigen Zitaten geht hervor, daß das Zeichenmodell auch als Modell der Aktualgenese des Sprechens gedeutet wird: Die „Zuordnung“ von Form und Inhalt soll etwas sein, was der Sprecher bzw. sein Gehirn oder Geist im Augenblick des Sprechens tatsächlich vornimmt. Er sucht aus zwei Speichern etwas zusammen und verbindet es miteinander. Verifizierbar ist ein solches Konstrukt nicht; man weiß gar nicht, wonach man suchen sollte. Konstrukte erweisen sich als mehr oder weniger nützlich; die nützlichen erklären etwas, aber was ist mit der Annahme einer Zuordnung von Form und Inhalt erklärt, was nicht ohne eine solche Fiktion einfacher erklärt werden könnte?
Eine gewisse Plausibilität gewinnt das Modell wohl durch die alltägliche Erfahrung, daß einem etwas „auf der Zunge liegt“: Man weiß, was man sagen will. Was in solchen Fällen eigentlich vorgeht, ist nicht besonders klar. Aus naturalistischer Sicht ist ein Verhalten in Gang gekommen, wird aber gehemmt, weil die steuernden Faktoren nicht ausreichen, um es zu Ende zu führen.
5. Sprachverstehensmodell
Beim Verstehen soll der Produktionsvorgang umgekehrt ablaufen:
„Jeder Hörer muß unbewußt eine komplexe syntaktische Analyse machen, um eine sprachliche Äußerung zu verstehen, d.h. er muß Lautketten zu Gruppen ordnen und diese mit semantischen Strukturen in Verbindung bringen.“ (Gaston van der Elst: Syntaktische Analyse. 5. Aufl. Erlangen 1994:9)
Sowohl Produktion wie Rezeption von Rede wird nach dem Muster des „kleinen Linguisten im Kopf“ erklärt. Tatsächlich sind viele dieser „kognitivistischen“ Ansichten einem Homunkulusmodell verpflichtet und unterliegen der entsprechenden Kritik an solchen Modellen. Homunkulusmodelle erklären Verhalten als Handeln, kehren also die naturalistische Perspektive um.
Den Homunkulus-Fehlschluß erklärt Geert Keil als „die Praxis, Prädikate, die wörtlich nur auf ganze Personen anwendbar sind, auf Teile von Personen oder auf physische Prozesse innerhalb unseres Körpers anzuwenden. Vorgänge im menschlichen Gehirn werden mit psychologischen Verben beschrieben, was nicht nur nichts erklärt, sondern (...) eine Menge von Begriffsverwirrungen und Pseudoproblemen nach sich zieht.“ (Geert Keil: Kritik des Naturalismus. Berlin, New York 1993:166; dieselbe Kritik läßt sich aber schon bei Skinner lesen!)
6. Gedankensprache?
„... there must be stages in production, during which concepts are 'translated' into structured speech." (Virginia Valian: „Talk, talk, talk. A selective critical review of theories of speech production“. In: Roy O. Freedle (Hg.): Discourse production and comprehension. Norwood 1977:107-139; S. 108)
Wie man etwas, was selbst nicht sprachlich ist, „übersetzen“ könnte, bleibt unklar. Manche ziehen daraus die Konsequenz, auch das „Begriffliche“ oder die „kognitiven Zustände“, die der eigentlichen Versprachlichung vorausgehen, als sprachlich aufzufassen, nämlich als Formulierungen in einer mentalen oder Gedankensprache (Mentalesisch, Language of thought). Das Problem des infiniten Regresses wird kaum gesehen: Für die Gedankensprache stellt sich ja wiederum die Aufgabe, das Zusammenspiel von Form und Inhalt zu erklären usw.
„The approach advocated here is similar to that taken by Fodor, Bever and Garrett (1974) and Garrett (1975). They view speech production as a translation process, in which a message in a mental computational 'language' is translated into speech (...)“ (ebd. 137)
„Knowing a language then is knowing how to translate mentalese into strings of words and vice versa. People without language would still have mentalese, and babies and non-human animals presumably have simpler dialects. Indeed if babies did not have a mentalese, to translate to and from English, it is not clear how learning English could take place, or even what learning English would mean.“ (Steven Pinker: The language instinct. New York 1994:82)
Auch das „Transformieren“ ist ein Übersetzen:
„(The present book) will consider the speaker as a highly complex information processor who can, in some still rather mysterious way, transform intentions, thoughts, feelings into fluently articulated speech.“ (Willem Levelt: Speaking. Cambridge (Mass.)/London 1989:1)
Bekanntester Vertreter der „Language-of-thought“-Hypothese ist Jerry Fodor, andere sind van Dijk/Kintsch, Pinker, Beckermann. Dazu gibt es eine ausgedehnte Diskussion, die erstaunlicherweise auch heute noch geführt wird, obwohl nicht nur Behavioristen, sondern auch andere Autoren wie Charles Osgood, Daniel Dennett, Peter Hacker, Geoffrey Sampson, Larry Hauser, William H. Calvin, Gerald Edelman u. a. durchschlagende Kritik daran geübt haben. Es fällt schwer, die Theorie ernst zu nehmen. Sprachen sind ja durch und durch historisch gewachsene und überlieferte Verhaltensweisen – wie sollten sie denn ins Gehirn oder gar ins Genom gelangen? Wer spricht da mit wem? Auch Hacker betont, daß Sprachen, wie wir sie kennen, normgesteuerte soziale Verhaltensweisen sind. Er erklärt Fodors Thesen daher für unverständlich. (Peter Hacker: „Languages, Minds and Brains“. In: Colin Blakemore/ Susan Greenfield, Susan (Hg.): Mindwaves. Thoughts on Intelligence, Identity and Consciousness. Oxford 1987:485-505.)
Was wird aus dem bilateralen Zeichen? Die Gedankensprache wäre ja wiederum aus Zeichen aufgebaut, deren Inhaltsseite dieselbe Erklärungsbedürftigkeit aufwiese wie die der wahrnehmbaren Zeichen. Die Annahme einer Gedankensprache kann die Sprachproduktion nicht erklären, weil sie das Problem nur eine Stufe weiterschiebt: von der hörbaren Sprache zu einer unhörbaren, deren Entstehung daher noch unklarer ist als die der hörbaren. Aber auch dieses Problem des infiniten Regresses wird kaum gesehen.
| Kommentare zu »Das „bilaterale Zeichen“« |
| Kommentar schreiben | älteste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.04.2024 um 06.00 Uhr |
|
Nach der herkömmlichen Auffassung von "Selbstgespräch", "Denken" usw. müßte ich mich selbst am besten verstehen. Aber was soll das überhaupt heißen? Kann ich zweifeln, ob ich weiß, was ich meine, wenn ich mit mir selbst rede? Man fühlt sich, als ginge einem ein Mühlrad im Kopf herum, wenn man solche Fragen stellt.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 12.03.2024 um 16.53 Uhr |
|
Ich denke, man kann Zeichen als eine Art Brücke zwischen zwei unterschiedlichen Formen (Bedeutungen) verstehen. Wachstumsringe im Baumstamm sind direkte Merkmale (Anzeichen, Symptome) des Alters, nicht verschieden, brauchen keine Brücke. Die Graphik A hat mit dem Laut [a] nichts zu tun, deshalb wird die Brücke benötigt, also ein Zeichen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.03.2024 um 05.17 Uhr |
|
Sie haben recht, wenn Sie meinen lax formulierten letzten Satz korrigieren. Ich habe ja selbst hundertmal gesagt, daß wirkliche Zeichen objektiv existieren, weil sie sich unter dem "Druck" der empfangsseitigen Semantisierung entwickelt haben, z. B. die Tarnfärbung oder die Zeichen der Kopulationsbereitschaft. Das ist eine andere Frage als die nach der "Bekanntheit", und ich hätte es abtrennen sollen.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 10.03.2024 um 22.12 Uhr |
|
Der Unterschied, der in mir (meiner Geschichte) liegt, besteht in der Kenntnis oder Nichtkenntnis der Bedeutung eines Zeichens. Dieses subjektive Merkmal hat mit der objektiven Bedeutung selbst gar nichts zu tun, sofern es sich um ein Zeichen handelt, das innerhalb einer Gruppe von Individuen allgemein anerkannt ist. Daher bleibt die Frage, ob die per Definition oder Semantisierungsgeschichte entstandene, objektive Bedeutung zum Zeichen gehört und dessen zweite Seite genannt werden kann, bestehen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.03.2024 um 18.58 Uhr |
|
Das erinnert mich an die Anekdote, die hier erzählt wird: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1651#52118 Dann ist eben Bekanntheit eine Eigenschaft des bekannten Objekts statt des Kennenden. Aber das ist natürlich Unsinn und richtet nur Schaden an. Vgl. Kants Paradox, das man so umschreiben könnte: Es gibt zwei Arten von Geld, nämlich gehabtes und nichtgehabtes. In Wirklichkeit liegt der Unterschied nicht im Geld, sondern in den Leuten, die es haben oder nicht haben: Reiche und Arme. So auch der Unterschied zwischen bekannten und unbekannten Tatsachen: in Wirklichkeit ein Unterschied zwischen Wissenden und Unwissenden. Zurück zu den Zeichen: Bei einigen Gegenständen habe ich gelernt, sie als Zeichen zu benutzen, bei anderen nicht. Der Unterschied liegt in mir (in meiner Geschichte), nicht in den Gegenständen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 10.03.2024 um 18.16 Uhr |
|
Das leuchtet mir jetzt endlich ein, nur, wenn man allgemein über Zeichen spricht, kann man ja die eine Art von Zeichen nicht einfach übergehen. Das finde ich schon etwas mißverständlich. Ich müßte jetzt noch einmal nachlesen, ob Sie das wirklich überall erwähnen. Die Entstehung bzw. das "Wunder" des Bedeutens wird mit der Semantisierungs- bzw. Konditionierungsgeschichte gut erklärt. Aber ist das den Vertretern eines bilateralen Zeichenmodells nicht an sich völlig egal, bestreiten sie eigentlich irgendwie, wie die Bedeutung als zweite Seite eines Zeichens irgendwann einmal zustande gekommen ist? Maßgeblich für sie ist doch nur, daß sie überhaupt vorhanden ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.03.2024 um 04.37 Uhr |
|
Ein altes Mißverständnis, auch zwischen uns. Die ausdrückliche definitorische Einführung eines Zeichens habe ich immer von der Zeichenentstehung ausgenommen. Sie wird durch primär semantisierte Zeichen ermöglicht. Nur um die geht es mir (und den Biologen, die den Begriff der Semantisierung eingeführt haben – ich habe Wolfgang Wickler zitiert, von dem "empfangsseitige Semantisierung" stammt). Was man dann mit der bereits etablierten Sprache machen kann, steht auf einem anderen Blatt. Also noch einmal: Die primäre Zeichenentstehung kann nicht auf Vereinbarung beruhen. Ethologie (Wickler usw.) und Verhaltensanalyse (Skinner) erklären, wie Bedeutung überhaupt erst in die Welt kommt, nämlich in der Stammesgeschichte und in der Konditionierungsgeschichte, strukturell gleich, aber in verschiedenen Dimensionen und verschiedenem "Stoff". Das "Wunder des Bedeutens" läßt sich erklären. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 09.03.2024 um 22.12 Uhr |
|
Semantisierung, ja, aber Geschichte? Viele Zeichen haben eine, aber manche Zeichen (besonders fachsprachlich) werden einfach in einem Augenblick definiert. Deshalb halte ich die Geschichte nicht für wesentlich bzw. allgemeingültig. Semantisierung heißt, so verstehe ich es, dem Zeichen eine Bedeutung zuzuordnen. Es muß aber eine neue Bedeutung sein, die das infragestehende Zeichen nicht sowieso schon direkt aussagt. Ich würde es auch Vereinbarung oder Deklaration nennen. Beispielsweise zeigen Baumringe unmittelbar das Alter an. Was müßte man da erst noch vereinbaren? Also kein Zeichen. Wasserstofflinien im Sonnenspektrum zeigen direkt Wasserstoff an, was gäbe es da zu deklarieren oder zu semantisieren? Auch kein Zeichen. Eisblumen beweisen, daß draußen Frost herrscht. Da muß nichts deklariert werden. Der aus der Lawine ragende Fuß ist kein Zeichen, weil die Folgerung, daß da ein Mensch verschüttet ist, keine deklarativ festgelegte neue Bedeutung ist, sondern direkt daraus hervorgeht. Der Geruch der Stinkmorchel läßt hingegen nicht unmittelbar auf verwesendes Fleisch schließen, sondern dies ist eine neue Bedeutung aufgrund der Deklaration durch Konditionierung, daß dieser Geruch Fleisch bedeutet. Es geht also um ein (wenn auch irreführendes) Zeichen. A ist ein Zeichen für den akustischen Laut [a], denn der Laut ist nicht direkt in der Form des A enthalten, sondern beruht auf der Vereinbarung, daß A für [a] steht. Vielleicht ist meine Herleitung/Erklärung etwas anders als Ihre, aber letztlich komme ich so auf die gleichen Ergebnisse. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.03.2024 um 03.41 Uhr |
|
Weil sie in einem vielbenutzten Lexikon der Sprachwissenschaft als Zeichen (Informationsträger) erwähnt sind (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#24337). Auch in meiner Auseinandersetzung mit Rudi Keller (mein Aufsatz "Wirkliche Zeichen", in der Festschrift Munske) geht es um die nicht bewältigte Abgrenzung zwischen Zeichen und Anzeichen. Ob belebt oder nicht – der Fuß, der aus der Lawine ragt (Kellers Beispiel), ist kein Zeichen. Im übrigen bin ich mit Ihrer Darstellung einverstanden. Sie fassen zusammen, was ich die ganze Zeit sage: es kommt auf die Semantisierung an, also auf die Geschichte. "Zeichen" ist in diesem Sinn ein historischer Begriff. Skinner sagt mit anderen Worten dasselbe, und damit stehen wir Behavioristen allein auf weiter Flur. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto selbstverständlicher wird es.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 08.03.2024 um 23.32 Uhr |
|
zu #49661: Sie schreiben, Eisblumen sind nur Anzeichen, keine Zeichen, haben keine Semantisierungsgeschichte. Kann man nicht sowieso alle Beispiele aus der unbelebten Natur sofort von den Zeichen ausschließen? Es kann ja niemals in der unbelebten Welt eine Semantisierung geben, weder sender- noch empfängerseitig. Zeichen sind immer Teil einer Kommunikation zwischen Lebewesen, oder? Sie sind also immer (Teil) eine(r) Nachricht, richtig? Wozu also solche Beispiele wie Eisblumen überhaupt erwähnen? Ähnlich Spektrallinien u.a. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.03.2024 um 07.57 Uhr |
|
Auch der Geruch der Stinkmorchel ist ein Zeichen: Wie sieht das bilaterale Zeichenmodell hier aus? Die Fliegen müßten auch zwei Speicher haben: einen für Gerüche und einen für deren Bedeutung. Leider schweigen sich die Strukturalisten darüber aus.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.01.2024 um 05.36 Uhr |
|
„Schenken“ z. B. setzt, wie man sagt, eine Rechtsordnung voraus, in der es Eigentum gibt. Aber was heißt das eigentlich, wenn man die Abstrakta auflöst? Tiere haben kein Eigentum. Der Hund hält den Knochen fest, läßt ihn sich nicht nehmen. Das ist Gewalt, nicht Recht. Recht besteht in Ansprüchen und Pflichten, was es wahrscheinlich ohne Sprache nicht gibt. Auch diese Begriffe müssen in Verhalten aufgelöst werden. Das will ich an dieser Stelle nicht versuchen, aber man bedenke, daß all dies im Geist/Hirn/Kopf „repräsentiert“ sein soll. Ist damit irgend etwas gesagt? Wir müssen es eben lernen, in jahrelangem Umgang mit einander. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.01.2024 um 05.21 Uhr |
|
Ich begrüße die zweijährige Enkelin an der Haustür. Sie späht in den Hausflur und sagt Oma. Diese sprachliche Reaktion kann nicht durch die – nicht anwesende – Oma ausgelöst sein, aber das ist aus behavioristischer Sicht kein Problem: „Nehmen wir an, daß ein Kind daran gewöhnt ist, auf dem Frühstückstisch eine Orange zu sehen. Fehlt die Orange eines Morgens, sagt das Kind schnell Orange. (...) Wieso konnte die Reaktion erfolgen, obwohl gar keine Orange als Reiz gewirkt hat? (...) Die Reaktion wird durch den Frühstückstisch mit allen seinen vertrauten Eigenschaften und durch andere zur Tageszeit passende Reize ausgelöst. Zu diesen Reizen gehörten oftmals Orangen, und die Reaktion Orange ist in ihrer Anwesenheit verstärkt worden.“ (Verbal behavior S. 101) (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587) So wird es auch von den Erwachsenen intuitiv verstanden. Umgekehrt ist die Anwesenheit der Oma kein Grund für das Kind, ununterbrochen Oma zu sagen (Chomskys törichter Einwand gegen den mißverstandenen Behaviorismus). Das ist alles sehr einfach, fast primitiv, aber so muß man anfangen. Wittgenstein: „Ich kann ihn suchen, wenn er nicht da ist, aber ihn nicht hängen, wenn er nicht da ist. Man könnte sagen wollen: ‚Da muß er doch auch dabei sein, wenn ich ihn suche‘. – Dann muß er auch dabei sein, wenn ich ihn nicht finde, und auch, wenn es ihn gar nicht gibt.“ (Philosophische Untersuchungen § 462) – Eine Art Platon-Parodie oder eben Phänomenologie (Meinong). |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 30.01.2024 um 20.48 Uhr |
|
Sie meinen es natürlich ironisch, aber ich glaube, auch Kognitivisten behaupten kaum, daß das Wissen im Gehirn digital in Bits und Bytes gespeichert ist. Oder gibt es tatsächlich solche Theorien?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.01.2024 um 16.57 Uhr |
|
Das Gehirn steuert das Verhalten, darunter Verhaltensabschnitte, die in unserer Gesellschaft als „Schenkung“, „Eigentor“, „Relativsatz“ usw. klassifiziert werden, und auch diese sprachlichen Etiketten sind solche Verhaltensabschnitte, also das Aussprechen von Schenkung, Eigentor, Relativsatz unter Berücksichtigung ihrer komplexen Verwendungsbedingungen. (Kinder brauchen Jahre, um die verschiedenen Begriffe des Eigentumswechsels auseinanderzuhalten – um nur dieses Beispiel zu erwähnen.) Daß all dies irgendwie im Gehirn „repräsentiert“ sein könnte, ist leeres Gerede. Der undefinierbare Begriff „Repräsentation“ verdeckt nur den unzulänglichen Stand der Wissenschaft. Wir wissen, wie Lernen als Verhaltensänderung funkioniert, aber wir wissen nicht, wie es physiologisch funktioniert. Man kann bezweifeln, daß bestimmte Regionen im Gehirn auf Sprache spezialisiert sind. Dem Gehirn ist es egal, ob seine Bits und Bytes Musik, Texte oder Bilder erzeugen, wenn eine entsprechende Peripherie zugeschaltet wird. Die alltagspsychologischen Begriffe Geist, Vorstellung usw. stammen aus Zeiten, als man von Nerven und Gehirn nichts wußte und auch nicht zu wissen brauchte, um die Verhaltensabstimmung in der Sprachgemeinschaft zu organisieren. Ihre Funktion ist eine ganz andere als die biologischer oder anatomischer Begriffe. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.01.2024 um 18.16 Uhr |
|
Saussure versteht die „assoziativen“ Beziehungen tatsächlich im Sinne der Assoziationspsychologie und nicht als „Paradigmen“ im Sinne von Distributionsklassen, d. h. also die Gesamtheit aller Elemente, die im gleichen „Slot“ der Redekette stehen könnten (und daher zur gleichen, eben dadurch definierten Kategorie gehören). Er hat den ganzen Hof von Wortbildungen und Wortbildungsmodellen, Reimwörtern, Alliterationen usw. im Auge. Zu den Assoziationen, die sich bei einem beliebigen Element einstellen und in den bekannten Experimenten erhoben worden sind, gehören natürlich auch – worauf Saussure anscheinend nicht besonders eingeht – die möglichen Vorgänger und Nachfolger in der Redekette, zu Hund also nicht nur Katze oder Haustier, sondern auch bellen und wedeln. Das Zwei-Achsen-Modell ist also keine angemessene Darstellung, sondern verschiebt die Theorie auf ein ganz anderes Gebiet.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.01.2024 um 06.23 Uhr |
|
Hinter Heldensagen stehen oft wirkliche historische Ereignisse und Gestalten. Man könnte also fragen, inwiefern der Dietrich des nach ihm benannten Sagenkreises und der Gotenkönig Theoderich dieselbe Person sind. (So hat es Saussure in seinen von Johannes Fehr veröffentlichten Notizen zeichentheoretisch problematisiert.) „Bereits im Mittelalter wurde Dietrich mit Theoderich dem Großen in Verbindung gebracht. Trotz vergleichsweise weniger Gemeinsamkeiten wurde damals wie heute mehrheitlich angenommen, dass Dietrich von Bern direkt auf jenen Ostgotenkönig zurückgeht.“ (Wikipedia Dietrich von Bern) Historische und fiktionale Erzählungen sind für eine Verhaltensanalyse kein Problem, weil sie nicht mit Begriffen wie Referenz, Extension usw. belastet ist. Daß Sagengestalten nicht existiert haben, sondern nur als intraverbale Fiktionen auftreten, ist eher der Normalfall; da sie das Sprachverhalten nicht steuern, muß man nicht nach ihrer Existenzweise fragen. Kurz gesagt: Die Rede über Dietrich wird durch andere Reden über Dietrich gesteuert. Caesar hat existiert, wie wir wissen, weil wir außer der intraverbalen Kette der Überlieferung (des Weitersagens und Abschreibens) auch noch reale Dokumente haben, die im großen und ganzen unser chronologisches Gerüst stützen und es letzten Endes in unserer eigenen Biographie verankern. Caesar hat eine Adresse in Raum und Zeit - das verstehen wir unter "Existenz". Bei Rotkäppchen fehlen solche Quellen, und beim „Dietrich“ der Sage sind sie unsicher. Man kann entweder sagen: Dieser Dietrich existierte, aber viele Berichte über ihn sind falsch. Oder: Er existierte nicht, und die Geschichten, die von ihm erzählt werden, ähneln nur in gewissem Maße den Geschichten, die von Theoderich überliefert sind, der wirklich existiert hat. Logiker haben diskutiert, was die Extension von Namen ist, wenn deren Referent nicht existiert. Bedeuten sie dann alle dasselbe? Das Problem ist nicht nur von theoretischem Interesse, man denke an den Streit der Religionen: Beziehen sich die Götternamen verschiedener Religionen bzw. verschiedener Menschen auf denselben Gott? Und gilt das auch für „Allah“? Usw. – die politische Brisanz leuchtet ein. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.01.2024 um 05.48 Uhr |
|
Saussure wirkte lebenslang verzagt, so daß er nach seinem jugendlichen Geniestreich nie wieder etwas Zusammenhängendes veröffentlichte. Zugleich behauptete er mit größtem Selbstbewußtsein, sämtliche Fachkollegen hätten keinen blassen Schimmer, worum es in der Sprachwissenschaft überhaupt gehe. Das kann man nur sagen, wenn man selbst mehr als einen Schimmer hat. Den glaubte er zu haben, aber es gelang ihm nie, ihn zu formulieren. Er selbst schob das in Briefen auf einen Mangel an Zeit und Konzentration, aber es scheint eher, daß er an der Undurchführbarkeit seines Programms einer allgemeinen Semiologie scheiterte. So blieb es bei ahnungsvollen Andeutungen, die dann von den Schülern notdürftig in eine systematische Lehre gezwungen wurden, von der der Meister sich wohl mit Grausen abgewandt hätte, die aber weltweit einer der größten Erfolge werden sollte. Die angeblich schimmerlosen Zeitgenossen arbeiteten unterdessen an den sprachlichen und sprachgeschichtlichen Einzelheiten, was er auch viel lieber getan hätte (brieflich bestätigt), wozu er aber wegen seiner fixen Idee nie kam. Das ist tragisch genug, auch ohne den biographischen Hintergrund.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.01.2024 um 05.44 Uhr |
|
Die Unterscheidung des (uninteressanten) wahrnehmbaren Lautes (dhvani) vom darin unzulänglich manifestierten systematischen oder idealen Phonem wird bei Bhartrhari breit ausgearbeitet. Saussure muß das gekannt haben. Natürlich kommt auch kein Sanskritist an Panini und seinen Kommentatoren vorbei. Die großen Panini-Kenner haben auch die ganze Schule bis zu Bhartrhari und darüber hinaus kommentiert, z. B. Bruno Liebich, nur wenige Jahre jünger als Saussure. Damals war der Unterschied zwischen Phonetik und Phonologie (Phonematik) im Westen noch nicht systematisch durchgeführt, während er in der indischen Sprachwissenschaft und -philosophie ein traditionelles Hauptthema war. Die heutigen Strukturalisten und Saussure-Verehrer erwähnen pflichtschuldig die Jugendschrift „Mémoire...“, aber sonst lassen sie den Sanskritprofessor beiseite. Auch bei Fehr kommt der Sanskritist praktisch nicht vor. Zitiert wird der Entwurf von Saussures geplantem Nachruf auf Whitney. George Cardona, der beste Panini-Kenner, sieht im Mémoire keinen Einfluß Paninis. Aber indirekt geht die Theorie des Ablauts doch auf die indischen Grammatiker zurück. Am ehesten findet man die Beziehungen zwischen Saussure und Bhartrhari bei indischen Autoren erwähnt, aber da mischt sich oft der Poststrukturalismus (Derrida, Barthes) ein und noch anderes, was man wissenschaftlich nicht ernst nehmen kann. Ich kenne aber nur einen kleinen Teil der Literatur und gebe hier nur vorläufige Eindrücke wieder. Hat Saussure in seinen Vorlesungen nie etwas Indisches erwähnt? Oder haben die Bearbeiter es weggelassen? Er nannte ja anscheinend überhaupt nur wenige Namen und Anreger, woraus man sogar geschlossen hat, er habe nur wenig gelesen und gekannt oder einen unberechtigten Originalitätsanspruch erhoben. Fehr weist das zurück. Fehr führt Stellen an, aus denen die seltsame Ansicht hervorgeht, daß das System der Sprache vorhergeht und gewissermaßen zusätzlich in die „Zirkulation“, also den Gebrauch durch die Gesellschaft hineingeworfen wird, wodurch es dem unvorhersehbaren Wandel unterliegt. Auch Esperanto würde nicht widerstehen, und man könnte nach einiger Zeit die Idee des Erfinders nicht mehr auffinden (Saussure Grundfragen 89f.). Aber eine Plansprache vom Reißbrett kann nicht das Muster einer natürlichen Sprache sein, so wie auch das Schachspiel und andere künstliche Systeme ungeeignet sind. Sie bilden freilich das aprioristische Verfahren des Systemkonstrukteurs nach. Aus verhaltensanalytischer Sicht gibt es keine Sprache hinter oder über dem Sprechen. Durch den Sprachgebrauch selbst konvergieren die Ausdrucksweisen auf eine Norm hin, aber aus den gleichen Gründen wird diese Regularisierung und zunehmende Symmetrie auch ständig wieder aufgelöst. Man könnte sagen: die Routinebildung und das Ausdrucksbedürfnis stehen im Gegensatz zueinander und lassen die Sprache nie zur Ruhe kommen. Wenn die lautliche Substanz aus systematischer Sicht gleichgültig ist, kann man die Phoneme durch Zahlen oder Farben usw. ersetzen und immer noch einige Eigenschaften des „Systems“ daran nachweisen. Einige, aber nicht alle. Zum Beispiel könnte man den Sprachwandel nicht verstehen. Warum wird in vielen Sprachen zwischenvokalisches s zu r (Rhotazismus)? Dazu braucht man die Phonetik – Einsicht in die Artikulation. Saussure sieht den Wandel – wie jeder Sprachwissenschaftler – in der „Zirkulation“ begründet, d. h. im wirklichen Verkehr der Menschen miteinander, aber er kann seine Idee vom autonomen, „geschlossenen“ System nicht damit vereinbaren (ganz abgesehen von der psychologischen Deutung des Systems, das zugleich eine gesellschaftliche Konvention sein soll, wodurch die Soziologie ein Teil der Psychologie oder umgekehrt wird, s. Fehr zu dieser Verwirrung). Wenn man die Sprache von der Idee des Systems her aufzäumt, scheint es eine bemerkenswerte Einsicht zu sein, daß das System (also die Sprache) nur existiert, solange es „zirkuliert“, die Sprache also von wirklichen Menschen gesprochen wird. Das ist natürlich extrem banal – wenn man umgekehrt das Sprachverhalten als die einzige Realität, das Sprachsystem aber als eine theoretische Abstraktion ansieht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.01.2024 um 06.46 Uhr |
|
In jeder Sprache lassen sich gewisse Ordnungen (Paradigmen) beobachten. Darauf ist in Griechenland die Rhetorik, in Indien die Veda-Gelehrsamkeit gestoßen. Lehrer haben Mustersätze („Der Lehrer schlägt den Schüler“) durch alle Tempora und Modi durchkonjugieren lassen. Dichter tun seit je etwas ähnliches mit ihren Polyptota usw. Im Wortschatz beobachten und beachten sie Synonyme, Antonyme usw. Nicht überliefert, aber zweifellos überall vorhanden sind Unterscheidungen wie „das sagt man, das sagt man nicht“. Frauen sprechen anders als Männer, Höhere anders als Niedrige. Überall geht es um vorgefundene Ordnungen. Aber der Systemgedanke hat eine anspruchsvollere Variante. Dazu gehört die These von der Negativität des Zeichens und vom durchgehenden Zusammenhang: Kein Element soll sich verändern dürfen, ohne daß alle anderen sich mitverändern. Vorbild sind etwa Schachregeln oder Schulnoten, Straßenverkehrszeichen usw. Diese Eigenschaften sind nicht aus der Beobachtung gewonnen, sondern postuliert und beweispflichtig. Stark empirisch arbeitende Sprachwissenschaftler wie Franz Dornseiff, Mario Wandruszka nennen die These von der Negativität „Unsinn“ und zeigen auch an zahllosen Beispielen, daß Sprachen eine Menge von erratischen Einzelheiten umfassen, die kommen und gehen, ohne daß sich sonst etwas ändert. Sprecher wollen lokale Kommunikationsprobleme lösen, und auf dem Rücken dieser Arbeit systematisieren sie gewisse Teile der sprachlichen Technik, zerstören die Ordnung aber auch immer wieder. Der Eifer geht mit der Trägheit Hand in Hand. So kommt es zu ständigem Sprachwandel. Hermann Paul und andere zeigen es an einzelnen Beispielen und entmystifizieren so den „Organismus der Sprache“. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.01.2024 um 06.00 Uhr |
|
Johannes Fehr zeigt an der Vorlesungsnachschrift und am Nachlaß, wie Saussure mit den Begriffen langue und langage gerungen hat, teils in Auseinandersetzung mit dem französischen Sprachgebrauch, ohne zu einer endgültigen Lösung zu kommen. (Johannes Fehr: Ferdinand de Saussure – Linguistik und Semiologie. Frankfurt 1997) Das kann und muß hier nicht nachgezeichnet werden und ist auch für die Theorie nicht interessant. Max Müller hatte bereits in schlichten Worten ausgesprochen, worum es der Sprachwissenschaft letzten Endes geht: „We do not want to know languages, we want to know language.“ (Lectures on the science of language. New York 1862:22, natürlich kannte der Sanskritist Saussure den führenden Sanskritisten Müller.) Überlegungen, ob „die Sprache“ (langage, la langue) ein zweiter Gegenstand neben „den Sprachen“ (les langues) oder nur eine theoretische Verallgemeinerung sei, wiederholen den Streit aus 2.500 Jahren Philosophiegeschichte. „Auf Becker geht die romantische Übertreibung zurück, daß jede Sprache ein Organismus sei. De Saussure ging darin noch weiter und behauptete, sie sei sogar ein System.“ (Franz Dornseiff: Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 5. Aufl. Berlin 1959 [1. Aufl. 1934]:36) Auch Mario Wandruszka hat diese Übertreibung immer wieder kritisiert. Der Systemgedanke stand für Saussure sehr früh fest, aber er ist nicht aus der Untersuchung der Sprachen gewonnen, sondern eine von außen herangetragene Idee. Dessen war sich Saussure auch bewußt. Man kann es für eine fruchtbare heuristische Hypothese halten, überall nach den systematischen Zügen zu suchen. Die Gefahr der „Übertreibung“ liegt allerdings nahe, und das Postulat kann den Forscher auch blind machen für evidente Beschränkungen. Georges Dumézil ist für seine Analyse der indogermanischen Gesellschaftsordnung berühmt (L’idéologie tripartie des Indo-Européens. Paris 1958). Man hat darauf hingewiesen, daß die Germanen keinen Priesterstand („Lehrstand“) hatten und daß die Sklaverei nicht vorkommt. Auch gibt es wohl in jeder Gesellschaft Außenseiter, die nicht in die Ordnung der Stände, Kasten, Klassen oder Schichten passen. Man muß viel weglassen, um das System herauszuarbeiten. Das zeigt z. B. die Mythenanalyse. Verschlungene Wege voller Willkür führen zu einem Ergebnis von eindrucksvoller, aber trügerischer Klarheit. Wie viel die Schüler und Bearbeiter Saussures als „unwesentlich“ weggelassen haben, um das reine Ideal des „Systems“ herauszuarbeiten, zeigt Fehr sehr nachdrücklich. Der Meister ist daran gewissermaßen zerbrochen, aber sein entstelltes Erbe florierte als „Strukturalismus“, eine weltumspannende Ideologie wie wenige. Saussure hat natürlich auch gesehen, daß jede Sprache dialektal gegliedert ist und ausfranst. Keine Rede von der theoretisch postulierten „Geschlossenheit“. Er gestand brieflich, daß er sich lieber mit Einzelsprachen und ihrer Geschichte beschäftigen würde, aber wegen der gedanklichen Schwierigkeiten mit dem Sprachbegriff nicht dazu kommt. Er scheint einerseits die ganze herrschende Lehre für falsch gehaltenzu haben, ohne andererseits seine eigenen Begriffe je klären zu können. Gerade das produktive Mißverständnis hat Geschichte gemacht, sonst wäre Saussure vergessen. Nur Indogermanisten würden sich an den Begründer der Laryngaltheorie erinnern. „He made remarkable advances in reconstructing Proto-Indo-European, but only a few specialists care about that today.“ (Geoffrey Sampson) In einem System, wie es dem Strukturalismus vorschwebt, hängt alles mit allem zusammen, und kein Teil kann sich ändern, ohne daß alle anderen ihren Stellenwert ebenfalls ändern, denn der Stellenwert ist es, wovon alles abhängt. Vorbild sind überschaubare künstliche Ordnungen wie die Regeln des oft herangezogenen Schachspiels oder die Zensurenskala in den Schulen. Im Sechsersystem der deutschen Schulnoten hat eine Drei einen anderen Wert als in einem Fünfersystem. So kann man auch sagen, daß Farbwörter etwas anderes bedeuten je nachdem, ob fünf oder nur drei Grundfarben unterschieden werden. Der s-Laut kann in einigen Sprachen als s oder eher als sch realisiert werden, mit großer Variationsbreite, während diese beiden Aussprachen in anderen Systemen bedeutungsunterscheidend sind usw. Die Phonologie ist denn auch der Teil der Sprachwissenschaft, an dem der Systemgedanke am überzeugendsten durchgeführt worden ist. Je größer der Freiheitsraum, desto geringer die Systematizität. Sprache hat viele Funktionen, schon das spricht gegen den Systemcharakter. Im Wortschatz, der sich in vielen Dimensionen gliedern läßt, gibt es nur schwache Ansätze einer Systematisierung, wie sie von der distinktiven Synonymik aufgedeckt wird. Aber nur in Fachsprachen gibt es jeweils einen bestimmten Aspekt, unter dem eine systematische Terminologie möglich wird. Die Sprecher müssen darauf achten, daß ihre Verhaltensweisen voneinander unterscheidbar bleiben, gegen die universelle Tendenz zum Schleifen der Unterschiede. Das schafft, bestätigt und erneuert Oppositionen, die Keimzelle jeder Systematik, aber auch des Sprachwandels, der das System ständig zerstört, wie Saussure selbst beobachtet, ohne mit diesem Problem begrifflich fertig zu werden. Im „Cours“ bleibt es unterbelichtet, im Gegensatz zu seinen eigentlichen Interessen. Ein weiteres Beispiel: Sprachwissenschaftler haben verschiedene Grundordnungen für die Satzgliedstellung herausgearbeitet: Subjekt – Verb – Objekt usw., wobei schon die Kategorien selbst als universal angenommen werden, obwohl jeder Linguist weiß, wie problematisch das ist. Die deutsche Wort- und Satzgliedstellung wird als nicht konsistent angesehen, weil das Deutsche zwar im allgemeinen von links nach rechts serialisiert, aber z. B. Attribute sowohl links als auch rechts vom Bezugswort stehen können und die Stellung in Haupt- und Nebensatz ohnehin ein bekanntes Problem aufwirft. Als Übergangsstadium kann man den gegenwärtigen Zustand auch nicht gut ansehen, weil er keine Auflösungserscheinungen zeigt. Die Verbzweitstellung (nach einem beliebigen Satzglied und gerade nicht dem Subjekt) hat vielmehr ihrerseits einen festen Platz und eine ganz bestimmte Funktion im System. Daß in einer Kultur alles mit allem zusammenhängt, beflügelt assoziative Essays über alles mögliche. Poststrukturalisten sind darin sehr produktiv, aber die Grenze zur leeren, wenn auch brillanten Geistreichelei ist schnell überschritten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.01.2024 um 15.14 Uhr |
|
Wierzbickas „Natural Semantic Metalanguage“ unterscheidet sich von den eigentlichen Welthilfssprachen dadurch, daß sie nicht als Verkehrssprache zwischen den Völkern gedacht ist, sondern eben als Metasprache, was logisch nicht ganz korrekt ist, weil es sich um eine Übersetzungs- bzw. Paraphrasensprache handelt. Der aposteriorische Charakter wird durch das Attribut „natural“ berücksichtigt. Grammatische Mittel sind dadurch abgedeckt, daß es sich nach Wierzbicka auch bei Kasus usw. stets um Bedeutung handelt. In ihrem Alterswerk widmet sich Wierzbicka mehr und mehr einer missionarischen Arbeit zur Verbreitung nicht nur einer semantischen Universalsprache, sondern auch des christlichen Glaubens, den sie in dieser Sprache neu formuliert („What Christians Believe: The Story of God and People in Minimal English“). Das Inventar von etwas mehr als einem Dutzend Basisausdrücken („Semantic primitives“) wurde nach und nach auf ein Vielfaches erweitert, aber zwischen diesem Ansatz und den rund 400 Vokabeln des theologischen Werks findet ein Sprung statt, nämlich die Ablösung der Metasprache durch eine universale Verkehrssprache. Diese kann, obwohl zuerst auf englisch formuliert, nach Wierzbickas Ansicht leicht und verlustfrei in jede andere Sprache der Welt übersetzt werden (wie die usprüngliche NSM, auf die stets zurückgegriffen werden kann). Je mehr Vokabeln zur Verfügung stehen, desto knapper können die Paraphrasen ausfallen. (Zur Definition von Becher und Tasse war einst jeweils eine ganze engbedruckte Seite nötig.) Die Basisausdrücke werden ohne Geschichte definiert, während die gesellschaftlichen Verhältnisse auf einen universalen Kern reduziert sind. Ist das möglich? Vorausgesetzt ist, daß alle Menschen in einer ähnlichen Welt mit ähnlichen Problemlösungen beschäftigt sind. Die Familienkonstellation z. B. ist aus natürlichen Gründen im wesentlichen gleich. Das sieht auch Skinner so und führt die vermeintlichen Universalien darauf zurück. Im übrigen sind die Unterschiede aber sehr groß, weil Skinner das Sprachverhalten von außen betrachtet, Wierzbicka aber als Teilnehmerin von innen: Verhaltensanalyse vs. Paraphrasenmethode. Universalsprachenprojekte sind fast immer mit humanitären Idealen verbunden: Völkerverständigung durch eine Einheitssprache, gewissermaßen die Rücknahme der babylonischen Sprachverwirrung. Der Plan, Religion in eine allgemeine Humanität aufzulösen, muß gerade von jenen historischen Zufälligkeiten absehen, die den Hauptgrund für theologischen Streit und (wenn auch oft als Vorwand) für Religionskriege geliefert haben. Daß letzten Endes alle dasselbe wollen, ist sozusagen eine „indische“ Idee. https://nsm-approach.net/wp-content/uploads/2019/06/Launch-speech-What-Christians-believe-2019.pdf |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.01.2024 um 07.25 Uhr |
|
Aus Wikipedia über Saussure: „Langue hat eine soziale und eine individuelle Dimension: In ihrer sozialen Dimension (fait social) ist langue eine intersubjektiv geltende gesellschaftliche Institution, ein sozial erzeugtes und in den Köpfen der Sprecher aufgehobenes, konventionelles System sprachlicher Gewohnheiten. In ihrer individuellen Dimension ist sie mentales depôt bzw. magasin (etwa: Lager) einer subjektiv internalisierten Einzelsprache.“ Das ist Wortemacherei. Wie das Zeichen als unauflösliche Verbindung von Laut- und Gegenstandsvorstellung im Kopf zugleich eine soziale Tatsache (s. Haupteintrag) und Gewohnheit (!) sein kann, ist völlig unklar. Hier werden verschiedene wissenschaftliche Traditionen zusammengeführt oder -gezwungen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.01.2024 um 16.12 Uhr |
|
Ich würde mich – alltagssprachlich ausgedrückt – mit dem Zeichen Saussure gern auf Saussure beziehen, aber wenn die Lautvorstellung Saussure sich auf die Gegenstandsvorstellung "Saussure" bezieht (beides psychisch, eben als Vorstellungen), dann weiß ich nicht, was ich mit so einem psychischen Ding anfangen soll. Ich habe auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Für mich sind Zeichen Verhaltensabschnitte, die unter bestimmten Kontingenzen verstärkt worden sind und mit denen man einen Partner zu bestimmten anderen Verhaltensweisen bewegen kann. Nichts da mit Vorstellungen, "sich beziehen" und ähnlicher Metaphysik.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 14.01.2024 um 15.56 Uhr |
|
Wenn wir ständig in allen Einzelheiten nach dem ganz ursprünglich vom Erfinder Gedachten suchen, dann ist das ähnlich, als wenn wir uns unter einem Planeten weiterhin nur wie die alten Griechen einen Wandelstern und sonst nichts vorstellen. Auf diese Art kann man aber sicherlich weder das Saussursche Zeichenmodell noch das Planetensystem widerlegen. Die Bußmannsche bzw. auch Saussures Auffassung von der psychischen Natur hatte ich ja in http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#52239 auch schon kritisiert. Welches Äußere, "außerhalb seiner selbst" Liegende (Haupteintrag, Punkt 2) meinen Sie, das mit dem Zeichen noch bezeichnet wird? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.01.2024 um 14.52 Uhr |
|
Was die Ausdrücke in der Allgemeinsprache selbsterklärend bedeuten, ist leider nicht das, was sie bei Saussure bedeuten. Im übrigen verweise ich auf den Haupteintrag und die Diskussion, besonders zum Immanentismus (das Bezeichnete als Teil des Zeichens). |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 14.01.2024 um 12.53 Uhr |
|
»Niemand versteht die Begriffe „Signifikant“ und „Signifikat“ in der Definition Saussures, und er selbst verstand sie auch nicht.« Signifikant und Signifikat, Bezeichnendes und Bezeichnetes – bedarf es da überhaupt noch einer genauen Definition Saussures? Sind diese beiden Wörter nicht von sich aus schon ebenso selbsterklärend wie Hackmesser und Gehacktes? Inwiefern hat Saussure sie selbst nicht verstanden? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.01.2024 um 18.02 Uhr |
|
For Chomsky linguistics is essentially a branch of psychology, as it was for Saussure, and the study of language is intended to teach us about the nature of the mind. (Simon Clarke, vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#45990) Auch Karl Bühler kritisierte schon früh Saussures Psychologismus – und Bühler war Psychologe, während Saussure keiner war und seine Psychologie daher nur von der spekulativen, sprachverführten, scholastischen Art sein konnte, die auch Webster und andere kritisieren. Niemand versteht die Begriffe „Signifikant“ und „Signifikat“ in der Definition Saussures, und er selbst verstand sie auch nicht. Trotz dieser Unfertigkeit und der Unzufriedenheit des "Genfer Meisters" sind sie wie das ganze bilaterale Zeichenmodell im Strukturalismus und Poststrukturalismus kanonisiert worden und dürfen in keiner Abhandlung dieser Schule fehlen. In Pariser Intellektuellenkreisen ist es auch schick, von "leeren Signifikanten" zu sprechen. Das sind entweder Wörter ohne Bedeutung – nicht gerade ein Mysterium – oder, in meiner Diktion, Zeichenkandidaten, d. h. Gegenstände, von denen vermutet wird, daß sie Zeichen sind, die man aber noch nicht entschlüsselt hat. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.01.2024 um 08.08 Uhr |
|
Was der erwähnte Richard Webster über den ethnologischen Strukturalismus sagt, gilt haargenau auch für den linguistischen: For anthropology, as Lévi-Strauss conceives it, is not a study of human societies in all their historical, economic, religious and political dimensions. Still less is it a study of human behaviour or of the relationships which exist between parents and children, women and men, leaders and led. Anthropology is seen rather as consisting solely in the study of unconscious processes of logic which are both hypothetical and invisible. It is thus converted into a branch of speculative psychology. Wenn die Psychologie noch empirisch wäre! Aber sie ist spekulativ, rationalistisch, scholastisch. Alles zusammen nennt man heute "kognitiv"... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.01.2024 um 07.53 Uhr |
|
Ich muß auch noch einmal sagen, daß der Name Saussure hier der Kürze halber für eine durchschnittliche Interpretation des "Cours" steht, weil es eine abschließende und authentische Lehre nicht gibt. Besonders Johannes Fehr hat Saussures eigene Zweifel und auch Verzweiflung deutlich herausgearbeitet. Entgegen den Erwartungen hat man nach Saussures Tod kein unabgeschlossenes Werk in der Schublade gefunden, sondern fast gar nichts. Saussure hat ja auch seine Zeichentheorie nicht wirklich angewandt, ebenso wenig wie Hjelmslev seine Glossematik (und Chomsky seine generative Grammatik). Unsere "Einführungen in die Linguistik" beginnen gewöhnlich mit einem pflichtschuldigen Abriß Saussures und lassen es dann damit gut sein, weil es nicht weiterführt. Kurioserweise findet man bei Skinner, der in solchen Diskussionen nicht vorkommt, ein viel stärkeres Interesse an wirklichen Sprachen und eine Fülle von konkreten Beispielen, die man leicht und gern vermehren kann. Chomsky behauptet zwar, die Linguistik wieder zu einem Zweig der Psychologie gemacht zu haben, aber eigentlich hat das Skinner getan. Das würde jeder sofort sehen, wenn er sich überwinden könnte, das reichhaltige "Verbal behavior" zu lesen und mit den dürren Spekulationen der Generativisten zu vergleichen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.01.2024 um 07.10 Uhr |
|
Wenn ich das wüßte! Aber ich verstehe die Lehre nicht. Ich weiß nicht, wo die Paradigmen sind, und ich weiß nicht, wo die Rückseite der Zeichen ist. Heute gibt es kaum einen Sprachwissenschaftler, der nicht die These unterschreiben würde, daß die Sprache ein Zeichensystem sei. Die Suche nach „Sprache ist ein Zeichensystem“ bzw. „ein System von Zeichen“ ergibt Tausende von Belegen, auch abgesehen von den identischen. (Sybille Krämer äußert Zweifel an der Existenz der Sprache hinter dem Sprechen, jedoch in einer mir weitgehend unverständlichen Verwendung von Derridas Thesen über den Primat der Schrift: https://www.fu-berlin.de/presse/publikationen/fundiert/archiv/2001_01/2001_01_kraemer/index.html) Aber von der eigentlich beobachtbaren Wirklichkeit, dem Sprachverhalten, bis zum "Zeichensystem" ist ein weiter Weg... |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 11.01.2024 um 19.54 Uhr |
|
Mit einem Psychologismus könnte ich auch nichts anfangen. Aber wenn Saussure ihm auch anhängt, zumindest die Grundlagen des bilateralen Zeichenmodells dürften doch davon völlig unabhängig sein, oder nicht?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.01.2024 um 17.39 Uhr |
|
„Eine solche assoziative Verbindung von Zeichen heißt bei ihm ‚Paradigma‘.“ (Martin Krampen über Saussure. In Martin Krampen/Klaus Oehler/Roland Posner/Thomas A. Sebeok/Thure von Uexküll, Hg.: Klassiker der modernen Semiotik. Berlin 1981:109) Später gibt Krampen zu, daß das nicht stimmt (S. 121). In Wirklichkeit hat erst Hjelmslev den Ausdruck „assoziativ“ durch „paradigmatisch“ ersetzt. Aber noch im Glossar wird unter „paradigmatisch“ auf Saussures „Grundlagen“ S. 147f. verwiesen, obwohl der Ausdruck dort nicht steht. Daß Saussure bei „assoziativ“ bleibt, hängt mit seinem radikalen Psychologismus zusammen, also gerade dem Lehrstück, das seine Theorie unbrauchbar macht.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.12.2023 um 07.14 Uhr |
|
Zum vorletzten Eintrag: Abgesehen von sachlichen und orthographischen Fehlern: Skinner schreibt has the character, Laermann übersetzt besitzt den Charakter. So wird ein außergewöhnlich klar geschriebener Text verdorben. Das geschieht heute fast automatisch. Einfach geht nicht, es muß immer ein bißchen aufgepeppt werden. Die Schwerfälligkeit deutscher Prosa liegt nicht am Sprachsystem, sondern am „Ethos“. Niemand hat das ausführlicher gezeigt als Eduard Engel (der es natürlich nicht so nennt). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.12.2023 um 06.12 Uhr |
|
„Für mich als Sprachwissenschaftler besitzt die Formseite Vorrang.“ (Hans Altmann in Jörg Meibauer/Markus Steinbach/Hans Altmann, Hg.: Satztypen des Deutschen. Berlin, Boston 2013:22) Das ist das nicht weiter begründete Dogma des amerikanischen Distributionalismus, einer radikalisierten Version des Strukturalismus, wie er bei Zellig Harris theoretisch postuliert worden ist, aber niemals wirklich durchgeführt wurde. Das methodische Leitbild ist die Analyse einer fremden Sprache, von der der Linguist kein Wort versteht und daher nicht einmal wissen darf, daß es sich überhaupt um eine Sprache handelt. Für Harris’ Schüler, den Computerlinguisten Chomsky, war diese Methode naheliegend, weil Maschinen die Sprache, die sie „verarbeiten“, nicht verstehen. Man spricht daher von syntaktischen Maschinen, und so wurde Chomskys generative Grammatik erst nachträglich um eine Semantik ergänzt, die allerdings wegen ihrer logizistischen, nichtempirischen Ausrichtung zunächst höchst unzulänglich ausfiel. Warum sollte die Topographie (nach Skinners Ausdruck) „für den Sprachwissenschaftler“ diesen Vorrang haben? Rein formal ist es nicht einmal möglich, die zu untersuchende „Sprachepisode“ abzugrenzen. Das Kind lernt nicht, beliebige Elemente (es könnten auch Legosteine sein) regelrecht aneinanderzufügen. Die Faktoren, die sein Verhalten steuern und nach den Vorgaben der Sprachgemeinschaft steuern sollen, sind vielfältiger. Bloomfield war noch ein sprachhistorisch (in Deutschland) ausgebildeter Indogermanist, viele seiner Schüler und Zeitgenossen waren es nicht mehr. Sie haben nur die eine Hälfte von Bloomfields Lehre übernommen, und die neue Selbstgenügsamkeit der amerikanischen Linguistik (nach zwei Weltkriegen) führte zu einer weiteren Horizontverengung. Charles Fillmore entdeckte irgendwann, daß Bühler „auch schon“ von Deixis gehandelt hatte, und noch später entdeckten deutsche, in der Chomsky-Schule aufgewachsene Linguisten, daß Hermann Paul „auch schon“ ganz Lesenswertes geschrieben hatte. Skinners Werk ist empirisch gehaltvoller, er hat sogar Philipp Wegener, Grace de Laguna u. a. gelesen, ganz zu schweigen von noch viel Früheren wie John Horne Tooke. Das ist paradox, weil er kein Linguist und nicht zur Kenntnis der Geschichte der Sprachwissenschaft verpflichtet war. Ein weiteres Beispiel wäre Lakoffs großspurig vorgetragene Metapherntheorie, die sich in goldener Ignoranz über alles hinwegsetzte, was in über 2000 Jahren dazu geschrieben worden war. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.12.2023 um 05.59 Uhr |
|
Absurderweise hat man auch dem radikalen Behaviorismus vorgeworfen, die Bedeutung vernachlässigt zu haben, obwohl „Verbal behavior“ von fast nichts anderem handelt, wenn auch nicht unter diesem Namen. Skinner befaßt sich mit der funktionalen Analyse des Sprachverhaltens, also jener „history of reinforcement“, die traditionell unter dem Namen der „Bedeutung“ in unzulänglicher Weise bearbeitet worden ist: „Diejenigen, die den Behaviorismus mit dem Strukturalismus verwechselt haben, haben sich bei ihrer Betonung der Form oder Topographie darüber beschwert, daß der Behaviorismus das Problem der Bedeutung vernachlässige.“ (Burrhus F. Skinner: Was ist Behaviorismus? Reinbek 1978:105) (Bei „Strukturalismus“ denkt Skinner nicht an Saussure, sondern an die Psychologie Titcheners u. a. Gemeinsam ist diesen Richtungen das Beschreibungsformat: Erfassung der „Phänomene“ ohne Einbettung in Situation und Geschichte.) Übrigens kann ich die deutsche Übersetzung von Skinners "About behaviorism" (von Klaus Laermann) nicht empfehlen. Sie strotzt von Fehlern, die den Sinn stellenweise geradezu ins Gegenteil verkehren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.12.2023 um 05.44 Uhr |
|
Paul ist Student/arbeitsscheu. Hier referiert man angeblich mit Student bzw. arbeitsscheu auf die Klasse der Studenten bzw. die Arbeitsscheu, eine „Gegebenheit der Welt, die sich in verschiedenen Individuen manifestiert“. (Clemens-Peter Herbermann: Modi referentiae. Studien zum sprachlichen Bezug zur Wirklichkeit. Heidelberg 1988:34) Die Rede „zielt“ nach diesem Modell auf etwas wie der Pfeil auf das Schwarze der Scheibe. Also muß es dieses Etwas irgendwie geben. Wir haben schon gesehen, in welche Schwierigkeit die Phänomenologen damit geraten. Herbermann formuliert im Grunde den Platonismus. Das Sich-Manifestieren ist ein anderer Ausdruck für die „Teilhabe“ an der Idee, ein nie geklärtes Lehrstück der Platonschen Philosophie. Der Behaviorist fragt: Wodurch wird die Verwendung von „arbeitsscheu“ gesteuert? Das läßt sich ohne Metaphysik herausfinden und formulieren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.12.2023 um 14.01 Uhr |
|
Wir müssen annehmen, daß Herodot den aus seiner Sicht paradoxen Zustand etwas ungeschickt ausgedrückt hat. Er wollte sicher sagen, daß die Sonne mittags unerwartet auf der "falschen Seite" stand, also bei der Umrundung des Kaps rechts, eben im Norden. Er sagt übrigens nicht ausdrücklich "auf einmal", sondern das hat die Übersetzerin aus dem Aorist herausgeholt, ganz mit Recht. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 08.12.2023 um 12.25 Uhr |
|
"die Sonne auf einmal zur Rechten"? Also mir kommt das sehr spanisch vor. Die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter. Während der ersten halben Runde in südlicher Richtung wechselt sie also einmal täglich von links nach rechts, während der zweiten Hälfte nach Norden von rechts nach links. Immer steht sie mindestens den halben Tag rechts. Wenn das Schiff im Mittelmeer genau von West nach Ost fährt, steht die Sonne den ganzen Tag im Süden, und wenn es in der Gegend am Kap der Guten Hoffnung genau ost-westlich fährt, steht sie den ganzen Tag im Norden, in beiden Fällen also ganztäglich rechts. Was ist also mit diesem "auf einmal zur Rechten" gemeint? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.12.2023 um 06.39 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#49440 Es ist wahr, daß außer Herodot niemand etwas über die erste Umrundung Afrikas zu wissen scheint. Darum ist seine Erzählung auch angezweifelt worden. Dagegen spricht aber, was Marion Giebel einmal so zusammenfaßte: „Der Ägypterkönig war der Initiator einer Entdeckerfahrt, von der uns Herodot berichtet. Pharao Necho rüstete Schiffe aus zu einer Umsegelung Afrikas. Die Seeleute waren Phönizier, die führende Seefahrer- und Handelsnation, die damals schon Ansiedlungen im Nildelta hatten. Sie waren stets an neuen Handelswegen interessiert und brachen vom Roten Meer aus auf in den Golf von Aden, dann um die Somalihalbinsel herum in den Indischen Ozean. Zwar beherrschten sie die Navigation nach Sonne und Sternen und konnten daher auf die offene See hinausfahren, aber es ließ sich natürlich kein Proviant für unbegrenzt lange Fahrten mitnehmen. So machten sie folgendes: Jeweils im Herbst gingen sie an Land und säten Getreide, eine schnellwachsende Sorte, wohl Emmer, warteten die Ernte ab und fuhren dann mit dem Korn wieder weiter. So ging es zwei Jahre, im dritten Jahr aber bogen sie um die Säulen des Herakles herum (die Straße von Gibraltar) und kamen wieder ins Mittelmeer und zur Nilmündung. Etwas wundert Herodot freilich bei dieser Geschichte: ‚Sie erzählten, sie hätten auf ihrer Fahrt um Afrika herum die Sonne auf einmal zur Rechten gehabt. Das mag glauben, wer will – ich jedenfalls nicht!‘ Was Herodot – und noch vielen nach ihm – so unglaubwürdig erschien, ist freilich gerade der Beweis für die geglückte Umsegelung Afrikas. Tatsächlich mußten die phönizischen Seeleute, wenn sie südwärts des Äquators Afrika umfuhren, die Sonne zur Rechten haben, das heißt im Norden.“ (καὶ ἔλεγον ἐμοὶ μὲν οὐ πιστά, ἄλλῳ δὲ δή τεῳ, ὡς περιπλώοντες τὴν Λιβύην τὸν ἥλιον ἔσχον ἐς τὰ δεξιά. Die Stelle ist ein schönes Beispiel für Herodots unwiderstehlichen Erzählton!) Herodot behielt sich vor, einige der Berichte, die er hörte, für Märchen zu erklären, aber wie hätte er darauf kommen sollen, unfreiwillig den Beweis dafür mitzuliefern, daß dieser Bericht wahr sein mußte? Er wußte tatsächlich nichts von der Kugelgestalt der Erde, und so mußte sein Argument ihm zwingend erscheinen. Später hat Sataspes eine Umrundung Afrikas in der anderen Richtung versucht, aber abgebrochen, nachdem er bis zu den Pygmäen gekommen war. (Xerxes hielt ihn für einen Lügner und ließ ihn pfählen.) Von kleinen braunen Menschen südlich der Sahara berichtet Herodot auch bei anderer Gelegenheit, nannte sie aber nie Pygmäen, obwohl er den Namen aus Homer kennen mußte. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 19.11.2023 um 23.57 Uhr |
|
zum Haupteintrag unter "1. Begriffliche Schwierigkeiten", Zitat Bußmann: H. Bußmann schreibt in ihrem Lexikon unter dem Stichwort Zeichen, jedes bestehe nach de Saussure aus dem materiellen Zeichenkörper (Bezeichnendes) sowie einem begrifflichen Konzept (Bezeichnetes). Unter dem Stichwort Bezeichnendes vs. Bezeichnetes schreibt sie jedoch, beide Seiten seien psychischer Natur (Hervorheb. v. mir). Wie kann etwas gleichzeitig materieller Körper und psychischer Natur sein? Schon "Zeichenkörper" ist irreführend. Man denkt vielleicht daran, daß ein Verkehrszeichen oft ein bemaltes Blechschild ist. Aber auf das Schild kommt es nicht an. Manchmal sind dieselben Verkehrszeichen an einer Hauswand oder einem LKW-Anhänger aufgemalt, manchmal bestehen sie nur aus Licht. Das sprachliche Zeichen A kann Tinte oder ein Häufchen Graphit auf weißem Papier, eine Neonleuchte, eine in Stein gemeißelte Rille oder ein ausgestanztes Loch in Pappe sein. Der materielle Körper spielt keine Rolle, allein an der Form ist es erkennbar. Die Form ist das Wesentliche, der Körper ist beliebig, dient nur der Speicherung. Aber wenn es nur auf die Form ankommt, dann ist diese Seite des Zeichens trotzdem nicht "psychischer Natur". Was für eine Form hätte denn eine Idee, ein Gedanke, ein Gefühl? Das Bezeichnende ist seinem Wesen nach also weder materiell noch psychisch, sondern es handelt sich um Information! Das Bezeichnete könnte sowohl etwas irreales Psychisches (z. B. eine Alptraumfigur oder ein rundes Viereck) als auch einen real existierenden Gegenstand meinen. Beiden gemeinsam ist das "begriffliche Konzept", welches aber ebenfalls weder psychisch noch materiell, sondern wieder Information ist. Ein bilaterales Zeichen sollte man also richtiger als Gleichsetzung bzw. Zuordnung zweier Informationen zueinander sehen. Die eine Seite wird zum Referenzieren der anderen Seite verwendet. Mit solchen Unstimmigkeiten einzelner Wissenschaftler kann man aber meines Erachtens nicht das ganze bilaterale Zeichenmodell widerlegen, denn, wie ich glaube wenigstens in diesem Fall gezeigt zu haben, sie sind behebbar. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.11.2023 um 05.14 Uhr |
|
Zum Thema „Selbstgespräch“ erwähnenswert: Kürzlich mal eine Fernsehverfilmung von Agatha Christies „The man in the brown suit“ (1988) gesehen. Wirr und langweilig, aber besonders dilettantisch: Die Heldin sprach ihre Gedanken laut und deutlich vor sich hin wie auf der klassischen Theaterbühne. Man glaubte der Schauspielerin anzusehen, wie peinlich ihr das war. Es gibt für solche Betätigungen vor der Kamera keine einigermaßen natürliche Haltung und Mimik, so daß diese Deklamationen wie Fremdkörper wirkten. (Die Diamanten, um die es wieder mal ging, sahen aus wie Amethyst- und Bergkristallimitate aus der Wundertüte. Die Pistolen, die auch nicht fehlen dürfen, werden immer so gehalten, als hätten die Leute noch nie solche Dinger in der Hand gehabt.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.10.2023 um 09.23 Uhr |
|
Ein Pfeil (wie auf der schon mehrmals erwähnten Pioneer-Plakette) scheint für uns selbstverständlich ein Richtungsweiser zu sein. Ab das setzt voraus, daß er als Geschoß eingesetzt wird, andernfalls ist er nur ein seltsam geformter Hakenstab. Diese kleine Erinnerung deutet an, wie verschieden die scheinbar ganz natürlichen Zeichen anderer Kulturen und erst recht anderer Tierarten beschaffen sein können. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.10.2023 um 04.30 Uhr |
|
Das Niesen ereignet sich manchmal als leicht durchschaubarer Reflex auf einen äußeren Reiz (Staub, helles Licht), oft aber ohne erkennbare Ursache. Darum kann es als Zufallsgenerator genutzt werden. Vgl. den recht guten Eintrag bei Wikipedia, wo interessante ethnographische Einzelheiten referiert sind. „In Ostasien ist der Glaube verbreitet, dass zum Zeitpunkt des Niesens gerade an einem anderen Ort über den Niesenden gesprochen oder an ihn gedacht wird (vgl. auch unter Schluckauf!). Auf Chinesisch lautet die Spruchformel daher yǒu rén xiǎng nǐ (chinesisch 有人想你), was so viel heißt wie: ‚Jemand denkt an dich.‘ oder ‚Jemand vermisst dich.‘“ Der Aberglaube bringt beide Ereignisse in einen realen Zusammenhang, der auch zeichenhaft gedeutet werden kann. Omina haben diese Doppelnatur. Bei den alten Griechen signalisiert Zeus seine Zustimmung durch das Niesen eines Handlungsbeteiligten, vgl. Od. 17, 539–551, ähnlich Xenophon, Anabasis 3:2, 9. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.08.2023 um 11.33 Uhr |
|
Eigentlich ist schon der große Zeiger einer Uhr, der Minutenzeiger, redundant. Der kleine Zeiger zeigt nicht nur Stunden, sondern auch Minuten an. Auf dem Zifferblatt ist genau eine Markierung notwendig, z. B. bei 12 Uhr (Nullstellung), alles andere ist redundant. So eine Uhr ginge zwar nicht weniger genau, aber sie wäre i. a. nicht genau genug ablesbar. Die Redundanzen (Minutenzeiger und überzählige Zifferblattmarkierungen) sind also praktisch gar keine. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.08.2023 um 05.50 Uhr |
|
Zur segensreichen doppelten Kodierung bei Verkehrszeichen und Analoguhren (Ziffernblatt plus Winkel zwischen den Zeigern): Rousseau war als Notenschreiber (nicht als erster) auf die Idee gekommen, Noten durch Zahlen zu ersetzen. Das bedeutet: die analoge Kodierung der Töne durch eine digitale zu ersetzen, was gewisse Vorteile mit sich brächte. Obwohl meine Lektüre der „Bekenntnisse“ Jahre zurückliegt, erinnere ich mich sehr gut jener Stelle im zweiten Teil, an der er seine Bekehrung beschreibt: Der einzige beachtungswerthe Einwand, welcher sich gegen mein System erheben ließ, wurde von Rameau gemacht. Kaum hatte ich es ihm auseinandergesetzt, als er die schwache Seite desselben sofort erkannte. «Ihre Zeichen,« sagte er zu mir, »sind in der Beziehung sehr gut, daß sie die Geltung der Noten einfach und klar bestimmen, die Pausen deutlich angeben und in der Verdoppelung stets das Einfache zeigen, lauter Dinge, für welche die gewöhnliche Notenschrift nichts thut; aber sie taugen insofern nichts, als sie eine Geistesthätigkeit verlangen, welche nicht immer der Schnelligkeit der Ausführung zu folgen vermag. Das Auge,« fuhr er fort, »überschaut mit einem Blicke die Stellung unserer Noten und macht diese Geistesthätigkeit deshalb überflüssig. Wenn zwei Noten, eine sehr hohe und eine sehr niedrige, durch eine Reihe dazwischen liegender Noten verbunden werden, so sehe ich auf den ersten Blick ihre stufenweise Verbindung mit einander; aber um bei Ihnen einen sicheren Ueberblick der ganzen Tonreihe zu gewinnen, muß ich notwendigerweise alle ihre Zahlen eine nach der andern lesen; der Ueberblick läßt sich jedoch durch nichts ersetzen.« Gegen diesen Einwurf schien sich nichts einwenden zu lassen, und ich gestand es sofort zu; obgleich er einfach und schlagend ist, gehört doch eine langjährige Uebung in der Kunst dazu, um auf ihn zu verfallen, und es ist deshalb nicht erstaunlich, daß er keinem der Akademiker in den Sinn kam; es ist im Gegentheil nur erstaunlich, daß alle diese großen Gelehrten, die so vielerlei Dinge wissen, so wenig verstehen, daß jeder nur über sein Fach urtheilen sollte. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 22.06.2023 um 12.41 Uhr |
|
Mit der Hoffnung ist es auch oft ein eigen Ding. Der MM schreibt heute zum vermißten Tauchboot (S. 28): Die Laute deuteten darauf hin, daß es weiter Hoffnung auf Überlebende gebe. Laute können wohl Hoffnung wecken oder verstärken, aber sie deuten nicht auf Hoffnung. Laute sind evtl. Lebenszeichen, nicht Hoffnungszeichen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.06.2023 um 04.26 Uhr |
|
Im Haupteintrag wurde schon eine Linguistin zitiert, die unverständlicherweise behauptet, die Sprechtätigkeit sei "in ihrem Ablauf nicht beobachtbar". So sagt auch Michael Tomasello: „Mein eigener Standpunkt ist, daß Sprache einfach eine Form der Kognition ist.“ (Michael Tomasello: Die kulturelle Entwicklung des Denkens. Frankfurt 2003:177) Auch Chomsky betont ja, die Sprache sei primär unabhängig vom Sprechen, eine Fähigkeit des "Geistes". Aber ein empirisch arbeitender Psychologe und Anthropologe kann das doch nicht ernst meinen? Oder er versteht unter "Kognition" etwas ganz anderes. Wenn man den Begriff Kognition für notig hält, sollte man doch eher meinen, daß sie zu den Voraussetzungen der Sprache gehört. Bei Tomasello wird von der ersten Seite an vor das Verhalten geradezu zwanghaft das "Kognitive" eingeschoben. Deshalb braucht der Säugling, bevor er auf das Verhalten einer Parson angemessen reagiert, eine "Theorie des Geistes". Über die Frühmenschen vor 200.000 Jahren sagt er: „Aber am auffälligsten waren ihre neuen kognitiven Fertigkeiten und die Gegenstände, die sie herstellten.“ (Ebd. S. 11) Die Menschen verhielten sich geschickter, das sieht man an ihren Werkzeugen. Die "kognitiven Fertigkeiten" sind nicht fossiliert, sondern vom Verfasser hinzukonstruiert – übrigens eine merkwürdige Begriffsbildung, weil man im Geist eher Fähigkeiten als Fertigkeiten erwartet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.06.2023 um 05.14 Uhr |
|
Als mißglückten Sprechakt im Sinne Austins kann man bezeichnen, was ein hiesiger Landwirt sich erlaubt: Unter dem Hinweis auf seinen Hof, wo er Erdbeeren verkauft, hat er ein amtliches Umleitungsschild angebracht (schwarze Schrift auf gelbem Grund, Sie wissen schon...), so daß Autofahrer von der Durchgangsstraße abzubiegen aufgefordert werden. Darauf fällt zwar niemand herein, aber nur weil die meisten sich hier sehr gut auskennen. Mal sehen, wie lange die Polizei den Scherz noch übersieht. Auf andere Weise mißglückt ist die neue Markierung besagter Straße mit Tempo-30-Schildern. Weil die Geschwindigkeit wie bisher nicht kontrolliert wird, fährt man vielleicht 60 statt 70. Ich habe aber auch schon welche mit 120 Anlauf nehmen sehen, damit sie den Berg zum Nachbardorf hinaufkommen oder weil es so schön brummt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.06.2023 um 06.31 Uhr |
|
Parmenides hat direkt und über die eleatische Sophistik Platon, Aristoteles und die ganze intellektuelle Welt Griechenlands beeinflußt wie kein anderer. Im Bayerischen Rundfunk lief kürzlich eine Sendung über ihn, wofür leider die falschen Experten befragt worden waren. Einer glaubte bei ihm den Sinn des Lebens (oder so ähnlich) für sich gefunden zu haben, ein anderer folgerte aus den bruchstückhaften Ausführungen über die Fortpflanzung (Fragment C 10) gar, daß Parmenides mit seinem Lehrgedicht seine eigene unglückliche queere Veranlagung habe bewältigen wollen. Von einer solchen ist allerdings der klatschsüchtigen Antike nichts bekannt. Manche hören eben die psychoanalytischen Flöhe husten. Weil er im Kern über „sein“ und „ist“ nachdenkt, ist er zum „Vater der Ontologie“ ernannt worden. Soweit das zutrifft, halte ich es für einen Betriebsunfall. Ontologie ist natürlich Unsinn. Der Mittelpunkt von Parmenides’ Erleuchtung steckt zweifellos in diesem Satz: Ist, nicht aber: Ist nicht. Alles andere ist erstens der mehr oder weniger unzulängliche Versuch, dies dem Leser nahezubringen, zweitens eine traditionell verkleidete Erhöhung des Erleuchtungserlebnisses. Ich sehe die Bedeutung des Parmenides in der Konstruktion logischer Probleme (aus denen die Zenonischen Paradoxien und andere Fallstricke abgeleitet wurden), mit deren Lösung dann Platon in den Spätdialogen ausgiebig und mit größtem Ernst beschäftigt ist; Aristoteles hat dafür die endgültige Form gefunden. Ich neige also der Deutung Guido Calogeros zu („Studi sul´ eleatismo“). Was sprachlich nicht funktioniert (mangels Referenz), kann auch nicht gedacht werden, denn Sagen und Denken sind das gleiche: ταὐτὸν δ᾽ ἐστὶ νοεῖν τε καὶ οὕνεκεν ἔστι νόημα. Ich verstehe mit Calogero das οὕνεκεν als ὅπως/ὡς, wie Parmenides an anderer Stelle sagt. Die Identität von Sagen und Denken wird immer wieder paraphrasiert: χρὴ τὸ λέγειν τε νοεῖν τ᾽ ἐὸν ἔμμεναι usw. Es ist auch kein Zufall, daß dieser „logische“ Teil des Lehrgedichts am besten überliefert ist. Die sprachliche Unbeholfenheit war damals nicht zu überwinden, weil es überhaupt noch kein logisches Vokabular gab. Insofern hat Parmenides uns nichts mehr zu sagen. Er war eine unentbehrliche Stufe der Leiter, auf der man hinaufsteigt, um sie dann wegzustoßen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.05.2023 um 06.35 Uhr |
|
Wieder einmal wird nachgewiesen, daß es die "Eisheiligen" nicht gibt. Psychologisch könnte man von einer "Clustering-Illusion" sprechen, die vielerlei Aberglauben zugrunde liegt, bis hin zu Verschwörungstheorien. Wir nehmen wahr und merken uns, was der Bestätigung dient, alles andere übersehen und vergessen wir. Das scheint heute eine Binsenwahrheit zu sein, aber das ändert nichts an der Wichtigkeit. Aufklärung ist nötig, aber schwierig wegen unseres lebenswichtigen Interesses an Mustererkennung.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.04.2023 um 06.33 Uhr |
|
Es wird daran erinnert, daß Verkehrszeichen in Parkhäusern nicht gelten, weil es sich nicht um öffentlichen Raum handelt. Man könnte das Aufstellen solcher Zeichen als einen mißglückten Sprechakt im Sinn der Sprechakttheorie bezeichnen. Ich kann zu meiner Frau sagen: "Hiermit ernenne ich dich zur Bundeskanzlerin." Das ist aus leicht erkennbaren Gründen nicht wirksam, eben "verunglückt". In Parkhäusern erinnern die Verkehrszeichen gewissermaßen metaphorisch an den Privatvertrag, den der Autofahrer stillschweigend mit dem Betreiber schließt, indem er sich hineinbegibt. Danach bemißt sich die Haftung bei Schäden. Schwierig wird es bei Feld- und Waldwegen, weil der Wanderer ohne weitere Beschilderung nicht erkennen kann, ob es sich um einen privaten oder öffentlichen Weg handelt. Auch gibt es kein Tempolimit, so daß man auch mit 180 km/h durch den Wald brausen könnte. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.04.2023 um 04.28 Uhr |
|
Tschu – tschu – tschu die Eisenbahn... (auch tu – tu – tu oder töff – töff – töff usw.) – das ist heute so unverständlich wie das alte Verkehrszeichen mit einer stilistierten Dampflok. Die Kinder stört es nicht. Zahllose Redewendungen bewahren noch das alte Handwerk. Haushoch und meilenweit – das sind noch die früheren Dimensionen. Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#48577 |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.01.2023 um 04.20 Uhr |
|
Während die Kognitivisten "Bedeutung" als eine Art Übersetzung in eine Sprache des Geistes bzw. als geheimnisvolle "Rückseite" des Zeichens auffassen, versteht der Naturalismus darunter einfach die Funktion, und die ist keineswegs unbeobachtbar. Die Bedeutung der Blütenform für die Biene ist sonnenklar und nicht nur "erschließbar"; man muß nur den Lebenszusammenhang und die Entwicklungsgeschichte einbeziehen. (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#48984) Interessanterweise haben die alten Inder für Bedeutung den Ausdruck artha- benutzt, was zwar vieldeutig ist, hier aber "Zweck, Funktion" bedeutet und auf keinen Fall eine Übersetzung oder mentale Kopie bei den heutigen Scholastikern. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.12.2022 um 04.41 Uhr |
|
Bennett und Hacker (Max Bennett/Peter Hacker: Philosophical foundations of neuroscience. 2. Aufl. Oxford 2021) geben eine äußerst gründliche Studie zum Gebrauch von consciousness und angrenzenden Ausdrücken (attention, awareness...) im Englischen. Aus der Sprachwissenschaft ist mir keine vergleichbare Wortfeldstudie bekannt, allenfalls Anna Wierzbicka und ihre Schule fallen mir ein. Das meiste ist ohne weiteres auf das Deutsche und andere SAE-Sprachen übertragbar, aber bei fremderen Kulturen sieht es wahrscheinlich anders aus. Die enzyklopädischen Artikel zu „Bewußtsein“ usw. stellen die verschiedensten Gebrauchsweisen und Deutungen nebeneinander, ohne sie synonymisch zu vergleichen und zu verbinden, wie es der Philosoph Hacker tut. Die Sprachwissenschaft, die früher ebenso eindringlich auf diesem Gebiet tätig war („Wörter-und-Sachen-Forschung“), hat sich unter dem Einfluß des Strukturalismus auf eine lächerliche und weltfremde Komponentenanalyse eingelassen, so daß wir heute in der Lage sind, Pferde („equin“) und Hühner („gallin“) exakt zu unterscheiden; auch Mützen („für den Kopf“) und Schuhe („für die Füße“) usw.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.10.2022 um 05.08 Uhr |
|
„Referenz ist eine Relation zwischen dem Vorkommnis eines singulären Terms (einer Gegenstandsbezeichnung) und dem dadurch bezeichneten Objekt.“ (Albert Newen/Eike v. Savigny: Analytische Philosophie. München 1996:193) (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#39641) Hier müßte man wissen, wie es zu dem „bezeichneten Objekt“ kommt, das bereits vorausgesetzt wird, um „Referenz“ (ein anderes Wort für „Bezeichnung“) zu definieren. Zwischen dem singulären Term Odysseus und Odysseus selbst gibt es keine „Relation“. Der philosophische Wortnebel sollte nicht darüber hinwegtäuschen. Da es Odysseus nicht wirklich gibt oder gegeben hat, kann er das Auftreten des Namens Odysseus nicht steuern, wie es der Regenbogen tut, wenn ich auf einen zeige. Vielmehr ist die Rede von Odysseus durch anderes Reden von Odysseus gesteuert. Skinner nennt das „intraverbale Steuerung“. Beim Reden von Cäsar ist es zunächst ähnlich, aber Cäsar hat außerdem Wirkungen hinterlassen, die über die Literatur hinausgehen, darunter übrigens seine eigenen Schriften. Auch Statuen usw. sind zu diesen sogenannten Dokumenten oder Denkmälern zählen, während Abbildungen des Odysseus allenfalls textgesteuerte Fiktionen sind. Kurzum: Cäsar gehört letzten Endes zum gleichen Bestandssystem wie du und ich, Odysseus nicht. (Irgendwann konnte man auf Cäsar zeigen, auf Odysseus nie.) Beim Erzählen von Odysseus oder Rotkäppchen treiben wir ein Verstellungsspiel: Wir tun so, als ob da etwas wäre oder gewesen wäre, aber es ist als spielerisch erkennbar („fiktional“). Die Grenze verschwimmt allerdings und ist auch nicht immer relevant. Der Mythos läßt die Frage der historischen Realität offen, sie interessiert ihn nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.09.2022 um 04.55 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#24337 (vereiste Fensterscheiben) Als Kind schlief ich zeitweise in einer Dachkammer, die selbstverständlich nicht beheizbar war. (Ich habe noch das unverkennbare leise Trappeln der Ratten im Ohr, die hinter der Bretterwand hausten; nebenan war der Schweinestall des Nachbarn.) Im Winter war die Fensterscheibe morgens mit phantastischen Eisblumen bedeckt, die aus meiner Atemluft stammten. Anlaufende Fenster und Eisblumen sind ein typisches Indiz mangelhaft wärmedämmender Fenster. Durch moderne Fenster sind Eisblumen in heimischen Häusern heute ein seltenes Phänomen geworden. (Wikipedia) Richtig, es sind Indizien, Anzeichen von etwas, und keine Zeichen für etwas. Sie informieren nicht über den Frost, sondern sind ein Teil davon. Wie bei allen Anzeichen führt mangelhafte Übersicht dazu, daß man einen Teil als Indiz des anderen nutzen kann. Es gibt aber keine Semantisierungsgeschichte. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.07.2022 um 05.47 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#45529 Zuerst hat wohl Diogenes Laertios behauptet, Parmenides habe die Kugelgestalt der Erde entdeckt: „Als erster zeigte dieser, daß die Erde kugelgestaltig sei und in der Mitte liege“ So schreibt denn auch Wilamowitz in der dritten (noch nicht in der zweiten) Auflage seiner kurzen Geschichte der griechischen Literatur: „...seit man die Kugelgestalt des Himmels und der Erde anerkannte (also seit Parmenides)“ Das ist aber ganz unbegründet. Bei Parmenides ist weder vom Himmel noch von der Erde die Rede: „Aber da eine letzte Grenze vorhanden, so ist [das Seiende] abgeschlossen nach allen Seiten hin, vergleichbar der Masse einer wohlgerundeten Kugel, von der Mitte nach allen Seiten hin gleich stark. Es darf ja nicht da und dort etwa größer oder schwächer sein. Denn da gibt es weder ein Nichts, das eine Vereinigung aufhöbe, noch kann ein Seiendes irgendwie hier mehr, dort weniger vorhanden sein als das Seiende, da es ganz unverletzlich ist. Denn [der Mittelpunkt,] wohin es von allen Seiten gleichweit ist, zielt gleichmäßig auf die Grenzen.“ Das ist offenbar keine astronomische Aussage, sondern eine der logischen Folgerungen aus der These, daß es kein Nichtsein gebe. Parmenides spricht weder von der Erde noch vom Himmel. Der Vergleich mit der Kugel veranschaulicht die vollkommene Gleichmäßigkeit oder Kontinuität des Seins nach allen Seiten. Auch mein Erlanger Kollege Theodor Ebert hat die Zuschreibung bestritten: "Wer hat die Kugelgestalt der Erde entdeckt?" Vortrag am 27. Januar 2005 im Collegium Alexandrinum Der Vortrag untersucht die Frage, wer die Kugelform der Erde entdeckt hat und wie diese Entdeckung begründet wurde. Durch ein Zitat aus einem Text des Aristoteles wird nachgewiesen, daß die Kugelgestalt der Erde bereits im vierten Jahrhundert v. Chr. bekannt war und daß dafür zwei Beobachtungen eine begründende Rolle gespielt haben: 1) die Veränderung des Horizontes bei einer Positionsänderung des Beobachters 2) die Form des Erdschattens bei einer Mondfinsternis. Dann wird, in Anknüpfung an die Arbeit von Erich Frank (1923), gegen die neuerdings unternommene Zuweisung dieser Entdeckung an den vorsokratischen Philosophen Parmenides argumentiert. Gegen diese Zuweisung spricht der Umstand, daß die Behauptung einer kugelförmigen Erde, die überdies von riesiger Größe ist, im platonischen Phaidon als eine zum dramatischen Zeitpunkt des Dialoges (399) neue und revolutionäre Theorie dargestellt wird. Auch wird von den jonischen Astronomen des fünften Jahrhunderts die Erde als kreisrunde Scheibe oder Säulentrommel aufgefaßt. Die Vorstellung einer kugelförmigen Erde ist ihnen unbekannt. Als Entdecker der Kugelform dürfte der pythagoreische Mathematiker Archytas aus Tarent in Frage kommen: Ihm wird von dem römischen Dichter Horaz die Vermessung der Erdoberfläche zugeschrieben. Eine Berechnung der Größe der Erdoberfläche war aber nur bei Annahme einer Kugelform der Erde möglich. Video: http://www.ebert-theodor.de/?q=node/6 |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.05.2022 um 06.22 Uhr |
|
Noch zu "Information": Cäsars Bericht über den gallischen Krieg hat eine gewisse Wahrscheinlichkeitsstruktur, die sich berechnen läßt: die Häufigkeit der Buchstaben usw. Auf den Inhalt bezogen, verliert das jede Relevanz. Man müßte das, was Cäsar mitteilt, mit dem abgleichen, was ohne seinen Text über jene Zeit bekannt war bzw. aus dem Bekannten ableitbar wäre, um dann den Neuigkeitswert bzw. die Redundanz seiner Mitteilungen zu berechnen. Das wird nie möglich sein. Um nur einen einzigen Grund zu erwähnen: Für die Geschichte gibt es keine allgemeinen Gesetze. Wenn wir erkennen, daß ein Himmelskörper um einen Fixstern rotiert, wissen wir, daß er sich gemäß den Keplerschen Gesetzen bewegt. Bei geschichtlichen Ereignissen sind solche Folgerungen nicht möglich, zumal diese Ereignisse selbst durch ihre stets variable Darstellung erst „konstituiert“ werden und sich aus einer anderen Sicht ganz anders darstellen können. (Womit ich aber nicht meine, daß es die historische Wirklichkeit an sich nicht gegeben habe.) Hinzu kommen pragmatische Zutaten aus dem Fundus des jeweiligen Lesers. Wenn Cäsar zum Beispiel schreibt, er sei nach einem bestimmten Ort marschiert, so wird normalerweise angenommen, daß er auch dort angelangt ist; es kann aber auch anders gewesen sein. Dies und vieles andere macht eine exakte logische Normalform unmöglich und damit auch die mathematische Bearbeitung.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.04.2022 um 06.33 Uhr |
|
Nach Dawkins „besitzt eine einzelne menschliche Zelle genügend Informationskapazität, um die gesamte Encyclopaedia Britannica mit all ihren 30 Bänden drei- oder viermal zu speichern.“ (Der blinde Uhrmacher 177f.) Der DNS-Code läßt nicht erkennen, was er „bedeutet“: er kann die Körperfunktionen steuern oder die Britannica enthalten – je nach angeschlossener Hardware wird man es sehen. Wenn man die Molekülsequenzen unter dem Mikroskop betrachten könnte, würden sie sich nicht signifikant unterscheiden, es ist immer eine Abfolge der gleichen Elemente. Das läßt sich mit dem Programm eines Universalcomputers vergleichen. Könnte die gleiche Sequenz je nach angeschlossener Hardware einmal einen Text, ein andermal ein Bild oder ein Musikstück erzeugen? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.04.2022 um 05.09 Uhr |
|
Um Zeichen von anderen Formen der Anpassung zu unterscheiden, bringt Skinner schon auf der ersten Seite seines Hauptwerks die Bestimmung unter: „The ultimate consequence, the receipt of water, bears no useful geometrical or mechanical relation to the form of the behavior of ‚asking for water‘.“ Die Grenze ist allerdings nicht scharf zu ziehen. Bei einem traditionellen Schlüssel (Buntbartschlüssel) ist eine solche Beziehung noch gegeben (obwohl Braitenberg auch hier von „Information“ spricht), bei einem modernen Schließmechanismus mit Transponderchip nicht mehr. Diesem könnte man die Botschaft „Aufmachen!“ unterstellen. Die Technik spricht gleichwohl einheitlich von der „Codierung“ eines Schlüssels und schließt die Schweifung eines Buntbartschlüssels ein. Die Vorläufer waren einfache Hebelmechanismen als Hilfe zum Anheben eines Riegels. Zeichentheoretisch wird irgendwann die Grenze von der Mechanik zur Kommunikation überschritten. Bei den 125 von Wikipedia genannten Köpfen von Schraubendrehern wird die Stufe der Mustererkennung nie erreicht, es kommt immer nur darauf an, die Kraft auf eine Schraube zu übertragen. Darum spricht man hier nicht von Codierung und Information. Im Tierreich ist etwa die Körpergröße eines Bullen ein Symptom seiner Stärke und Überlegenheit und wird von Schwächeren so wahrgenommen. Symptome sind keine Zeichen, sondern Anzeichen. Dagegen steht die Warnfärbung der Wespe in keiner solchen natürlichen Beziehung zur Gefährlichkeit ihres Stachels. Sie ist daher als wirkliches Zeichen anzusehen. Harmlose Fliegen, die sich das durch Mimikry zunutze machen, begehen Signalfälschung. Der Verwesungsgeruch von verrottendem Fleisch ist ein Anzeichen (Symptom) und kein Zeichen. Die Stinkmorchel und manche Pflanzen imitieren das und bilden dadurch wirkliche Zeichen aus (Symptomfälschung). |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 27.04.2022 um 13.31 Uhr |
|
Um die Überschneidung der beiden Bedeutungen von "Information" zu vermeiden und um von der alleinigen Sicht als Nachricht bzw. als kommunikatives Ereignis abzukommen, bin ich gern bereit, überall da, wo ich bisher "Information" geschrieben habe, stattdessen das Wort "Muster" einzusetzen, welches Sie, lieber Prof. Ickler, ja auch schon zur Unterscheidung gebraucht haben. Die Daten und Eigenschaften der materiellen Welt spiegeln sich in natürlichen und künstlichen Mustern wider, Muster beschreiben die Realität (sie sind, so hätte ich bisher gesagt, Information über die Welt). Hinreichend komplizierte Muster (z. B. Buchtexte) können also auch beliebige Ideen ausdrücken. Auf "Information" bzw. jetzt auf Muster waren wir ja durch die Frage der Existenz gekommen. Muster existieren objektiv real, obwohl sie nicht materiell sind, was, wie ich meine, ganz offenbar ist (siehe das Beispiel mit den Spielwürfeln). Muster sind aber an Materie (gefärbtes Papier, Gehirn, ...) gebunden. Wenn man in Meinongs Auffassung "auch was es nicht gibt, muß irgendwie existieren" diese beiden Existenzbegriffe nicht unterscheidet, dann wird es natürlich widersprüchlich. Was es nicht gibt, gibt es in materieller Form auch nicht. Aber eine Idee, d.h. ein Muster, welches dieses nicht existierende materielle Ding beschreibt, also etwas völlig anderes als das Ding selbst, kann sehr wohl "bestehen", wie Meinong zur Unterscheidung bzw. zur Erklärung des "irgendwie" auch sagt. Dieser nur scheinbare Widerspruch, das war das Ziel meiner Überlegung, hat also nichts mit der Zeichentheorie zu tun, sondern er beruht auf unzulässiger Verwendung verschiedener Arten von realer Existenz. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.04.2022 um 08.19 Uhr |
|
Zerbrochene Ringe, deren Hälften genau aneinander paßten, gab es als Erkennungszeichen anscheinend schon vor 6000 Jahren. Das haben finnische „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler“ festgestellt. (Bericht der SZ am 27.4.22, das Gendern wird gleich wieder aufgegeben) Die Einordnung als „Freundschaftsringe“, „um sich ihrer Zusammengehörigkeit zu versichern“, ist allerdings zu sentimental und romantisierend. Anscheinend denkt man an Freundschaftsbändchen und so etwas. Auch wird nicht erwähnt, daß eine solche Praxis als Ursprung des Wortes „Symbol“ (symballein „zusammenwerfen“) gilt. Das war eine ernsthafte Angelegenheit: In älterer Zeit war der einzelne außerhalb seiner Familie und seiner Siedlung praktisch rechtlos. Um so bedeutsamer war das System der Gastfreundschaft, das noch heute archaische Gesellschaften durchzieht: Wer ein „Symbol“ vorweisen konnte, wurde wenigstens vorübergehend aufgenommen, und es gab sicher auch schon „Niederlassungen“ von Kaufleuten, die Personen austauschten. Erkennungszeichen besiegeln nicht die Beziehung von Freunden, die einander ja schon bestens kennen und keinen solchen Identitätsausweis brauchen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.04.2022 um 06.26 Uhr |
|
However, meaning and significance are quite different from Shannon information, as Weaver takes care to point out in the famous treatise. „The word information, in this theory, is used in a special sense that must not be confused with its ordinary usage. In particular, information must not be confused with meaning. In fact, two messages, one of which is heavily loaded with meaning and the other of which is pure nonsense, can be exactly equivalent, from the present viewpoint, as regards information ... the semantic aspects of communication are irrelevant to the engineering aspects.“ (Shannon and Weaver 1949, 99) (nach Owren et al.) Ich versuche immer, dies im Auge zu behalten. Sonst weiß man bald nicht mehr, wovon die Rede ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.04.2022 um 19.37 Uhr |
|
Über Jahresringe usw. haben wir hier im selben Strang schon vor zwei und vier Jahren diskutiert. Ich habe keine neuen Argumente.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 26.04.2022 um 12.19 Uhr |
|
Ich meine Information im abstrakten Sinne, als Fachausdruck. Aber auch wiederum nicht so wie Shannon, der Information nur als das versteht, was einen Neuigkeitswert hat. (Was er als Redundanz, das Gegenteil von Information, bezeichnet, kann man ja auch mehrfach gespeicherte gleiche Information nennen.) Mit Information meine ich die Gesamtheit aller Daten (Fakten) in zeitlichem und räumlichem Sinn über die Wirklichkeit oder logische Zusammenhänge. Ich meine z. B. den Inhalt von Büchern (Lexika, Belletristik, ...), das Wissen eines Menschen (übers Weltall, Ladenöffnungszeiten, Hausbau, ...), Jahresringe von Bäumen, Anzahl der Planeten, reflexhafte Bewegungen, Information kann man kopieren und sehr unterschiedlich speichern (siehe allein die analoge und digitale Speicherung von Musik auf Platten oder CDs).
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.04.2022 um 04.07 Uhr |
|
Mit "technisch" hatte ich gemeint: als Fachausdruck (terminus technicus), also im Sinn der Informationstheorie, vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#47270 Ich hätte mich deutlicher ausdrücken sollen. Der informationstheoretische Begriff hat fast gar nichts mit dem alltagssprachlichen (= Nachricht, Botschaft) zu tun. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 25.04.2022 um 18.40 Uhr |
|
Meiner Meinung nach gibt es nur eine Art von Information. Technisch könnte höchstens die Art der Speicherung und Nutzbarmachung sein. Als Idee würde ich das Ergebnis der bewußten Informationsverarbeitung (mal ganz technisch ausgedrückt) im menschlichen Gehirn bezeichnen. Ich denke, eine Idee läßt sich immer als Aussage, als Satz formulieren, sofern man der Sprache mächtig ist. Manche Information wird nur unbewußt, reflexhaft benutzt, z. B. für motorische Fähigkeiten, Geschicklichkeit, oder, wie ich annehme, alle Bewegungen von Insekten.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.04.2022 um 16.52 Uhr |
|
Warum nennen Sie die Information (hier anscheinend im technischen Sinn verstanden) zugleich "Idee"? Das hatte mich schon früher verwirrt.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 25.04.2022 um 13.52 Uhr |
|
Ich teile die Standpunkte dieser Wissenschaftler, soweit ich sie kenne, nicht ohne weiteres und fühle mich auch hier von Ihnen noch mißverstanden. Warum habe ich "natürlich" geschrieben? Ein Beispiel: Wir werfen 100 übliche Spielwürfel zufällig auf den Tisch. Nun drehen wir die 50, die am weitesten links liegen, so, daß die Zahl 6 oben liegt. Die 50 rechten Würfel werden nicht weiter angerührt. Gibt es nun einen Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Würfelhaufen? Rein quantitativ sind beide Haufen gleich. Aber es gibt doch einen qualitativen Unterschied. Der eine Haufen ist geordnet. Aufgrund dieser Ordnung enthält er eine bestimmte Information, die der andere nicht hat. Und nun frage ich, ist es etwa nicht ganz offenbar, "natürlich", daß diese Information dort ablesbar auf dem Tisch liegt, daß sie objektiv real existiert? Oder ist die Sortierung der Würfel nur subjektiv, nur eine Einbildung, Täuschung? Die Information existiert zwar nicht körperlich real (quantitativ) wie die Würfel, aber sie "besteht" ( Meinong, https://ozekik.github.io/meinong/1904/) als reale Form (qualitativ real). Sie ist da, es gibt sie, wir sehen sie, oder etwa nicht? Diese reale, qualitative Existenz einer Information, einer Idee, würde ich nicht "Pseudo-Existenz" (Meinong) nennen, sondern sie ist eine ganz andere Art von Existenz, die aber im Grunde die gleiche Berechtigung hat wie die rein stoffliche (quantitative) Existenz. Qualität setzt allerdings Quantität voraus, insofern ist Information (Bedeutung, Ideen) an eine körperliche Existenz gebunden. Die Information, die in einem Körper steckt, betrifft nicht unbedingt diesen Körper, insofern finde ich Meinongs Rede von Objekten und Objektiven sehr irreführend. (Nur der Vollständigkeit halber und zur Abgrenzung möchte ich neben diesen beiden Arten der realen Existenz noch einmal die rein logische "Existenz", z. B. von Universalien und mathematischen Objekten erwähnen: Existenz bedeutet hier nur logische Widerspruchsfreiheit in einem System.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.04.2022 um 04.05 Uhr |
|
Sie bekennen sich also zum Standpunkt Brentanos, Meinongs usw. Ich sage absichtlich "bekennen", und sogar die typische appellierende Bekräftigungsformel (natürlich) bringen Sie in ihrer Darstellung unter. Entsprechende Zitate mit sicher, absolut sicher, kein Zweifel, unbezweifelbar, einfach, schlicht, unmittelbar gegeben usw. habe ich schon an verschiedenen Stellen vorgeführt. Damit befinden Sie sich also in höchst achtbarer Gesellschaft, auch wenn ich Ihnen nicht folgen kann. Meine Frage ist: Wie kommt man dazu, dies für evident zu halten – und jeden, der es nicht akzeptiert, für ein bißchen verrückt? (Es wäre absurd... ist die Formel für die Gegenposition.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 25.04.2022 um 00.08 Uhr |
|
Der scheinbare Widerspruch ("Auch was es nicht gibt, muß irgendwie existieren") wird m. E. nicht durch ein falsche Zeichentheorie erzeugt, sondern basiert einfach wieder einmal auf unterschiedlichen Existenzbegriffen. Es ist doch zweierlei, ob von der Existenz eines Gegenstandes oder von der Existenz einer Idee von diesem Gegenstand die Rede ist. Natürlich existiert auch das, was es nicht gibt, "irgendwie", nämlich als Idee/Information. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 24.04.2022 um 15.11 Uhr |
|
Bei Tieren von Ideen zu sprechen ist wohl unüblich, aber ist eine Idee nicht im weitesten Sinne eine Information? Der Unterschied zur menschlichen Kommunikation liegt m. E. nur in der Komplexität und der Bewußtheit, nicht im Wesentlichen. Da Information zwangsläufig an Materie gebunden (gespeichert) sein muß, kommt ihr, anders als mathematisch-logischen Objekten, eine reale Existenz zu. Daher sollte sie auch prinzipiell wissenschaftlichen Untersuchungen zugänglich sein. Die Schwierigkeiten dabei sind praktischer Art und hängen mit der großen Komplexität des Gehirns zusammen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.04.2022 um 06.06 Uhr |
|
Wenn die Bedeutung eines Zeichens darin besteht, worauf es sich bezieht, und wenn die Zeichenhaftigkeit darauf beruht, daß es sich auf etwas bezieht, und wenn dieses Sichbeziehen eine reale Verbindung zwischen dem Zeichen und dem Etwas (= ein Bestandssystem aus Zeichen und Bezeichnetem) ist, dann ist mit der Zeichenhaftigkeit eine Existenzpräsupposition verbunden. Das Bezeichnete muß irgendwie existieren. Parmenides zog daraus den Schluß, daß es nicht möglich ist, Nichtsein auszusagen (in beiderlei Bedeutung: Nichtexistenz und Nichtsosein/Anderssein). Meinong folgerte aus denselben Annahmen umgekehrt: Auch was es nicht gibt, muß irgendwie existieren. (Das ist aber schon bei seinem Lehrer Brentano ebenso, der nach scholastischem Muster die intentionale Inexistenz – als „Enthaltensein“ – postulierte.) Grundlage ist stets eine falsche Zeichentheorie. Vor zweieinhalbtausend Jahren verständlich, heute nicht mehr. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.04.2022 um 04.39 Uhr |
|
Sie kommen immer wieder auf die "Idee" zurück. In einer Verhaltensanalyse kommt so etwas nicht vor – es gehört zu einer Begrifflichkeit, die ich – offenbar erfolglos – als nicht wissenschaftsfähig kritisiere. Ich kann nicht wieder ganz von vorn anfangen, aber als Seitenargument möchte ich die Frage stellen, was aus diesem Bedeutungsbegriff bei Tieren wird, die ja auch kommunizieren und Zeichen verwenden. Muß der Bienenforscher mit "Ideen" seiner Bienen rechnen, die sie in Schwänzeln übersetzen? |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 23.04.2022 um 22.44 Uhr |
|
Sie sehen die Bedeutung eines Zeichens nicht als dessen eine Seite, sondern als dessen Funktion. Aber letztlich muß die Bedeutung definiert werden. Ob nun in einer langen Konditionierungsgeschichte oder kurz und schmerzlos durch eine einmalige einfache Zuordnung der Zeichenform zu einer Idee (Bedeutung), ist das nicht egal bzw. dasselbe? Das Zeichen hat dann eben diese Bedeutung[sseite] oder diese Funktion. Sicher kann man beide Seiten oder auch die Funktion (wie man es immer nimmt) beobachten. Ich wüßte auch nicht, wie man die Bedeutung vollständig aus der Zeichenform folgern könnte. Selbst Ikone haben noch eine gewisse Interpretation nötig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.04.2022 um 06.25 Uhr |
|
Die Hypostasierung und Mystifizierung der „Bedeutung“ führt zu solchen Aussagen: „Meaning is not something that can be observed and copied. It can only be inferred.“ (Dan Sperber: An objection ...In Robert Aunger, Hg.: Darwinizing Culture: The Status of Memetics as a Science. Oxford 2001:171) Das ist das genaue Gegenteil meiner Ansicht. Die Funktion von Zeichen ist ebenso beobachtbar wie die Funktion der Zähne und des Magens. Bei der Sprache ist es komplizierter wegen der Geschichtlichkeit und Gesellschaftlichkeit, aber nicht grundsätzlich anders. Zeichenhaftigkeit ist, wie andere Formen der Anpassung, eine objektive Tatsache. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.03.2022 um 04.40 Uhr |
|
„Rein subjektiv weiß jeder, was damit gemeint ist, wenn man sagt, man habe Aspekte der Welt in sich repräsentiert: Ich kann die Augen schließen und mir Johannisbeeren und Grizzlybären vorstellen. Diese Vorstellungen enthalten bestimmte Informationen über den Sachverhalt, die ich erst abrufen kann, sofern ich die Vorstellung mir tatsächlich vor mein geistiges Auge geführt habe. Wir wissen somit intuitiv, was eine Vorstellung ist, eine innere Repräsentation von etwas draußen in der Welt in unserem Geist.“ (Manfred Spitzer: Lernen. Heidelberg 2002:80) „Sich etwas vorstellen“ – diese Ausdrucksweise kennt freilich jeder, aber nicht: „Aspekte der Welt in sich repräsentieren“. Und wenn es das gleiche ist: wozu braucht man dann den gelehrten Begriff „Repräsentation“? Wozu muß das „Historische Wörterbuch der Philosophie“ 60 kaum verständliche Spalten damit füllen (während sein Vorgänger, Eislers Wörterbuch, nur wenige Zeilen hatte)? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.03.2022 um 19.39 Uhr |
|
Es folgt die übliche Mystifikation: „Solange wir die Significantia Hippie, Ergänzungsabgabe und Theta-Rolle nicht hatten, hatten wir auch die zugehörigen Significata nicht.1 Bedeutungen sind nicht außerhalb von Sprache vorgegeben, sondern werden in der Sprachtätigkeit erst geschaffen (Morris 1938: 19f.). Die Bedeutung eines Sprachzeichens, sein Significatum, ist also etwas rein Sprachliches. Der reale Gegenstand, auf den ein Zeichen sich beziehen kann, sein Denotatum, ist dagegen etwas Außersprachliches.“ Natürlich hatten wir die Hippies auch schon vorher, wenn auch natürlich nicht als „Significata“, weil dieser Begriff relational ist. Wo keine Zeichen sind, existiert auch nicht deren Bedeutung. Oder wenn wir die Substantivierung rückgängig machen: Wenn nichts da ist, kann es auch nichts bedeuten. Das sind keine semiotischen Einsichten, sondern Kalauer. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.03.2022 um 19.22 Uhr |
|
Daß auch der "Sender" etwas als Zeichen versteht, fügt nichts Wesentliches hinzu. Die Deutung ist eben nicht dasselbe wie die Semantisierung, also die Entstehung des Zeichens unter der Wirkung seiner Wirkung. (Ich habe es anderswo ausführlicher besprochen, hauptsächlich hier im gleichen Strang.)
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 03.03.2022 um 18.21 Uhr |
|
Ich verstehe diesen Text eigentlich nicht so, daß beliebige Gegenstände interpretiert werden können und damit Zeichen sind. Es heißt ja auch, daß es um ein Zusammenwirken von Sender und Empfänger geht.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.03.2022 um 16.59 Uhr |
|
Zum besseren Verständnis, was wirkliche Zeichen sind, hier noch einmal die Irrlehre, daß beliebige Gegenstände durch ihre Interpretation zu Zeichen werden: „Nichtsemiotische Objekte wie Steine oder Nervenzellen existieren und sind Steine oder Nervenzellen ohne Rücksicht darauf, ob jemand sie wahrnimmt und begrifflich als solche erfaßt. Nichts dagegen ist ein Zeichen, wenn es niemanden gibt, der es als solches auffaßt. Ein auf dem Weg liegender abgebrochener Zweig zum Beispiel kann ein Zeichen auf einer Schnitzeljagd sein, es kann aber auch bloß ein abgebrochener Zweig sein. Ein Zeichen bedarf also zu seiner Konstitution eines Organismus, der es als Zeichen verwendet, also eines Interpreten (Morris 1938:19). Der Ausdruck Interpret ist hier in einem weiten Sinne gemeint, der nicht nur den Empfänger, sondern auch den Sender des Zeichens umfaßt.“ (https://www.christianlehmann.eu/ling/ling_theo/sprachzeichen.php) Nicht die Deutung, sondern die Entstehung (Geschichte) macht das wirkliche Zeichen aus. Eine nichtentzifferte Schrift ist ein Zeichen (deshalb versucht man sie zu deuten), eine vom Astrologen interpretierte Planetenkonstellation ist kein Zeichen, sondern ein Muster, das irrigerweise als Zeichen gedeutet wurde. Davon unabhängig gilt, daß die Geschichte eines Zeichens mit der empfangsseitigen Semantisierung beginnt, verstanden als Reaktion des „Senders“ auf die Reaktion des „Empfängers“. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.03.2022 um 06.49 Uhr |
|
Nach Johannes Engelkamp, einem Schüler Hans Hörmanns, wird das Wissen in Konzepten und Propositionen gespeichert. Er notiert es so: GRÜN (PATIENT: WIESE) LAUFEN (AGENT: KIND) „Es ist zu beachten, daß es sich hier um Darstellungen kognitiver und nicht um Darstellungen sprachlicher Sachverhalte handelt. Dies soll auch durch die Schreibweise in Großbuchstaben angedeutet werden.“ (Artikel „Sprache in: Handbuch psychologischer Grundbegriffe. Hg. von Theo Herrmann u.a. München 1977:466) Wie kann man etwas schreiben – in welchen Buchstaben auch immer –, wenn es nicht sprachlich ist? Kurz darauf spricht er von einem „subjektiven Lexikon“, in dem das Wissen gespeichert sei. In einem späteren Werk schreibt Engelkamp: „Sprache spiegelt das begriffliche Wissen.“ (Das menschliche Gedächtnis. Göttingen u.a. 1990:18) Die „Propositionen“ als Einheiten des konzeptuellen Systems bestehen aus Prädikatkonzepten und Argumentkonzepten und können versprachlicht werden. Die Argumentkonzepte sollen wiederum als Thema oder als Spezifikatoren des Prädikats dienen können, ganz wie Nominalphrasen in der Sprache. Die Versprachlichung geht aber noch weiter, wenn Engelkamp von „nominalen Konzepten“ (66) spricht, also dem scheinbar Vorsprachlichen sogar Wortarten zuordnet. (Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1642#38013) Der Widerspruch wird nicht bemerkt, daher auch nicht aufgelöst. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.02.2022 um 06.25 Uhr |
|
Diskettensymbol auf Computern, die überhaupt kein Laufwerk mehr haben. Dampflokomotiven auf einigen Verkehrszeichen (Bahnübergang). Die moderne E-Lok ist weniger charakteristisch, hauptsächlich am Stromabnehmer für die Oberleitung zu erkennen. Kinder machen noch puffpuff, wenn sie eine „Lokomotive“ hinter sich herziehen, auch wenn sie im wirklichen Leben noch nie eine Dampflok gesehen haben. Das Zeichen für Gehweg zeigt meist eine Frau mit einem Kind, es gibt aber auch einen Mann mit Hut (wer trägt noch Hut?), der ein kleines Mädchen abführt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.02.2022 um 05.25 Uhr |
|
In Schweden und Finnland, wo die ersten Endlager für Atommüll gebaut werden, macht man sich Gedanken über eine „Atom-Semiotik“, ganz ähnlich wie bei jener Plakette, die vor 50 Jahren ins Weltall geschossen wurde, vgl.http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#28582. Die Schweden wollen die Brennstäbe für 100.000 Jahre sicher verwahren, die Deutschen für eine Million. Ein Artikel der FAS lobt die gesellschaftliche Einigkeit der Skandinavier und ihr Vertrauen in die staatlichen Stellen. Es ist ein Konsens zu Lasten Dritter, mit denen im Grunde niemand rechnet und denen der Konsens der Heutigen egal sein wird. Der Kern ist: Hauptsache, WIR sind das Zeug los. Für Deutschland werden die Kosten der Endlagerung auf 169 Mrd. Euro geschätzt (FAS 5.2.22), aber es kann natürlich auch ein Vielfaches werden, die Zahl ist offensichtlich nicht seriös anzugeben, die Genauigkeit (nicht 170, sondern 169) Augenwischerei. Die bisherigen Kosten für Zwischenlagerung und Endlagersuche kommen hinzu. Der unvermeidliche Abriß der alten AKWs wird ebenfalls Hunderte von Milliarden kosten und uns Jahrzehnte beschäftigen. Gesamtfolgekosten von einer Billion sind nicht abwegig. Das müßte auf den „billigen“ Atomstrom aufgeschlagen werden, zusätzlich zur staatlich subventionierten Vorarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Wie die Verantwortlichen sehr wohl wissen und auch sagen, erschwert die EU mit ihrer Definition der Atomkraft als nachhaltig die ganze Diskussion. Bisher mußten auch die Kritiker zugeben, daß der Atommüll nun einmal da ist und irgendwie entsorgt werden muß, weil der historische Fehler nicht ungeschehen gemacht werden kann. Aber nun ist die Perspektive eine andere: Es war gar kein Fehler, wir können weitermachen und zum vorhandenen Müll immer noch mehr hinzufügen. Der EU-Beschluß war ein Pyrrhus-Sieg der Atomlobby. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.01.2022 um 05.36 Uhr |
|
All languages have the same purpose – to communicate thoughts... (Bill Bryson: Mother Tongue. London 2009:26) Was Bryson ausdrückt, ist tief in die Allgemeinsprache (deren „Geschäftsordnung“, wie ich es nenne) eingebaut und innerhalb dieser nicht widerlegbar, ohne daß man seine Sprachkompetenz verleugnet. Schon die Annahme von „Gedanken“ als gegeben schließt deren Übertragbarkeit und alles weitere ein. Niemand kann sagen, was da eigentlich vor sich geht: communicate? Es ist wie das Zeigen eines Bildes: erst sehe nur ich es, dann sehen wir beide es. Wenn jemand jemanden zu etwas auffordert oder ihn lobt oder sich bei ihm bedankt – welchen Gedanken teilt er ihm dann mit? Man muß sich schon viel Mühe geben, das Geschehen auf diese Begriffe zu bringen, und klarer wird dadurch nichts. „Gedanken übertragen“ klingt akademisch, und das ist das Milieu, in dem solche Thesen entstehen und hingenommen werden: Vorlesungen, Seminare, Lehrbücher. Man denkt nur an das "Informieren". Die Kritik kann schlecht behaupten, daß Sprache keine Gedanken überträgt (mitteilt usw.), sondern müßte sprachkritisch ansetzen: die These hat keinen Sinn, gerade weil sie unbestreitbar ist. In naturalistischer Begrifflichkeit gibt es weder das Konstrukt des „Gedankens“ noch das einer Mitteilung. Kommunikation gibt es in großem Umfang auch zwischen Tieren – welche Gedanken teilen sie einander mit? Und wenn man davon nicht sprechen kann, warum beim Menschen? Man braucht solche Begriffe nicht, um zu erklären, wie Zeichen funktionieren. |
Kommentar von Theodor Ickler , verfaßt am 25.01.2022 um 17.32 Uhr |
|
Zu einem alten Thema: Das Schrittmacherphänomen, also der fliegende Start, spielt beim Sprechen eine große Rolle. Auf Merkverse mit dieser Technik habe ich schon hingewiesen. Wenn wir uns an einen Personennamen erinnern wollen, löst der Vorname den Nachnamen aus, aber auch umgekehrt. Vgl. meinen Aufsatz: „Paradigmen als Syntagmen“. Wenn man gerade eine nicht besonders kreative Phase hat, sollte man in seinen eigenen Aufzeichnungen stöbern. Die schon formulierten Gedanken lösen Fortsetzungen aus, und dann fließt es wieder; man ist zu weiteren Aufzeichnungen bereit. Das Schreiben verhält sich ja zum Lesen wie das laute zum stummen Sprechen. Darum sollte man immer aufschreiben, was einem einfällt, und sich nicht darauf verlassen, daß es im Kopf ist und gegebenenfalls zur Verfügung stehen wird. Das Aufgeschriebene selbst mag nicht besonders genial erscheinen – das ist auch gar nicht der Sinn des Aufschreibens. Viele verkennen das zu ihrem nichtwiedergutzumachenden Schaden. Manche Romane usw. sind aus solchen Tagebüchern entstanden, aber eben nicht nur weil sie als Steinbrüche oder „Stoffsammlung“ dienten. Erst durch das Aussprechen bzw. Niederschreiben eines Gedankens kann man sicher sein, um was für einen Gedanken es sich handelt. Die lineare Ordnung der Zeichen und ihre volle Explizitheit erzwingt die Klarheit darüber: „En composant, on ne sait bien ce qu’on voulait dire que lorsqu’on l’a dit. Le mot en effet est ce qui achève l’idée et lui donne l’existence. C’est par lui qu’elle vient au jour.“ (Joubert: Pensées 101, hier schon zitiert) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.01.2022 um 04.04 Uhr |
|
„An entity is a natural sign if, by its very nature, it represents some other entity or would-be entity, that is, if it is an intrinsically intentional entity.“ (Laird Addis: Natural signs. Philadelphia 1989:29) Repräsentieren gibt es nicht einfach so, sondern immer für jemanden. Und Intentionalität, definiert als Repräsentieren von etwas anderem, ist logischerweise keine intrinsische Eigenschaft. Ich halte die These also für sinnlos. Es ist das gleiche, als wenn man die Dinge in bekannte und unbekannte ordnet und das für innere Merkmale (intrinsisch, by its very nature) hält. So naiv kann man doch gar nicht sein! |
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 22.01.2022 um 07.17 Uhr |
|
Deshalb bestehen lebendige Dialoge nicht aus aufeinanderfolgenden "Zügen". "Helga, wo ist die Hundeleine?" "Es schüttet draußen!" |
Kommentar von , verfaßt am 22.01.2022 um 05.19 Uhr |
|
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.01.2022 um 07.31 Uhr |
|
Der edle Wilde beweist bei Lévi-Strauss seine edle Natur nicht durch die Moral, sondern durch die Rationalität der „Strukturen“ seines Geistes, die sich auch aus den „barbarischen“ Verhaltensweisen herauslesen lassen: What his theories demand from the members of primitive cultures is evidence not so much of good morality as of good mathematics. (Richard Webster) Die schönste Blüte ist die pseudomathematische Formel für sämtliche Mythen der Welt: Fx (a) : Fy (b) : : Fx (b) : Fa-1 (y) Damit sind die Wilden gewissermaßen rehabilitiert. Das Problem ist nur, daß man solche strukturalistischen Raster aus binären Oppositionen über alles und jedes legen kann, was die Lehre vollkommen wertlos macht. Die Frage kann nur sein: Was hat den Strukturalismus so anziehend gemacht? (Und die Psychoanalyse, die andere große Mode des 20. Jahrhunderts.) Richard Webster versucht eine Erklärung (auch zu Freud), ebenso Simon Clarke. Sonderbar ist auch, daß in beiden Fällen neben der esoterischen Verästelung der Theorie in nahezu unlesbaren Werken die enorme Leichtigkeit der Popularisierung steht. Sogar der Feinschmecker Dollase bedient sich zwanglos bei Lévi-Strauss, und was die Psychoanalyse betrifft, so war sie von Anfang an bei Literaten sehr beliebt, und dann leistete sich jede Amerikanerin der Mittelklasse „ihren Therapeuten“, der einfach zum Leben gehört wie der Beauty parlor. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.01.2022 um 05.30 Uhr |
|
Wie Lösener zeigt, geht der enorme Einfluß Saussures von einem gewaltigen Mißverständnis aus, veranlaßt durch die Bearbeitung seiner Vorlesung durch die Schüler. Der echte Saussure, in vielem das Gegenteil des vermeintlichen, bleibe noch zu entdecken. (Hans Lösener: „Saussure und die Geschichtlichkeit der Sprache“. Kodikas/Code 23., 2000:97-108) (Man könnte das mit dem Fall Skinner vergleichen, wo die flächendeckende Verdammung einem vermeintlichen Skinner gilt und der wirkliche noch zu entdecken bleibt.) Ob die feinsinnigste Saussure-Exegese aber etwas Wertvolles zutage fördert, bleibt abzuwarten. Einstweilen steht wohl fest, daß die Studenten der Sprachwissenschaft aus Pauls „Prinzipen“ mehr lernen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.01.2022 um 06.09 Uhr |
|
Das gedankenlose Nachsprechen von Saussures Mystifikationen führt zu sonderbaren Aussagen. Nach Christa Dürscheid weisen Phoneme nur eine Ausdrucksseite auf (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#31932). Zu den Lauten, die nach Eibl-Eibesfeldt ein schlafender Säugling von sich gibt, sagt Hans Werner Eroms: Die Ausdrucksseite, das Signifikans, ist der Geräuschlaut, seine Inhaltsseite, sein Signifikat, trägt die Bedeutung "alles in Ordnung". (Syntax der deutschen Sprache. Berlin, New York: de Gruyter 2000:2) Was soll die Inhaltsseite sein, wenn sie ihrerseits wieder eine „Bedeutung trägt“? An nachlässige Formulierung mag man nicht glauben, weil ja gerade die Termini hier so umständlich eingeführt werden. Das erbt sich wie eine ewige Krankheit fort. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.11.2021 um 04.27 Uhr |
|
"Nicht existiert" sage ich ja nicht. Konstrukte existieren weder, noch existieren sie nicht. Es gibt sie nur nicht in der gleichen Weise wie die "Phänomene", die sie erklären sollen. Darum können sie mit diesen nicht interagieren, sie nicht hervorbringen oder von ihnen hervorgebracht werden usw. Das ist keine Tatsachenfrage, sondern eine Frage der begrifflichen Klärung, also eine "philosophische".
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 03.11.2021 um 00.51 Uhr |
|
Wenn das Psychische nicht existiert, ist Verhalten natürlich sowieso immer nur physisch. Wenn man aber von der Existenz des Bewußtseins, eines Psychischen ausgeht, das sich zwar von außen nicht direkt beobachten läßt, aber doch indirekt durch sein Wirken, dann scheint mir ein psychisches Verhalten, das physisch sichtbar wird, kein Widerspruch zu sein. Sprache ist natürlich ein Verhalten, fragt sich nur, was man genau darunter versteht. Warum also nicht "psychophysisch"? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.11.2021 um 15.48 Uhr |
|
Ich wünschte, es wäre ein Gemeinplatz, daß Sprache ein Verhalten ist – und nicht "ganz und gar psychisch" (Saussure). Der Nestbau der Vögel ist "zunächst ein psychisches Phänmen" – wie hört sich das an? Verhalten ist wirklich und kann beobachtet werden. Das Psychische ist eine Hilfskonstruktion (eine nützliche Fiktion), die manche Psychologen brauchen, andere nicht. Sprache kann man hören, das Psychische nicht. Aber daß Sprache "zunächst" ein Verhalten ist, sollte doch wohl klar sein. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 02.11.2021 um 11.37 Uhr |
|
Phänomen und Gebilde sind ja ausgesprochen leere, nichtssagende Vokabeln. Nur die zugesellten Adjektive haben überhaupt einen Sinn. Besser wären also vielleicht "psychisches Verhalten" oder "psychophysisches Verhalten". Andererseits, wie sollte sich der Mensch sonst verhalten? Ist nicht jedes Verhalten psychisch oder physisch oder "psychophysisch"? Spricht man hingegen nur von Verhalten, so leuchtet das zunächst ein, andererseits, was auch immer der Mensch tut, er kann ja gar nicht anders, als sich irgendwie zu verhalten. Vielleicht ist also auch dieser Begriff manchen Autoren einfach zu allgemein, zu trivial, als daß sie darauf kämen. Sprache ist Verhalten, ist das nicht im Grunde fast ebenso ein Gemeinplatz, den man erst ausfüllen muß? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.11.2021 um 04.14 Uhr |
|
Die fast unbegreifliche Verirrung, die Sprache für ein "psychisches Phänomen" zu erklären (s. oben zu Heidrun Pelz, im Anschluß an Saussure), findet sich schon in Friedrich Kirchners „Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe“ von 1907: „Die Sprache ist zunächst ein psychophysisches Gebilde.“ (http://www.textlog.de/2083.html) „Zunächst“ ist sie doch wohl ein Verhalten, sollte man meinen. Wo haben die Leute ihre Ohren und Augen? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.10.2021 um 04.15 Uhr |
|
Gegen die (oft unerkannte) metaphorische Verwendung von Begriffen wie "Information", "Code" usw. in der Biologie gibt es einen sehr guten Aufsatz: Michael J. Owren/Drew Rendall/Michael J. Ryan: „Redefining animal signaling: influence versus information in communication“. Biol. Philos. (2010) 25:755–780 (Auch im Netz) Obwohl die Verfasser nicht den genetisch-historischen Zeichenbegriff verwenden, finde ich das allermeiste trefflich ausgedrückt. (Zu Dawkins wollte ich nachtragen, daß er natürlich sehr gut weiß, was Information im technischen Sinn ist und sich nur bei der Veranschaulichung nicht gerade das beste Beispiel ausgesucht hat. – Und wenn ich schon bei Dawkins bin: In "Unweaving the rainbow" gibt er eine besonders klare Kritik an der "schlechten Poesie" der Gaia-Phantasie von Lovelock und Margulis, deren Verdienste um die Endosymbiontentheorie er im übrigen anerkennt. Gerade weil er auf dem "selfish gene" besteht, kann er diese Theorie ohne weiteres in seine Version des Darwinismus einbauen. Die wichtigste Umwelt, in der sich das Gen behaupten muß, sind die anderen Gene innerhalb desselben Organismus. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.10.2021 um 05.24 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#41324 Ausgerechnet Dawkins scheitert ebenfalls bei dem Versuch, den populären Begriff der "Information" vom wissenschaftlich-technischen zu unterscheiden: The technical definition of "information" was introduced by the American engineer Claude Shannon in 1948. An employee of the Bell Telephone Company, Shannon was concerned to measure information as an economic commodity. It is costly to send messages along a telephone line. Much of what passes in a message is not information: it is redundant. You could save money by recoding the message to remove the redundancy. Redundancy was a second technical term introduced by Shannon, as the inverse of information. Both definitions are mathematical, but we can convey Shannon´s intuitive meaning in words.Redundancy is any part of a message that is not informative, either because the recipient already knows it (is not surprised by it) or because it duplicates other parts of the message. In the sentence "Rover is a poodle dog", the word "dog" is redundant because "poodle" already tells us that Rover is a dog. An economical telegram would omit it, thereby increasing the informative proportion of the message. "Arr JFK Fri pm pis mt BA Cncrd fit" carries the same information as the much longer, but more redundant, "I´ll be arriving at John F Kennedy airport on Friday evening; please meet the British Airways Concorde flight". Obviously the brief, telegraphic message is cheaper to send (although the recipient may have to work harder to decipher it — redundancy has its virtues if we forget economics). Shannon wanted to find a mathematical way to capture the idea that any message could be broken into the information (which is worth paying for), the redundancy (which can, with economic advantage, be deleted from the message because, in effect, it can be reconstructed by the recipient) and the noise (which is just random rubbish). "It rained in Oxford every day this week" carries relatively little information, because the receiver is not surprised by it. On the other hand, "It rained in the Sahara desert every day this week" would be a message with high information content, well worth paying extra to send. (Dawkins Devil´s Chaplain 108f., auch hier: https://old.evolbiol.ru/devil/devil.html# - bitte die Fortsetzung lesen!) Zwei Einwände: 1. Die Wahrscheinlichkeit von Regen – oder von mehreren Tagen Regen nacheinander – in der Sahara läßt sich durch langjährige Beobachtung berechnen, aber die Überraschung eines Nachrichtenempfängers nicht. Der technische Begriff der „Überraschung“ ist nur eine populäre Fassung der mathematischen Wahrscheinlichkeit. 2. Arr JFK Fri pm pis mt BA Cncrd fit ist nicht nur um Redundanz bereinigt, sondern defizitär. Man muß erraten, welche Wörter gemeint sind; sie können nicht eindeutig aus einer Liste abgerufen werden. Die Voraussetzungen beim Lösen eines solchen Rätsels lassen sich aber nicht berechnen und gehen nicht in die Darstellung ein. Nicht vokalisierte Texte im Arabischen oder Hebräischen lassen sich lesen, auch wenn den Wortformen (qtl) keine eindeutige Lesart zugeordnet werden kann. Wir sagen, der Kontext liefere (meistens) die nötige Ausfüllung. In Wirklichkeit meinen wir die Sprachbeherrschung und Weltkenntnis des routinierten Sprechers. Die läßt sich aber nicht berechnen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.06.2021 um 12.47 Uhr |
|
Ich hatte schon zitiert: Die Sprache ist ein Zeichensystem, d. h. ein symbolisches System [...] Wie kann man glauben, das passable "Zeichen" durch das verschwommene "Symbol" zu erhellen? "Symbol" ist ein so vieldeutiges Wort und oft nur eine Brücke über die eigene Unwissenheit, daß man sich seinen Gebrauch ganz versagen (oder es den Theologen überlassen) sollte. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.06.2021 um 11.35 Uhr |
|
Daß man mit Sprache etwas bewirken kann, steht außer Frage. Mir ging es um die Stelle bei Platon, auf die sich auch Bühler beruft. Dort sind die Wörter Werkzeuge zur gegenseitigen Belehrung der Menschen, und dazu müssen sie an das Benannte angepaßt sein wie das Messer an das Schneidgut.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 02.06.2021 um 11.12 Uhr |
|
Meines Erachtens ist die Analogie "das insgesamt Benannte (das Werkstück)" nicht richtig. Nicht das Benannte, sondern das Benennende, also das Wort, ist das Werkstück! Analog zum Orchester steht nicht das Wort als Werkzeug, sondern die Sprache. Die ganze Sprache (Werkzeug) formt in diesem Sinne auch einzelne Wörter (Werkstücke). Aber das Wort hat, wie Prof. Ickler schon schreibt, keinen Einfluß auf das Benannte. Eher manchmal umgekehrt, z. B. lautmalerisch. |
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 02.06.2021 um 09.40 Uhr |
|
Daß ein Wort nicht auf das damit Benannte wirke, ist richtig, wenn es allein steht. Da es jedoch meist viele Wörter sind, die das jeweils von ihnen Benannte mit dem der anderen in Wechselwirkung bringen und so das insgesamt Benannte (das Werkstück) formen wie Instrumente (organa) eines Orchesters ein Musikstück, kann die Analogie doch nützlich sein.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.06.2021 um 05.27 Uhr |
|
Zur Werkzeugmetapher für Wörter: Man sollte beachten, daß Platon im schillernden "Kratylos" nur ganz beiläufig und für die aktuelle Diskussion (um nicht zu sagen: für die Übertölpelung seines Gesprächspartners) die Analogie des "Werkzeugs" benutzt. Sie endet schon da, wo ein Werkzeug auf das Werkstück einwirkt, während ein Wort keineswegs auf das damit Benannte wirkt. Die Analogie hat, anders gesagt, keinen theoretischen Wert, und es ist verfehlt, daraus ein "Organonmodell" der Sprache herzuleiten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.05.2021 um 05.58 Uhr |
|
Nach Ulric Neisser und vielen anderen wird die „Information“ im Hirn gespeichert. Information ist aber nichts Reales, sondern eine Interpretation. Die Buchstaben des Alphabets zum Beispiel enthalten Information, die man berechnen kann. Man kann die Buchstaben (oder Instruktionen zu ihrer Erzeugung in einer passenden angeschlossenen Hardware) speichern, man kann das Ergebnis der Berechnung ihres Informationsgehalts speichern, aber nicht die Information selbst, da sie relational ist (wie die Bedeutung eines Wortes, die man auch nicht speichern kann).
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.05.2021 um 04.41 Uhr |
|
Bedeutung ist ein relationaler Begriff. Es kann keine Bedeutungen geben, die nicht Bedeutungen von etwas sind. Das gleiche gilt für Inhalt und andere Synonyme. Es gibt unzählige Variationen einer Lehre, die das vergißt und daher unverständlich ist: „Was tut ein sprachfähiger mensch, der seine sprache benutzt? Er setzt bedeutungen zum zweck der kommunikation – mit anderen oder mit sich selbst – in laut oder schrift um.“ (Theo Vennemann: „Warum gibt es syntax?“. ZGL 1/1973:257-283; S. 257) Man kann es „semantische Strukturen“ nennen, aber auch Strukturen müssen Strukturen von etwas sein: „Jeder Hörer muß unbewußt eine komplexe syntaktische Analyse machen, um eine sprachliche Äußerung zu verstehen, d.h. er muß Lautketten zu Gruppen ordnen und diese mit semantischen Strukturen in Verbindung bringen.“ (Gaston van der Elst u. a.: Syntaktische Analyse. 5. Aufl. Erlangen 1994:9) „Die Verwendung von Sprache in der Kommunikation erfordert sowohl auf der Seite des Sprechers als auch auf der Seite des Hörers die Zuordnung einer Menge von Ausdrucksstrukturen zu einer Menge von Inhalts- oder Bedeutungsstrukturen.“ (Thomas Kotschi: Probleme der Beschreibung lexikalischer Strukturen. Tübingen 1974:1) Mit einer Sprachwissenschaft, die schon ihre Grundbegriffe so gedankenlos formuliert, kann ich nichts anfangen. Es ist ja auch nicht viel dabei herausgekommen. Zwar gibt es heute zu jedem Zeitpunkt mehr Linguisten als im ganzen 19. Jahrhundert, aber ihr sprachwissenschaftlicher Ertrag ist nur ein Bruchteil dessen, was man damals herausgefunden hat. Dafür gibt es jede Menge Beiträge über die „logische Struktur linguistischer Theorien“ (die aber größtenteils auch schon wieder verramscht und vergessen sind). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.05.2021 um 06.11 Uhr |
|
Gegen Metaphern ist nichts zu sagen, solange man sich ihrer bewußt ist und keine falschen Schlüsse daraus gezogen werden.
|
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 24.05.2021 um 18.18 Uhr |
|
Gerade stolpere ich über meine "Vorstellung von Sprache als einem grandiosen Werkzeugkasten“. Zu spät fürs Feintuning.
|
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 24.05.2021 um 11.13 Uhr |
|
Ich finde die Metapher vom Wort als Werkzeug zumindest insofern nützlich, als sie verdeutlichen kann, wie das Gendern plumpe Faustkeile produziert. Während des Kunststudiums hatte ich zwei Kommilitonen, die sich dem gesellschaftlichen Wandel verpflichtet fühlten und die altehrwürdige Presse der Lithographieklasse benutzten, um Flugblätter darauf herzustellen, simple Demonstrationsaufrufe, die meist mit der Aufforderung "kommt massenhaft" endeten. Das Arsenal künstlerischer Möglichkeiten, das die Hochschule bereithielt, verachteten sie als bürgerlich und überholt. Ich selbst war egoistisch genug, die lichten Räume zum Zeichnen und Malen, zum Modellieren und Bildhauern, die Holzwerkstatt voller Präzisionswerkzeuge und -maschinen, die Klassen für Keramik, Glas, Metall, Schrift gestalterisch zu nutzen und zu genießen, so gut ich konnte. Die Anwendung sprachlicher Techniken ist gewiß nichts anderes als Verhalten, aber widerspricht das der Vorstellung von Sprache als einem grandiosen Werkzeugkasten? Briefe, Gedichte, Bühnenstücke, Romane, Sketche – er macht alles möglich. Es ist doch ein Genuß, die verständlichste Formulierung eines Gedankens zu suchen, den klarsten Satz zu bauen, den unverkrampftesten Reim, den glaubwürdigsten Dialog, das fesselndste Bild, den treffendsten Gefühlsausdruck! Wer kann eine gerade niedergeschriebene Zeile ansehen, ohne zugleich über mögliche Verbesserungen nachzudenken, über Vereinfachungen, Kürzungen, Zuspitzungen, Feintuning? Grenzen setzt nur der Verstand. Deshalb sind künstliche Grenzen, wie sie die "geschlechtergerechte Sprache" zu ziehen sucht, so widerwärtig. Man muß schon sehr engstirnig sein, um ein Werkzeug wie das generische Maskulinum zu verbieten und an die Stelle des Amputats Prothesen zu setzen, die jedermann aufdringlich in den Schritt leuchten und jeden Text zum Flugblatt stempeln. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.05.2021 um 13.01 Uhr |
|
Platon hat bekanntlich das Wort als „Werkzeug“ (organon) bezeichnet, mit dem wir einander etwas über die Welt mitteilen; und Bühler hat noch bekanntlicher diese Definition zu seinem Organon-Modell ausgebaut. Man fragt sich, wie es zu einer so abwegigen Metapher kommen konnte. Sprache ist ja ein Verhalten und kein Ding, also auch kein Werkzeug und überhaupt kein Zeug. Im „bilateralen Modell“ sind die Zeichen auch schon vergegenständlicht, gleichsam sistiert, und auch das Bild vom „Wortschatz“ suggeriert ein Inventar von Gegenständen. All das ist nicht gerade förderlich.. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.05.2021 um 06.03 Uhr |
|
In einem Rückblick auf sein Forscherleben schrieb der 16- oder 17jährige Saussure an Pictet: „Ich war schon immer darauf versessen, Systeme zu bilden, noch bevor ich die Dinge im Detail untersucht hatte.“ Erstaunliche Selbsterkenntnis. However it is important to be very clear that Saussure’s linguistics is no more an achievement of science than is Lévi-Strauss’ anthropology. Saussure never managed to embody his philosophy of language in systematic analyses of particular linguistic systems, and so it remained programmatic. It is, moreover, an extremely confused programme in many respects, which is one reason why Saussure can be claimed as a forbear by very different schools of linguistics. (Simon Clarke: The foundations of structuralism. New Jersey 1981:124) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.05.2021 um 08.58 Uhr |
|
Zum vorigen: Wie das Sehen nicht verständlich wird ohne die "Handlungseinschlüsse" aufgrund früherer Erfahrung (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1541#37730), so könnte auch das Sprechen nur verständlich werden, wenn man seine Geschichte, also den "Spracherwerb", miteinbezieht. Zu wissenschaftlichen Zwecken kann man zwar ein "System" aus synchronisch aufeinander bezogenen Elementen konstruieren, aber es ist weit von der Realität entfernt, die man damit zu modellieren versucht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.04.2021 um 04.46 Uhr |
|
Für den Strukturalisten ist das sprachliche Zeichen ein Gegenstand mit zwei Seiten (mehr oder weniger metaphorisch verstanden), für uns Behavioristen ist es ein Verhaltensabschnitt mit einer Geschichte. Es ist klar, wer näher an der Wirklichkeit ist, ohne Metaphern auskommt, „anschlußfähiger“ ist. Die Illusion der Synchronie, also der geschichtsfreien Analyse der Sprache wird durch die Mystifikation der Bedeutung erkauft. Die Rede vom „Wunder des Bedeutens“ ist eine Kapitulationserklärung. Die Kunststücke eines Zirkustiers, die Darbietung eines Pianisten, die sprachlichen Äußerungen eines Dreijährigen sind wunderbar, aber keine Wunder. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.04.2021 um 06.03 Uhr |
|
Sprache soll ein Zeichensystem sein, da sind sich alle einig. Ohne den Systemgedanken scheint eine synchrone (geschichtsfreie) Sprachwissenschaft unmöglich. Nach Hermann Paul ist sie das auch. Einer der letzten, die Saussures Dogma angezweifelt haben, war der verstorbene Romanist Mario Wandruszka, ein einsamer Rufer. Man muß das Redeverhalten erst in wiederkehrende Abschnitte von hinreichender Ähnlichkeit zerlegen, diese zu einem Inventar zusammenstellen und dann Betrachtungen über Oppositionen, Symmetrien usw. innerhalb dieses Inventars anstellen, um zu einem „System“ zu kommen – lauter abstrahierende Tätigkeiten. Das resultierende Artefakt oder Modell, also das Zeichensystem, steht nur in sehr indirekter Beziehung zu den Ausgangsdaten. Man könnte in der gleichen Weise das Nüsseknacken beobachten und daraus ein System extrahieren. Zur „Speicherung“ ist es immer noch ein weiter Weg. Diese Überlegungen zeigen nicht, daß das Vorgehen falsch ist, man sollte sich nur gelegentlich erinnern, was man eigentlich tut, und sich den Blick auf die rohen Tatsachen nicht verstellen lassen. Verhaltensanalyse ist weniger in Gefahr, Gespenstern nachzujagen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.04.2021 um 04.37 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=134#21296 und http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584 Die direkte Rede (lateinisch oratio recta, oratio directa) ist ein grammatisches Element in einer Sprache, bei der eine Rede oder ein Gedanke direkt im Wortlaut wiedergegeben wird. (Wikipedia Direkte Rede; unter Indirekte Rede sind die Gedanken weggelassen, was für die Gedankenlosigkeit solcher Einträge spricht) Daß Gedanken einen „Wortlaut“ haben, scheint den Autoren keiner Erklärung bedürftig. Die Selbstverständlichkeit, mit der solche Thesen nicht einmal behauptet, sondern vorausgesetzt werden, läßt ahnen, gegen welche Vorurteile man ankämpfen muß, wenn man daran zweifelt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.04.2021 um 04.08 Uhr |
|
Niemand klammert die Form aus. Bedeutung ist etwas ganz anderes, sie wird naturalistisch als Geschichte rekonstruiert (Evolution und Lerngeschichte, teilweise auch als Kulturgeschichte).
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 09.04.2021 um 19.38 Uhr |
|
Oft wird der genannte philosophische Gegensatz einfach mit dem Begriffspaar Materie/Form bezeichnet. So spaltet man aber die Form als ideellen Teil von der Materie ab. Ich sehe Substanz und ihre Gestalt beides als untrennbare Komponenten der Materie, deshalb Inhalt/Form. Die Form und damit Information, Bedeutung usw. gehören in diesem Sinne für mich zur objektiven Realität. Eine naturalistische Betrachtung sollte sie m. E. nicht ausklammern. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 08.04.2021 um 20.29 Uhr |
|
Vielleicht habe ich das Wort Inhalt schon mehrdeutig verwendet. Hier im letzten Beitrag meinte ich mit dem Gegensatz von Inhalt und Form, daß der Inhalt das Stoffliche, Körperliche, die materielle Substanz ist, während die [äußere] Form (auch [An-]Ordnung, [innere] Struktur) Träger der Information bzw. der Bedeutung bis hin zum Wissen, Bewußtsein ist. Wenn man im Zusammenhang mit einem Zeichen (also einer Form) vom Inhalt spricht, meint man mit dem Inhalt eher die Bedeutung, also gerade das Entgegengesetzte, das ist leider etwas irreführend. Ich werde beim Zeichen künftig lieber von der Bedeutung statt vom Inhalt sprechen. Ich hoffe, meine Position wird damit klarer, wenn sie natürlich auch immer noch von Ihrer abweicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.04.2021 um 19.38 Uhr |
|
"Inhalt" ist doch bei Zeichen usw. nur eine Metapher. Das Portemonnaie hat einen Inhalt (meist zu wenig) und ein Dreieck hat auch gerade noch einen, aber Sätze und Gedanken haben keinen (sondern Geschichte). Wie schon oft gezeigt und kritisiert, haben bei den Mentalisten Zustände(!) einen Inhalt. Nee, danke!
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 08.04.2021 um 19.13 Uhr |
|
Ein Wort wie "Wissen" mag umgangssprachlich sein, aber ich versuche auch öfters, es als "Information" zu verallgemeinern. Stellen wir uns zwei Bausteine vor, einen winkligen, etwa wie ein v und einen geraden, wie ein – geformt. Diese beiden Steine können wir nun unterschiedlich im Raum anordnen, etwa so <– oder so –>. Im ersten Fall läßt die Anordnung sich deuten als Richtung nach links, im zweiten als Richtung nach rechts. Wir haben also ohne Veränderung des materiellen Inhalts, allein durch Änderung der äußeren Form bzw. Anordnung, zwei verschiedene Bedeutungen oder auch Informationen dargestellt. Nun frage ich mich, was ist an diesem Beispiel nicht zutiefst naturalistisch? Warum wollen Sie unbedingt den Teil "Bedeutung" bzw. "Information" aus der naturalistischen Betrachtungsweise (Zeichenbegriff) ausklammern? Für mich gehören Inhalt und Form beide ganz selbstverständlich zur materiellen Welt. Ich halte das für reinen Naturalismus. Beides, Materie (=Inhalt) und die geistige, mentale Ebene (=Form), existiert objektiv real. Dabei kann natürlich die äußere Form (lnformation, Bedeutung, Wissen, Bewußtsein) nicht unabhängig vom Inhalt sein, so wie auch Materie immer eine bestimmte Form hat. Sollte nicht naturalistische Anschauungen die Natur in ihrer Gesamtheit (mit Inhalt und Form) anerkennen? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.04.2021 um 08.45 Uhr |
|
Lieber Herr Riemer, Sie postulieren immer wieder genau das, was ich bestreite: Um über etwas reden zu können, muß man eine Vorstellung oder Idee davon haben, und als solche existiert es jeweils usw. – alles umgangssprachlich völlig einleuchtend, aber eben nicht naturalistisch rekonstruierbar. Ich weiß im Augenblick nicht, was ich dazu sagen soll, ohne mein ganzes "Projekt" (Naturalisierung der Intentionalität) von Anfang an zu wiederholen, also dies: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1587
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 07.04.2021 um 20.43 Uhr |
|
Man kann nicht z. B. über den Grüffelo (bekanntes Märchenwesen) sprechen, ohne zu wissen oder eine Idee davon zu haben, was er ist bzw. was darunter allgemein verstanden wird. Das bedeutet, eine Information darüber zu haben. Diese taucht nicht während des Sprechens plötzlich aus dem Nichts auf, sondern sie muß bereits da sein. Wo? Die Information bzw. das entsprechende Wissen kann nur im Gehirn enthalten sein. Das heißt, das Wissen über den Grüffelo existiert, und zwar ganz real. Das ist nicht dasselbe wie zu sagen, daß der Grüffelo existiert. Ich denke, genau dieser Unterschied ist im angegebenen Zitat gemeint – der Gegenstand muß nicht materiell existieren, aber zumindest als Idee ist er "kognitiv präsent". Die alten Griechen wie Parmenides und Platon haben offenbar nicht zwischen der stofflichen Existenz eines materiellen Körpers und der formgebundenen Existenz einer Idee bzw. Information unterschieden. Wer das aber korrekt tut, stößt mit dem bilateralen Zeichen m. E. nicht auf Widersprüche. (Diese beiden Arten von Existenz sind real, d.h. an Materie gebunden, spiegeln Inhalt und außere Form wider. Daneben gibt es noch eine irreale Art von "Existenz", die eigentlich logische Widerspruchsfreiheit meint, z. B. wenn ein Mathematiker sagt, es "existiert" eine gerade Primzahl.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.04.2021 um 04.17 Uhr |
|
Ich hatte schon zitiert (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1586): „Wenn wir über etwas reden oder schreiben wollen, muss uns der Gegenstand, über den wir sprechen oder schreiben wollen, kognitiv präsent sein. Es ist plausibel anzunehmen, dass zu jedem Zeitpunkt der unmittelbare Gegenstand der gegenwärtigen Sprachäußerung im Arbeitsgedächtnis ist.“ (Klaus Oberauer/Ina Hockl in: Enzyklopädie der Psychologie: Sprache 1 - Sprachproduktion. Hg. von Theo Herrmann und Joachim Grabowski. Göttingen u. a. 2003:365) Das ist immer noch Parmenides, Vater der sophistischen Hirnverdrehung, später Brentano, Meinong usw.: Alles, was wir nennen, sagen oder denken können, muß als Objekt dieses Aktes irgendwie existieren, wenn nicht greifbar in der Wirklichkeit, dann als Vorstellung o. ä. Aus der „intentionalen Inexistenz“ Brentanos (dem „Enthaltensein“, in- ist hier Präposition, nicht Negationspräfix) ist heute die „Repräsentation“ geworden, der Kernbegriff der Kognitivisten. Die zitierte Figur findet sich millionenfach in sehr ähnlichen Formulierungen oder als stillschweigende Voraussetzung. Parmenides zog allerdings die umgekehrte Folgerumg: Man kann nicht sagen oder denken, was nicht ist (existiert oder soundso ist – das unterschied er nach Art seiner Zeit noch nicht). Daher: Falsches sagen = sagen, was nicht ist; aber das Nichtseiende kann weder gesagt noch gedacht werden. Von zwei entgegengesetzten Aussagen kann nur eine wahr sein, die andere sagt, was „nicht ist“ – und das ist unmöglich. Daher „ouk estin antilegein“ („es ist nicht möglich zu widersprechen“). Platon hat sich sein Leben lang daran abgearbeitet. Alles eine Folge des bilateralen Zeichenbegriffs. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.04.2021 um 04.08 Uhr |
|
Die Gegenstandstheorie wird wie die anderen Intentionalitätslehren um einen philosophischen Kalauer herum gebaut. Um von etwas sprechen, etwas meinen oder denken zu können, muß man annehmen, daß es existiert. Ähnlich der schlichte Gottesbeweis: Man kann die Existenz Gottes nicht leugnen, denn um sie leugnen zu können, muß man sie schon voraussetzen. Kürzer: Nur wenn es Gott gibt, kann man ihn leugnen. Damit kann man ganz einfältige Menschen aufs Kreuz legen wie die sophistischen Ringkämpfer in Platons „Euthydemos“. Sprachverführt nimmt man an, leugnen sei etwas, was man mit einem Gegenstand tut (wie „mit Gewittern rechnen“). Zugrunde liegt ein falscher Zeichenbegriff. [Ich kann ihn suchen, wenn er nicht da ist, aber ihn nicht hängen, wenn er nicht da ist. Man könnte sagen wollen: „Da muß er doch auch dabei sein, wenn ich ihn suche“. – Dann muß er auch dabei sein, wenn ich ihn nicht finde, und auch, wenn es ihn gar nicht gibt. (Wittgenstein: PU 462) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 02.04.2021 um 11.15 Uhr |
|
Aber wo ist die Mystifikation? Der Specht trommelt (äußere, Formseite) und sendet damit ein Signal (inhaltliche Seite, Bedeutung). Der Hund wedelt (Form) und tut damit seine friedliche Einstellung kund (Bedeutung). Sind das nicht fast Ihre eigenen Worte? Die beiden Seiten sind ja immer da. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.04.2021 um 04.18 Uhr |
|
Zeichen sind bei Pflanzen und Tieren phylogenetisch entstanden, Tiere samt Menschen lernen zusätzlich welche, aber strukturell ist beides gleichartig (empfängerseitige Semantisierung, wie dargelegt). Kein Biologe bestreitet das. Was der Hund "will", spielt keine Rolle, er tut es eben. Bei der "freundlichen" Annäherung zweier Hunde sendet jeder Signale aus, zu denen das Schwanzwedeln gehört, ebenso die aufgestellten Ohren, man nimmt auch ein "Spielgesicht" an. Usw., das ist ja alles gut bekannt. Man kennt inzwischen Tausende von biologischen Zeichen. Das Signaltrommeln der Spechte, das ich jeden Morgen höre, ist zweifellos aus dem Meißeln bei der Nahrungssuche entwickelt, aber morphologisch stark verändert, also eine "Exaptation". Ich weiß nicht, was die Mystifikation mit den "Seiten" bringen soll. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 01.04.2021 um 22.04 Uhr |
|
Das sind sicher rhetorische Fragen, Sie kennen die üblichen Antworten im Rahmen der bilateralen Zeichentheorie, aber ich will gern mitspielen. Mit na und?, was gesprochen oder geschrieben das Zeichen an sich bzw. dessen eine Seite ist, meint man ja leicht abwertend, daß einem etwas zuvor Gesagtes gleichgültig oder zu geringwertig ist. Dies würde ich dann auch als Bedeutung bzw. als die andere Seite des Zeichens ansehen. Was das Hundeschwanzwedeln betrifft, muß ich ehrlich sagen, daß mir hier der Zeichencharakter nicht einleuchtet. Hunde wedeln wohl mit dem Schwanz, wenn es ihnen gut geht, wenn sie zufrieden sind, wenn sie sich "freuen", falls ich das mal so vermenschlicht sagen darf. Aber wollen sie uns das wirklich mitteilen? Oder besteht der Sinn des Wedelns ursprünglich darin, dieses Gefühl anderen Hunden mitzuteilen? Gibt es eine tierische, unbewußte Kommunikation überhaupt? Für mich sind Zeichen eigentlich vor allem Mittel der zwischenmenschlichen, bewußten Kommunikation. Nur dazu traue ich mir ein paar laienhafte Aussagen zu. Zeichen im Pflanzen- und Tierreich halte ich beinahe für ein anderes Thema. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.04.2021 um 18.11 Uhr |
|
Nehmen wir also eine geläufige Äußerung wie na und? – Welche beiden Seiten hat dieses Zeichen? Welche beiden Seiten hat das Schwanzwedeln des Hundes? (Ich habe absichtlich je ein kulturelles und ein phylogenetisch entstandenes Zeichen gewählt.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 01.04.2021 um 17.28 Uhr |
|
Was der Schützenfisch speichert oder eben in seinen Synapsen parat hält, ist natürlich keine Bedeutung, sondern eine Abfolge von reflexhaften Bewegungen.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 01.04.2021 um 17.19 Uhr |
|
Ja, vielleicht ist es nur ein Streit um Worte. Ich finde es auch egal, ob die Bedeutung gespeichert oder mit Druckerschwärze geformt oder als synaptische Durchlässigkeit haltbar gemacht wird. Aber wenn es nur die Wortwahl betrifft, dann ist es auch keine Widerlegung des bilateralen Zeichenbegriffs. Ein Zeichen hat eine äußere Form, an der man es erkennt und unterscheidet, und es hat einen Sinn, eine Bedeutung, die Zeichenempfänger und Zeichengeber meinetwegen vermittels ihrer entsprechend angepaßten Synapsen kennen und verwenden. Ich verstehe nicht, daß die Unmöglichkeit, Zeichen oder Bedeutungen im Gehirn alphabetisch zu ordnen, den bilateralen Zeichenbegriff infrage stellt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.04.2021 um 05.21 Uhr |
|
Von einer mehr oder weniger dauerhaften Veränderung des Organismus, d. h. einer Erhöhung oder Verminderung der Wahrscheinlichkeit bestimmter Reaktionen, bis zur „Speicherung“ ist es noch ein Stück Wegs. Es sei denn, man behandelt „Veränderung“ und „Speicherung“ als gleichbedeutend, dann wäre es nur ein Streit um Worte. Wie Sprache funktioniert, wird nicht klarer, wenn man die Speicherung von Bedeutungen annimmt. Was hat der Schützenfisch gespeichert, wenn er es mit einem halben Dutzend Nerven schafft, ein Insekt vom Schilf zu schießen, dabei die Lichtbrechung berücksichtigt und an die Absturzstelle eilt, bevor die Beute ins Wasser gefallen ist? Platon hat schon das Speichermodell und andere Gedächtnismodelle erörtert und sie alle verworfen. Wir haben heute andere Möglichkeiten, Verhaltensänderungen zu erklären; Speichermodelle brauchen wir dazu nicht. Verhaltensanalytisch: Konditionierung, physiologisch: synaptische Veränderung der Durchlässigkeit für elektro-chemische Impulse. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 31.03.2021 um 18.37 Uhr |
|
Das mit den Sausages ist natürlich absichtlich witzig formuliert. Davon abgesehen würde ich aber ganz klar sagen, Bedeutungen sind selbstverständlich Etwasse (was sonst?), die man verarbeiten und speichern kann, nicht auf ganz die gleiche Weise wie Würstchen, aber im Prinzip schon. Bedeutungen sind mehr oder weniger komplizierte Ideen, das ist doch "etwas". Manche davon sind ganz klar definiert und vollständig beschreibbar, andere sind mehrdeutig, nur unscharf abgrenzbar, dann kann man sich verbal auch nur annähern, und solche Beschreibungen können notwendigerweise auch nicht eindeutig sein. Natürlich kann ein Lexikon oder ein Gehirn dann nicht die komplette Bedeutung enthalten, aber es versucht eine für den praktischen Zweck ausreichende Annäherung. Wenn ich einen mir unbekannten Begriff im Lexikon nachschlage, bin ich normalerweise erst einmal zufrieden, ich kenne dann die Bedeutung. Und mit diesem "Kennen" habe ich die Bedeutung zumindest für einige Zeit auch in mir abgespeichert. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.03.2021 um 16.24 Uhr |
|
Das Speichermodell taugt eben nichts. Und Bedeutungen sind nicht Etwasse, die man speichern könnte. „Can meanings really be processed like sausages?“ (Gordon P. Baker/Peter M. S. Hacker: Language, Sense and Nonsense. Oxford 1984:277) Mit der Wendung "Bedeutungen, also ganze Texte" kann ich nichts anfangen. Texte haben wiederum Bedeutung und sind einfach "mehr vom gleichen", also auch wieder Wörter. "Bedeutung" ist ein relationaler Begriff, darum ist ja auch die beliebte Rede von der "Zuordnung" von Formen und Bedeutungen so schräg. – Man könnte Bedeutungen in anderer Sicht auch als Gebrauchsbedingungen auffassen (nicht behavioristisch, aber immerhin). Die sind aber nicht mit ihrer Beschreibung identisch. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 31.03.2021 um 15.51 Uhr |
|
Bedeutungen zu ordnen ist sowieso schwierig. Man muß nicht erst das Gehirn anführen. Es gibt z. B. auch Lexika. Sie sind auch immer nur nach dem Lemma geordnet. Es ergäbe keinen Sinn, die zugehörigen Bedeutungen, also ganze Texte, alphabetisch zu ordnen. Außerdem haben auch nicht alle Formen (Zeichen-"Vorderseiten") einen Anfangsbuchstaben, z. B. Verkehrszeichen, chinesische Schriftzeichen usw. Auch sie lassen sich nicht nur im Gehirn gar nicht alphabetisch ordnen. Die Art und Weise, wie das Gehirn Information speichert, ist m. E. zur Erklärung des Zeichenbegriffs nicht notwendig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.03.2021 um 08.09 Uhr |
|
Wenn es das zweispaltige Wörterbuch nicht gäbe (links das Lemma, rechts das Synonym oder die Übersetzung), wäre man nie auf den „bilateralen“ Zeichenbegriff gekommen. Verräterisch ist die Beteuerung, die „Bedeutungen“ seien „mental“ oder im Gehirn „nicht alphabetisch“ geordnet – womit also vorausgesetzt wird, daß sie Anfangsbuchstaben haben. Von hier geht es geradewegs zur Ansetzung einer Gedankensprache und überhaupt zur nachweisbaren Konzeption des Denkens als Sprechen (weshalb man Gedanken auch in direkter und indirekter Rede zitieren kann). Das alles ist sehr naiv, aber man muß sich heute noch damit beschäftigen, weil es von fast allen „Kognitionsforschern“ vetreten wird und in sämtlichen Lehrbüchern der Psychologie und der Linguistik steht.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.03.2021 um 08.50 Uhr |
|
ξυνὸν δέ μοί ἐστιν, ὁππόθεν ἄρξωμαι· τόθι γὰρ πάλιν ἵξομαι αὖθις. „Es ist egal, wo ich anfange, denn ich kehre immer wieder dahin zurück.“ Daß Parmenides (bzw. die ihn belehrende Göttin) sagt, er könne anfangen, wo er wolle, weil er immer zum Ausgangspunkt zurückkehre, ist treffend und paßt zur Kugelgestalt des Seienden. Er kann wirklich nur immer wieder sagen: Was ist, ist. Oder wie Hegel: Sein, reines Sein. Alles weitere ist mythologische Ausschmückung nach Art der Zeit. Wenn jemand eine Erleuchtung zu haben glaubte, stellte er es ganz feierlich in Hexametern als göttliche Berufung dar. Der gleiche Enthusiasmus noch beim gottlosen Lukrez. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.03.2021 um 05.33 Uhr |
|
Parmenides bestätigt im Grunde, daß es in der Natur keine Negation gibt. Was ist, ist – fertig. Jede Rede, die „ist nicht“ (ob existentiell oder essentiell) enthält, ist sinnlos, weil das, wovon sie zu reden scheint, nicht existiert – die Existenz ist aber die Voraussetzung sinnvollen Redens. Das bilaterale Zeichenmodell, so unklar es ist, ist eine Spielart des Eleatismus – oder umgekehrt: Parmenides und seine unzähligen Nachfolger kommen nicht vom bilateralen Zeichenmodell los. In der englischen Wikipedia findet man den bemerkenswerten Hinweis: Parmenides’ views have remained relevant in philosophy, even thousands of years after his death. Alexius Meinong, much like Parmenides, defended the view that even the "golden mountain" is real since it can be talked about. (Wikipedia Parmenides) So hat es Parmenides, was den goldenen Berg betrifft, wohl nicht gemeint, aber Meinong denkt tatsächlich eleatisch. Sein berühmtes Paradox ist vom selben Schlag wie die Paradoxa der griechischen Sophisten: Auch was es nicht gibt, muß irgendwie existieren, sonst könnte man ja nicht darüber reden (es "meinen"), wenn auch nur um zu sagen, daß es nicht existiert. Das sieht primitiv aus und ist es auch. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.12.2020 um 10.35 Uhr |
|
Unter den Synonymen für Zeichenhaftigkeit findet man meistens auch die „Repräsentation“. Letzteres ist der Grundbegriff der Kognitionswissenschaften, er wird aber so inflationär verwendet, daß er fast unbrauchbar geworden ist. (Zur Vielfalt der Gebrauchsweisen s. David Pitts Übersicht: http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/mental-representation/) Man vergleiche den bescheidenen Eintrag in Eislers Wörterbuch mit heutigen Einträgen, um zu sehen, wieviel der Begriff der „Repräsentation“ in sich aufgesogen hat. Im Englischen war representation schon immer stärker verbreitet; das hat auch die deutschsprachige Literatur beeinflußt. Peter M. Hejl erinnert mit Ernst von Glasersfeld daran, daß dem englischen represent „im Deutschen mindestens vier unterschiedliche Begriffe und Vorstellungen“ entsprechen: darstellen, vorstellen, vertreten und bedeuten (in: Siegfried J. Schmidt, Hg.: Gedächtnis. Frankfurt 1991:300). Hinzuzufügen wären mindestens noch abbilden, wissen und erkennen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.12.2020 um 04.35 Uhr |
|
Zur weiteren Abgrenzung des Zeichenbegriffs: Eine Reliquie (etwa einen Zahn Buddhas) würde man nicht Symbol nennen. Das Kreuz als Symbol der christlichen Lehre oder das Rad des Gesetzes (Dharmachakra) als Symbol der buddhistischen Lehre ist etwas ganz anderes als ein Splitter vom Kreuz Jesu oder ein Zahn Buddhas. Symbole (Sinnbilder) sind reproduzierbar und existieren in den genannten Fällen in Millionen Exemplaren, Reliquien sind einzig; sie stehen in (meist eingebildeter) Kontiguität mit dem "Herkunftsort" (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#43768). Man errichtet ihnen "Schreine" (Stupas usw.). Reliquien sind eine Unterart der Antiquitäten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.11.2020 um 17.26 Uhr |
|
Die Sprachverbesserer der Akademie von Lagado tragen die Dinge selbst mit sich herum. Sie sind stolz darauf, daß das Vorzeigen der Dinge statt des Aussprechens ihrer Namen eine Art Universalsprache ist, die man in der ganzen Welt versteht. Das Vorzeigen von Gegenständen kann Teil einer Kommunikation sein, ist aber selbst noch kein kommunikativer Akt, sondern eine Hantierung wie jedes andere „technische“ Verhalten. Der Handlungsreisende zeigt Gegenstände aus seinem Musterkoffer und weist ihnen eine Funktion innerhalb eines Verkaufsgesprächs zu (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#39372). Das Vorzeigen ist wahrscheinlich selbst nur sprachfähigen Wesen möglich. Man hat noch nie gesehen, daß ein Tier einem anderen etwas vorzeigt – wozu auch? Die Funktion dieses Teilverhaltens müßte schon klar sein, und es könnte nur eine der Kommunikation dienende Funktion sein. Schon gar nicht kann das Vorzeigen die Urform der Kommunikation und das sprachliche Zeichen ein Stellvertreter der Dinge sein. Mit dieser scholastischen Zeichenauffassung (aliquid stat pro aliquo) ist es also nichts. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.11.2020 um 04.25 Uhr |
|
In Zeichendefinitionen fehlt selten die Bestimmung, ein Zeichen stehe für die Sache, sei deren Stellvertreter (aliquid stat pro aliquo). "The English word cat stands for a referent that can be described as a ´carnivorous mammal with a tail, whiskers, and retractile claws.´" (Thomas A. Sebeok: An Introduction to Semiotics) In welchem Sinn steht das Wort Katze für eine Katze? Das habe ich nie verstanden. Es muß doch in irgendeiner Hinsicht eine Äquivalenz geben, wie auch sonst bei jeder Stellvertreterschaft. Andernfalls sollte man auf die irreführende Ausdrucksweise verzichten. Die Auskunft, es sei nicht so gemeint, ist unbefriedigend, wo es sich immerhin um die Definition und Grundlegung für alles übrige handelt. Wovon handeln Bücher, die schon mit einer absurden Gegenstandsbestimmung anfangen? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.11.2020 um 06.58 Uhr |
|
Zeichen oder nicht? Trump tritt eine Woche nach der verlorenen Wahl mit seinen natürlichen grauen Haaren auf. Will er seinen Anhängern damit eine Botschaft senden, oder hat er nur das Färben vergessen? Der weiße Hosenanzug von Kamala Harris ist in vielen Medien interpretiert worden, sicher mit Recht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.11.2020 um 15.48 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#44357 (und deshalb hier, obwohl es nicht das Thema berührt) Es leuchtet noch ein, daß jemand – nach Veblen, Zahavi u. a. – sich übernimmt, um dem anderen zu zeigen, was er sich leisten kann und wie stark und mächtig er folglich ist. Aber die Raserei, in die sich jemand hineinsteigert, bis er Haus und Hof und die eigene Seele verspielt, scheint mir doch noch etwas anderes zu sein. Als literarisches Mutiv erstaunlich alt, eine ganze Hymne des Rigveda (10.34) ist ihm gewidmet. Heimito von Doderer scheint selbst unter sinnlosen Wutanfällen gelitten zu haben, die er so gern darstellt. Manchem "brennen alle Sicherungen durch", sogar aus nichtigem Anlaß. Gehört der Amokläufer hierher? (Ich meine den klassischen, nicht den fanatischen Massenmörder, der vorher Messer kaufen geht.) Man kennt auch mehr oder weniger prominente Fälle des "Sichverkrachens": ein Brüderpaar, das sich wegen einer Kleinigkeit streitet und dann 60 Jahre nicht mehr miteinander spricht, gegen jede Vernunft. Das kommt uns kindlich-kindisch vor, und tatsächlich sind solche Anfälle ("tantrums") schon bei sehr kleinen Kindern bekannt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.11.2020 um 07.43 Uhr |
|
"Index ist ein Fachwort (Terminus) der Zeichentheorie (Semiotik), das ein Zeichen bezeichnet, dessen Zeichencharakter aus einer direkten, physischen hinweisenden Beziehung zwischen ihm und dem Bezeichneten besteht." (Wikipedia "Index") Man bemerke den Widerspruch. Hinweisen ist keine physische Beziehung. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 02.11.2020 um 21.30 Uhr |
|
Information ist eigentlich ebenso "verworren" oder nicht wie Materie. Über Materie gibt es die verschiedensten Ansichten, es gibt sogar Philosophen, die ganz die Existenz von Materie bestreiten. Trotzdem verwenden Psychologen, Biologen, Chemiker und Physiker heute einen allgemeinen Materiebegriff, den sie wohl entsprechend ihres Arbeitsgebiets erweitern, aber ohne mit dem Grundbegriff in Widersprüche zu geraten. Für Information muß es eine ähnlich allgemeingültige, allumfassende Definition geben. Das kann m. E. nur die naturwissenschaftliche Definition sein. Danach ist Information im allgemeinsten Sinne ein "Muster von Materie", so schreibt Wikipedia, ich sage auch Struktur oder Ordnung von Materie, wobei das Muster (die Struktur, die Ordnung) selbstverständlich immer noch der Interpretation bedarf. Ich sehe keinen grundsätzlichen Widerspruch dieser allgemeinen Definition zum Informationsbegriff in der Nachrichtentechnik, Informationstheorie, Psychologie, wo auch immer. Daß Information in Form einer Nachricht übertragen wird, vom Sender zum Empfänger, daß sie manchmal "Wissen" ist, oder nur "neues Wissen" meint usw., das sind doch alles Nebensachen, Untersuchungsobjekte der einzelnen konkreten Wissenschaften, keine Widersprüche zur Grunddefinition! Wenn einzelne Wissenschaftler etwas behaupten, was dennoch dazu oder in sich im Widerspruch steht, verworren ist, dann kann und muß man sie widerlegen. Es besteht aber kein Grund, deswegen Information überhaupt in Zweifel zu ziehen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.11.2020 um 06.39 Uhr |
|
Wie verworren der Begriff der "Information" ist, sieht man z. B. hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Information http://www.informationphilosopher.com/ http://www.petergodfreysmith.com/InfoBio-PGS-CUP07.pdf (mit dem ich sonst nicht in jeder Hinsicht übereinstimme) Damit möchte ich mich denn doch nicht belasten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.11.2020 um 18.41 Uhr |
|
Da müßte ich jetzt wieder meine ganze (behavioristische) Zeichentheorie aufrollen: wie Zeichen funktionieren, erworben werden, was sie bewirken usw., das ist alles über viele Einträge verstreut hier schon gesagt worden – ich bitte um Nachsicht, wenn ich das auf die Schnelle nicht leisten kann.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 01.11.2020 um 18.16 Uhr |
|
Ich dachte, ich frage schon nach der Sache selbst. Was ist dann in Ihrer Terminologie das, was in den Büchern steht, was andere Information nennen? Es muß doch etwas drin sein, Bücher sind doch nicht leer. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.11.2020 um 15.49 Uhr |
|
Sie nehmen es sehr genau! Bestimmt könnten Sie mir viele Stellen nachweisen, an denen ich von Informationen gesprochen habe. Man muß sich ja den kritisierten Autoren anpassen, wenn man nicht an ihnen vorbeiargumentieren will. Wenn ich sage, daß ich den Begrff nicht verwende, meine ich, daß es kein theoretischer Begriff in meiner eigenen Darstellung ist. Skinner sagt zum Beispiel, daß "Bedeutung" kein theoretischer Begriff seiner Verhaltensanalyse sei, daß er ihn im "Vernacular" unbefangen verwende. Könnten wir denn nicht mehr über die Sache selbst reden? Es kommt doch auf den Unterschied zwischen Mustern an, die "von Hause aus" Zeichen sind, und solchen, die es nicht sind. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 01.11.2020 um 14.34 Uhr |
|
„Aus allen Dingen kann man unbestimmt viel erschließen. Das heißt aber nicht, daß diese Informationen alle schon irgendwie in den Dingen vorhanden waren.“ (1584#24337) Dies meinen Sie nicht ironisch. Was man aus den Dingen schließen kann, sind also doch Informationen! Peter Hacker zitieren Sie zustimmend: „A great deal of information is amassed in the Encyclopedia Britannica.“ Wie nennen Sie das, was in Büchern steht, ist es denn nicht Information? Besonders hier verstehe ich nicht, wie man ohne den Begriff der Information auskommen kann. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.11.2020 um 04.52 Uhr |
|
Lieber Herr Riemer, ich habe doch nur – ironisch – den Sprachgebrauch Dennetts übernommen, den ich hier kritisiere. Er selbst ist es, der mit dem Begiff nicht zurechtkommt bzw. unabsichtlich Wortspiele betreibt. Die Vieldeutigkeit des Begriffs "Information" und seine äquivoke Verwendung in verschiedenen Bereichen ist gerade das, was ich zeigen wollte. Ich selbst verwende den Begriff nicht. Mir kommt es darauf an, daß wirkliche Zeichen (empfängerseitig semantisiert) nicht vorliegen, wo wie bei Jahresringen, Eisbergen, Pferdezähnen und Würfeln gar keine Nachricht gesendet wird. Die Auswertung solcher Quellen ist Mustererkennung, nicht Zeichenverstehen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 31.10.2020 um 23.51 Uhr |
|
Lieber Professor Ickler, Sie schreiben sehr oft über "Information", aber mir ist immer noch nicht klar, was Sie genau damit meinen. Haben Sie dafür eine eigene Definition (z. B. muß Information u. a. immer ein echtes, kein metaphorisches kommunikatives Ereignis sein), oder verwenden Sie das Wort selbst nur im allgemein bildungssprachlichen Sinne? Den semiotischen Begriff (über Sinn, Bedeutung) benutzen Sie ja sicher auch nicht. Zum Beispiel: "Ein Pferd kann die Information, die in der Abnutzung seiner Zähne steckt, nicht nutzen" Ist es also Information, nur nicht nutzbare, oder meinen Sie, daß deswegen in den abgenutzten Zähnen eben keine Information steckt? Oder: "Die Entstehung von Jahresringen ist [...] kein kommunikatives Ereignis." Meinen Sie also wirklich, deswegen stellen Jahresringe keine Information dar, oder meinen Sie doch eher, daß Information nicht unbedingt immer auf Kommunikation beruhen muß? Oder: Die im Würfel nicht enthaltene Information - ist sie nichtsdestotrotz eine Information über den Würfel? Wenn diese Information z. B. in einem Lehrbuch enthalten wäre, wozu erwähnen Sie überhaupt, daß sie im Würfel nicht enthalten ist? Ist es nicht ziemlich trivial, daß ein abstrakter Gegenstand keine Information enthalten kann? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.10.2020 um 04.47 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#24337 „A great deal of information is amassed in the Encyclopedia Britannica. In that sense, there is none at all in the brain. Much information can be derived from a slice through a tree trunk, or from a geological specimen. And no doubt too from a dissection of a brain. But that is not information which the brain has. Nor is it written in the brain, let alone in ´the language of the brain´, any more than the information ´in´ the tree trunk about the severity of winters in the 1930s is written in arboreal patois.“ (Peter Hacker: „Languages, Minds and Brains“ In: Colin Blakemore/Susan Greenfield (Hg.): Mindwaves. Thoughts on Intelligence, Identity and Consciousness. Oxford 1987: 485-505, S. 492f.) Auch im Computer sind Zustände, nicht Nachrichten oder Informationen gespeichert. Das Dennett-Zitat noch einmal: „There is information about the climatic history of a tree in its growth rings – the information is present, but not usable by the tree.“ Auch „not usable by the tree“ hat wenig Sinn; wie würde denn eine Nutzung aussehen? Das müßte doch wenigstens begrifflich denkbar sein, wenn die Negation einen Sinn haben soll. Vielleicht bestünde die Nutzung darin, daß der Baum seine Standfestigkeit verbessert? Das tut er ja vielleicht. Die Jahresringe sind nicht einmal wahrnehmbar, weil sie erst im menschlichen Präparat (durch Zersägen) entstehen. Der Baum selbst „zeigt“ sie nicht, schon gar nicht irgend jemandem. Die Entstehung von Jahresringen ist ein Teil des Wachstums und kein kommunikatives Ereignis. Ein Pferd kann die Information, die in der Abnutzung seiner Zähne steckt, nicht nutzen... Wenn ich einen Würfel untersuche, kann ich die Erkenntnis gewinnen, daß das Volumen in der dritten Potenz der Kantenlänge wächst. Diese Information ist aber nicht im Würfel enthalten. Er kommuniziert nichts, das tue ich. Information hat mit Nachrichten zu tun. Der Würfel sendet aber nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.10.2020 um 02.43 Uhr |
|
The earliest meaning of referent recorded in the Oxford English Dictionary is "one who is referred to or consulted", dating from 1844. A subsequent meaning is "a word referring to another"; the OED gives only one citation for this use, dating from 1899 (which speaks of "referent words or referents" that express a relation). The next meaning, which appears to stand in opposition to the previous meaning, as well as to the meaning implied by the etymology, is nonetheless the one which has gained currency: "that to which something [particularly a word or expression] has reference". This sense is first recorded in Ogden and Richards´ The Meaning of Meaning (1923; see further below); the OED also lists numerous subsequent examples of that usage. (Wikipedia) Hier wird immerhin einmal festgehalten, wie sonderbar es ist, ausgerechnet das, worauf referiert wird, als "Referentten" zu bezeichnen. Ogden und Richards versuchen in einer Fußnote, den irreführenden Gebrauch zu rechtfertigen (ziemlich schwach!). The word ´referent´(…) has been adopted, though its etymological form is open to question when considered in relation to other participial derivatives, such as agent or reagent. But even in Latin the present participle occasionally (e.g. vehens in equo) admitted of variation in use; and in English an analogy with substantives, such as ´reagent´ , ´extent´, and ´incident´ may be urged. Thus the fact that ´referent´ in what follows stands for a thing and not an active person, should cause no confusion. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.09.2020 um 06.30 Uhr |
|
Der biologische Sinn von morphologischen oder Verhaltensmerkmalen ist oft nicht leicht zu erkennen. So auch der Zeichencharakter. Ich habe schon als Kind gern den Flug der Lerchen beobachtet und mich gefreut, wenn eine (mit ununterbrochenem Gesang) so hoch stieg, daß sie fast nicht mehr zu erkennen war, und dann besonders am Sturzflug bis wenige Meter über dem Boden, wenn sie sozusagen die Reißleine zog. Das sollte für den Fuchs den Landeplatz schwer auffindbar machen. Nun lese ich bei Zahavi, daß es darauf ankommt, die Flugkünste des Männchen eindrucksvoller und damit vitaler zu machen. Wer kann zwischen diesen beiden Motivationen entscheiden? Es gibt sehr viele ähnliche Fälle. Warum Frauen und Männer verschiedene Knopfleisten tragen, wird immer wieder auf geschichtliche Motive zurückgeführt, mehr oder weniger lächerlich, aber vielleicht hat es überhaupt keinen Grund. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.09.2020 um 04.52 Uhr |
|
Das Kreuz als Symbol des Christentums wird einerseits unendlich variiert und stilisiert, so daß seine Auffassung als reines Ornament keine Schwierigkeiten bereitet (Wandschmuck-Verfügung usw.). Es ist so, als wollten die Menschen möglichst wenig an den tödlichen Hintergrund erinnert werden, nicht einmal in der Kirche (Altarkreuze sind durchweg abstrakt stilisiert). Andererseits werden Theologen nicht müde, seine primäre Funktion als Hinrichtungsinstrument recht eindringlich in Erinnerung zu bringen ("blutrünstiger Christ"). Diese beiden Welten haben kaum noch eine Verbindung. Der Krummstab der Bischöfe hat eine ähnliche Entwicklung durchgemacht, nur alles etwas lieblicher. Mit den heute üblichen, reich geschmückten Geräten kann man kaum noch ein Schaf an den Hinterbeinen festhalten, und niemand denkt daran, wie sich ja auch die Gläubigen nicht wie Schafe fühlen, trotz der Redeweise von "Oberhirten" usw. Früher müssen Schäfer viel häufiger gewesen sein (meine Vorfahren waren auch welche), die Familiennamen bezeigen es noch. Jeder kannte folglich den Hirtenstab. Bei Amazon kann man einen bestellen, einmal als Plastik-Requisit für kindliche Krippenspiele usw., aber auch als ernsthaftes Werkzeug, wetterfest aus Esche. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.09.2020 um 06.13 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#40303 und der Debatte drumherum Die Römer formulierten eine politische Entscheidungsfrage und versuchten dann, durch Deutung des Vogelflugs eine Antwort Jupiters zu bekommen. Dabei gab es viel Manipulation, Bestechung usw. Ob sie selbst daran glaubten? Wer weiß das schon. Spätere Archäologen werden nicht herausfinden, ob unsere Zeit, bei aller Pracht der Kirchenbauten usw., wirklich so religiös war. Cicero war selbst Augur und ließ das Augurenamt aus Gründen der Staatsräson gelten. Aber aus De diviniatione (das ich aber lange nicht gelesen habe) glaube ich mich zu erinnern, daß er nicht nur der Wahrsagerei skeptisch gegenüberstand. Dort ja auch das bekannte Zitat: Vetus autem illud Catonis admodum scitum est, qui mirari se aiebat, quod non rideret haruspex, haruspicem cum vidisset. Schon bevor ich das kannte, habe ich mich gefragt, ob unsere Theologen, deren Augurenlächeln ich schon mitbekommen hatte, nicht in einem ähnlichen Fall sind. In der Deutung von natürlichen "Symbolen" steckt noch etwas mehr als eine irregeleitete Zeichendeutung. Es gibt die alte Überzeugung von einer Harmonie der Welt, wozu eine Art Widerspiegelung des Kleinen im Großen und umgekehrt gehört. Das ermöglicht ein universelles Denken in Analogien. Unser eigener Körper lehrt uns, wie der Staat funktioniert (und umgekehrt) usw. Die allegorische Deutung der Natur (wie im "Physiologus") muß gar nicht auf einen "Zeichensender" zurückgehen, der uns etwas zu verstehen geben will, sondern kann ein Beispiel für die grundlegendere magische Einheit des Universums sein. Secundum naturam vivere – das ist die Einpassung in diese vermeintliche Harmonie. ("Naturalistischer Fehlschluß!" meckern die Gelehrten.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.09.2020 um 04.58 Uhr |
|
Das Handicap-Prinzip hat, soweit es reicht, eine große Bedeutung für die Evolutionslehre und auch für die Zeichentheorie. Zahavi war durch gewisse Unstimmigkeiten in Morphologie und Verhalten der Tiere auf das Handicap-Prinzip gestoßen. Es ist in der traditionellen Deutung mancher Merkmale schon bei Darwin vorgebildet, vor allem im Funktionskreis der sexuellen Selektion. Die Schwanzfedern von Paradiesvögeln hindern das Männchen am Fliegen und werden zu hohen Kosten produziert. Das scheint mehr als ausgeglichen zu werden durch den Signalwert bei der Partnersuche: Seht her, ich kann es mir leisten, so stark und gesund bin ich! Viel besprochen wird eines der ersten Beispiele aus Zahavis Werk: die scheinbar übermütigen Luftsprünge von Gazellen („stotting“) angesichts eines Beutegreifers. Sie sollen dem Löwen oder Leoparden zeigen, daß es sich nicht lohnt, ein so fittes Opfer zu verfolgen, und damit beiden „Partnern“ Energie sparen helfen. Beide Seiten haben etwas davon, wenn nur die schwachen Tiere weggefangen werden. Die lauten „Warnrufe“ der Vögel locken den Beutegreifer eher herbei, als daß sie die Schwarmgenossen in Deckung gehen lassen. In Wirklichkeit sollen sie dem Feind signalisieren: Du bist entdeckt, Anschleichen hat keinen Zweck! Auch hier beiderseitige Energieersparnis. Die lockere Anwendung auf den Menschen bringt sehr vieles auf einen gemeinsamen Nenner und wirkt besonders in populären Darstellungen überzeugend, so in Zahavis bekanntestem Buch. Natürlich hat Zahavi selbst schon die Verbindung zu Veblens „conspicuous consumption“ hergestellt. Auch das Potlatsch wird unter diesem Aspekt gedeutet. (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#41371) Aber vieles bleibt spekulativ. Wenn wir einen Menschen ansehen, der uns sympathisch oder attraktiv scheint, erweitern sich unsere Pupillen (ein differentialdiagnostisch eingesetztes Mittel: beim Homosexuellen oder Pädophilen weiten sich die Pupillen, wenn er Fotos vom Objekt seiner Begierde betrachtet). Zahavi deutet es als Signal: Sieh her, ich kann es mir erlauben, unscharf zu sehen. Einen Beweis gibt er aber hier so wenig wie in anderen, vor allem rein kulturell begründeten Fällen. Die mathematische Modellierung des Handicap-Prinzips, vor allem durch Alan Grafen, ist nur so gut wie die Grundannahmen, das wird auch im Wikipedia-Eintrag gesagt. Daß es spieltheoretisch möglich ist, wird oft mit einem Beweis seiner tatsächlichen Existenz verwechselt. John Maynard Smith und Richard Dawkins waren zuerst skeptisch, sind aber vor allem durch Grafen bekehrt worden. Als Forschungsprogramm ist das Handicap-Prinzip meiner Ansicht nach wertvoll, aber es sollte nicht einseitig verfolgt und vorzeitig popularisiert werden. Gerade an Zahavi selbst sieht man, wie schnell wissenschaftliche Kriterien aufgegeben werden, wenn man flott lesbare Bestseller schreiben kann. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.09.2020 um 03.52 Uhr |
|
„So kann etwa eine plötzliche Verdunkelung einen Fluchtreflex auslösen – der Schatten wird dabei als Signal für das Auftreten eines möglichen Räubers interpretiert.“ (Holk Cruse: Der Intellektuelle. In Martin Carrier/Johannes Roggenhofer: Wandel oder Niedergang? Bielefeld 2007:56) Die Interpretion des Reizes besteht in der Fluchtreaktion und geht ihr nicht vorher, im Gegensatz zu Cruses Darstellung. Gerade das Reflexhafte bedeutet, daß der Schatten nur aus der Sicht des Beobachters ein Signal für das Auftreten eines Räuber ist. Das Tier selbst „weiß“ nicht, warum es flieht: die Ursache liegt in der Stammesgeschichte. Übrigens nennt der Biologe Cruse seinen Musterfall eines Intellektuellen „Joachim Habermas“, was gut zu seinen Ausführungen über Fachgrenzen und Dilettantismus paßt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.09.2020 um 09.33 Uhr |
|
Charles Morris: „Die Erscheinungen sind Zeichen überhaupt nur für denjenigen, der sie als solche zu lesen weiß.“ Das ist nicht richtig. Die Biologie stellt die Existenz von Zeichen fest, „liest“ sie aber nicht als solche. Der Hund, nicht der Zoologe schnüffelt am Laternenpfahl; der Balztanz des Kranichs macht das Weibchen kopulationsbereit, nicht den Ornithologen. Ich muß Japanisch nicht verstehen, um zu wissen, daß es eine Sprache ist. Die empfängerseitige Semantisierung und damit die Existenz von Zeichen, natürlich und kulturell, ist eine objektive Tatsache, die sich feststellen läßt wie eine anatomische oder physiologische. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.08.2020 um 09.56 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#39503 Der Verhaltensforscher drückt die "Willkürlichkeit" des Zeichens passenderweise so aus: „Verbal responses lead to non-mechanical, non-geometrical effects.“ (Skinner, Hefferline Notes) „The ultimate consequence, the receipt of water, bears no useful geometrical or mechanical relation to the form of the behavior of ´asking for water´.“ (Skinner, Verbal Behavior) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.08.2020 um 12.33 Uhr |
|
Vor tausend Jahren wurde manchmal der Biologieraum verdunkelt, und dann spielte der Lehrer nach einigen Schwierigkeiten mit der Technik einen flimmerigen Film aus dem IWF in Göttingen ab. Erinnerungsgesättigt auch ein Streifen, auf den ich im Zusammenhang mit Wahrnehmung un Mimikry gestoßen bin: https://av.tib.eu/media/28873 Nähere Beschreibung z. B. in "Signale in der Tierwelt" (dtv). Während die Schmetterlinge insgesamt hier fast verschwunden sind, sehe ich den Kaisermantel noch recht oft. Wenn man die schwachsinnige Flugtechnik der Schmetterlinge sieht, würde man nicht glauben, daß sie irgendein Ziel mit Erfolg ansteuern könnten. Das tun sie aber trotzdem, und man muß sich schon eingehender mit ihrer Neurophysiologie beschäftigen, um das zu verstehen. Beim Betrachten eines Rapsfelds mit Tausenden von Kohlweißlingen notiert. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.08.2020 um 05.57 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#43768 Neben dem sog. "sachlichen" kannte die ma. Volksmedizin den "sprachlichen" Analogiezauber. Dieser beruhte darauf, dass man aus den gleichklingenden Namen einer Person (einer Pflanze, eines Tieres usf.) und einer Krankheit auf einen inneren Zusammenhang zwischen beiden schloss und daraus einen heilenden Einfluss ableitete. Beispiele: St. Augustin wurde bei Augenleiden, St. Blasius auch bei Blasenleiden und St. Valentin bei der Fallsucht angerufen. (https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Analogiezauber) Auch hier dienen Wörter nicht eigentlich als Zeichen, sondern werden als Gegenstände gebraucht, nur eben nicht aufrund von Kontiguität wie bei der beschwörenden Funktion ("Wenn man ihn nennt, kommt er gerennt"), sondern via Ähnlichkeit, daher unter Analogiezauber verbucht. All diese Atavismen sind interessant, weil sie nie ganz verschwinden, sondern mehr oder weniger unterschwellig auch den rationalsten Sprachgebrauch noch durchziehen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 13.07.2020 um 13.59 Uhr |
|
Ich will den Biologen ihre Zeichen nicht wegnehmen. Aber gibt es nicht einen wesentlichen Unterschied, wenn z. B. eine Spinne instinktiv auf das Zittern ihres Netzes reagiert, oder wenn ich das rote Ampellicht sehe, erkenne, daß ich hier warten soll, und dann wohlüberlegt trotzdem hinübergehe (es kommt nichts, eine evtl. Strafe ist gering und unwahrscheinlich)? Ich sehe im Zeichen (im linguistischen Sinne) in erster Linie etwas, womit jemand einem andern etwas "zeigen" will. Sowohl zum Zeigen wie zum Verstehen des Zeichens gehören Verstand. Den hat nur der Mensch. Tiere "verstehen" kein Zeichen, sie handeln instinktiv, reflexhaft, unüberlegt. Deswegen fände ich es klarer, Zeichen in der Biologie und in der Linguistik begrifflich zu trennen, und wenn nicht begrifflich, dann zumindest jeweils eigene, unabhängige Definitionen zu verwenden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.07.2020 um 04.27 Uhr |
|
Ich bin überrascht und verstehe nun andererseits besser, warum wir uns nicht verstehen. Ich kenne keinen Biologen, der Zeichen in der Natur anzweifelt. Das hat mit meinem Behaviorismus gar nichts zu tun. (Der Begriff des AAM gehört hingegen zu einer ethologischen Schule, die heute weniger Anerkennung findet, weshalb der Begriff auch seltener anzutreffen ist.) Auf die unbelebte Natur wendet niemand Zeichenbegriffe an. Die Unterscheidung ist auch nicht schwer. Für mich wird es erst interessant, wo ich wirkiche Zeichen von Anzeichen (Symptomen) unterscheiden kann und mich damit von vielen Semiotikern absetze. Aber nicht "Bewußtsein" und dgl. sind mein Kriterium, sondern "Geschichte", wie in meinem Aufsatz "Wirkliche Zeichen" dargelegt. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 12.07.2020 um 23.46 Uhr |
|
Ja, Blüten, Vogelgesang, Balztänze u.ä. würde ich in der Tat weglassen. Wo soll denn Schluß sein, wenn auch Tiere und Pflanzen sich nach "Zeichen" richteten? Und die "Zeichen" der leblosen Natur? Kommunizieren wir etwa auch mit Sonne und Mond, oder diese untereinander? Eine Spur im Schnee oder der Sonnenaufgang werden wohl umgangssprachlich auch Zeichen genannt, aber im Sinne einer exakten Theorie würde ich das nicht übernehmen. Um sich nicht im Endlosen zu verlieren, finde ich, man sollte unter Zeichen nur Dinge verstehen, die der menschlichen Kommunikation dienen. Wirkliche Zeichen sind m. E. vom Menschen gemacht und an Menschen gerichtet. Tiere handeln instinktiv. Sie verstehen keine Zeichen. Ich sehe im tierischen Verhalten, erst recht im pflanzlichen, einen großen Unterschied zum menschlichen. AAM ist doch ein passender Ausdruck in der Verhaltensforschung, muß man den unbedingt unter Zeichen subsumieren? Nun ja, ich glaube schon zu verstehen, es hängt mit Ihrem behavioristischen Ansatz zusammen, auch Instinkte steuern letztlich ein Verhalten. Ich denke aber, nur der Mensch ist sich der Zeichenhaftigkeit einer Sache bewußt, kann die Bedeutung des Zeichens erfassen, es richtig deuten und sein Handeln wohlüberlegt danach ausrichten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.07.2020 um 03.26 Uhr |
|
Ich setze natürlich voraus, daß Sie den Vogel befragen. Aber mal im Ernst: Der Ausschluß natürlicher Zeichen dürfte schwierig werden. Was die Ethologen "angeborene Auslösemechanismen" (AAM) nannten – alles weglassen? Blüten, Vogelgesang, Balztänze... |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 12.07.2020 um 01.18 Uhr |
|
Na ja, der Vogel muß im Prinzip ständig sagen, ich sehe nix. Was sollte ihn veranlassen, dies gerade in dem Moment zu sagen, wo es etwas zu sehen gäbe? Er sieht einfach immer nichts, hätte also in einer Kommunikation mit dem Falter selten Neues zu erzählen. Der Falter mag sich einseitig seines Überlebens freuen, aber ein Selbstgespräch ist ja auch keine Kommunikation. Vielleicht hat die ganze Frage auch mit meinem allgemeinen bisherigen Zeichenverständnis zu tun. Ich habe immer Bedenken, die Zeichentheorie auf die ganze unbewußte Natur anzuwenden. Sind Zeichen im Rahmen der Sprachwissenschaft nicht eher nur eine Sache der zwischenmenschlichen Kommunikation? Führt die Anwendung auf Tiere und Pflanzen nicht ebenfalls zu der andernorts so oft als ein Ausschlußkriterium angeführten Zeicheninflation? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.07.2020 um 20.29 Uhr |
|
Anders gesagt: Zwischen Sichverstecken und Nichtexistieren ist ein großer Unterschied. Nur für den Empfänger nicht, aber das ist eben nur die eine Hälfte des Gesamtvorgangs. Der Sender signalisiert dem Empfänger Nichtexistenz. Der Vogel sagt: "Ich sehe nix." Der Schmetterling reibt sich die Hände: Operation gelungen. Das ist doch nicht nichts, sondern ein kommunikativer Vorgang.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.07.2020 um 18.30 Uhr |
|
Ja, genau! Das ist der Zweck der Tarntracht.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 11.07.2020 um 17.28 Uhr |
|
Der Vogel fliegt am Baum mit dem Falter genauso vorbei wie am Baum ohne Falter. Ein Zeichen, welches das gleiche bewirkt wie kein Zeichen? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.07.2020 um 14.51 Uhr |
|
Ich glaube, Sie kleben zu sehr an der Negation. Darum hatte ich mit "übersehen, übergehen" eine Brücke zu bauen versucht. Das alles ist durchaus Verhalten, und es ist der Grund dafür, daß sich die Mimikry beim "Sender" herausgebildet hat. Das Nichtwahrnehmen ist sozusagen eine "bestimmte Negation" (um mal bei nicht gerade geliebten Philosophen eine Anleihe zu machen). Anders gesagt: In der Umgebung eines Birkenspanners oder einer Stabheuschrecke gibt es unzählige Tiere und Gegenstände, die alle "nichts wahrnehmen". Aber nur die Reaktion des Freßfeindes war Auslöser der Evolution von Tarntracht. Also war es nicht nichts.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 11.07.2020 um 10.22 Uhr |
|
"Sie werden vom Freßfeind sehr wohl wahrgenommen" Ja, aber nicht als (getarntes) Futter, sondern als Zweig, Blatt, Baum. Das ist ja dasselbe wie (als Futter) nicht wahrgenommen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 11.07.2020 um 10.14 Uhr |
|
Aber bitte, wo ist der Unterschied, wenn ein Vogel auf den Falter am Baum, den er nicht erkennt, nicht reagiert oder wenn er "mit nichts" reagiert? Beides ist das gleiche Verhalten wie gegenüber einem Baum ohne Falter. Ob das Zeichen(?) da ist oder nicht da ist, ändert nichts am Verhalten des Vogels. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.07.2020 um 04.29 Uhr |
|
Der Vogel nimmt den Baumstamm wahr, aber nicht den Falter darauf, das dürfte sich ja wohl nachweisen lassen. Daß "für ihn" nichts da ist, scheint mir irrelevant zu sein. Es geht um Reaktionen, nicht um hypothetische Erlebnisse. Manche Raupen oder Stabheuschrecken simulieren einen Zweig, manche Falter ein "wandelndes Blatt". Sie werden vom Freßfeind sehr wohl wahrgenommen, aber "übersehen" oder "übergangen". Das Gegenteil der Tarntracht ist die Warntracht, aber zeichentheoretisch ist kein Unterschied: Ausbildung von Mustern unter der Wirkung ihrer Wirkung auf andere. Das Militär macht Fahrzeuge unsichtbar (Tarnung) oder sichtbar (auffällig: Rotes Kreuz). Der Mechanismus ist der gleiche. Auch beim Militär gibt es Signalfälschung (Attrappen). Tarnung kann man man anscheinend nicht fälschen: so tun, als tue man so, als sei man nicht da? |
Kommentar von Manfred Riemer , verfaßt am 10.07.2020 um 21.55 Uhr |
|
Etwas nicht Wahrgenommenes, es hat keinen Empfänger. Ein Zeichen ohne Empfänger, geht das? |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 10.07.2020 um 20.37 Uhr |
|
Wie können wir wissen, ob der Empfänger tatsächlich auf ein Zeichen mit Nichtstun (= Übersehen) reagiert oder ob er einfach nicht reagiert, weil er wegen der Tarnung gar kein Zeichen erkennt? Für ihn ist im Prinzip kein Zeichen vorhanden. Ich sehe da keinen Unterschied. Ein nicht wahrgenommenes Zeichen, welches für den Empfänger genauso gut ist wie etwas nicht Existierendes, kann doch schwerlich ein Zeichen sein, oder?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.07.2020 um 11.54 Uhr |
|
Die Tarntracht hat sich unter der Steuerung durch die Reaktion des Beutegreifers (eines Vogels) entwickelt, wobei diese Reaktion hier im Übersehen besteht. Das ist nur alltagssprachlich ein bißchen komisch, semiotisch ist es einerlei mit jeder anderen Reaktion. Ich hatte früher mal gezögert, ob ich Mimikry zur Zeichenentstehung rechnen sollte, inzwischen bin ich ganz dafür. Die "empfängerseitige Semantisierung" liegt vor. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 10.07.2020 um 11.22 Uhr |
|
Aber wieso ist die Tarnung des Birkenspanners zeichenhaft? Wer soll dieses Zeichen erkennen, wozu? Geht es nicht ums genaue Gegenteil, der Birkenspanner "will" möglichst kein Zeichen setzen, möglichst nicht gesehen werden?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.07.2020 um 05.49 Uhr |
|
Die vom Ruß schwärzlich gewordene Birkenrinde ist ein Muster, aber kein Zeichen. Zeichenhaft ist die Mimikry des Birkenspanners, der seine Flügelzeichnung an dieses Muster anpaßt ("Industriemelanismus", dessen Realität ich hier einmal voraussetze). Der Wohlgeschmack der Kirschen hat sich im Zusammenspiel mit den Tieren herausgebildet, die sich daran gütlich tun (und nebenbei die Samen verteilen). Aber die Kirschen werden nicht am Geschmack erkannt, der also nicht informativ und a fortiori kein Zeichen ist. Immer geht es um einen im weiteren Sinn "symbiotischen" Zusammenhang, im Sonderfall vermittelt über den Anteil "Information" oder "Mustererkennung". Skinner sagt meistens "nicht physisch", "nicht mechanisch". Man kann das sicher noch genauer formulieren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.07.2020 um 18.02 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#39372 http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#39563 Mein ganzes Leben lang war ich der Meinung, daß Limenitis archippus („Viceroy“) seine verblüffende Ähnlichkeit mit dem ungenießbaren Monarchfalter (Danaus plexippus) der Batesschen Mimikry verdankt, aber nun lese ich, daß er selber ebenfalls ungenießbar ist. Wozu also der Aufwand? Aber natürlich profitiert er ebenfalls davon, daß nicht nur solche Vögel ihn meiden, die sich an anderen Viceroys den Magen verdorben haben, sondern auch solche, die schlechte Erfahrungen mit dem Monarchfalter gemacht haben. Signalfälschung ist es auf jeden Fall, denn die Zeichnung des Monarchs ist ihrerseits schon zeichenhaft. Die Angleichung an Blätter oder Borke ist dagegen eine Stufe niedriger, weil letztere im allgemeinen keine Zeichen sind. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.07.2020 um 06.08 Uhr |
|
Noch einmal zum "Selbstgespräch" (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#41914 usw.) Bei Skinner spielt "Sprecher und Hörer innerhalb derselben Haut" eine große Rolle, auch im Zusammenhang mit dem Gegensatz von rule-governed vs. contingency-shaped. Letzteres hat sich ale ein Hauptproblem auch unter den Anhängern des Radikalen Behaviorismus herausgebildet. Aus der unendlichen Literatur greife ich kurz und knapp heraus die Beiträge von Margaret Vaughan und Linda Parrott in Modgil/Modgil (auch im Netz: https://archive.org/stream/leiturasemanalisedocomportamento/ModgilMogil2005.B.F.Skinner-ConsensusAndControversy_djvu.txt) Es wird meist übersehen, daß die ganze Redeweise nur metaphorisch verstanden werden kann. Sprecher und Hörer im normalen Sinn sind Personen mit einem gesellschaftlichen Hintergrund, verschiedenen Konditionierungsgeschichten, daher verschiedenem Wissen und verschiedenen Absichten. Im Selbstgespräch wissen und wollen Sprecher und Hörer dasselbe, leisten einander keinen Widerstand, brauchen von nichts überzeugt zu werden; Rede und Gegenrede, soweit überhaupt möglich, stammen aus derselben Quelle usw. All das ist himmelweit von einem wirklichen Gespräch entfernt. Die innere Rede kann das sonstige Verhalten "erleichtern" oder "bahnen" ("facilitate" sagt Skinner). Das ist weniger eine Kontrolle als eine Art "fliegender Start". Ein schwieriges Thema, kaum angemessen bearbeitet. Oft rechtfertigt man sein Verhalten auch, indem man es mit stummer Rede beschreibt und erklärt. Dadurch wird die Normgerechtheit und Rationalität abgesichert, ALS OB man mit anderen einen Rechtfertigungsdialog geführt hätte. Sprache ist ja öffentlich, gesellschaftlich. Wenn es gelingt, das eigene Verhalten sprachlich zu fassen, ist es schon gesellschaftlich domestiziert. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.06.2020 um 07.27 Uhr |
|
Auch auf Kontiguität (Berührungsassoziation) beruhen magische Praktiken, etwa wenn ein Gegenstand, der einem verhaßten Menschen gehört, vernichtet oder begraben wird. In Liebesbeziehungen werden Gegenstände, die mit dem geliebten Menschen in Berührungsassoziation verbunden sind, gleichsam fetischistisch verehrt („Schaff mir ein Halstuch von ihrer Brust, ein Strumpfband meiner Liebeslust!“). Der Fromme hält Heiligenbilder und Reliquien in Ehren, wobei die ersten durch Ähnlichkeit, die letzteren durch wirkliche oder eingebildete Kontiguität mit dem Heiligen verbunden sind. All dies sind Fälle von Stellvertretung, aber keine dieser Verhaltensweisen läßt sich als Kommunikation verstehen; die stellvertretenden Gegenstände sind daher keine Zeichen. Hier muß man wohl auch Flaggen, Wappen, Abzeichen, Hymnen usw. einordnen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.05.2020 um 11.08 Uhr |
|
Noch zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#41324: Mit 22 Jahren konnte Shannon 1938 seine Master’s Thesis publizieren – sie wurde aus berufenem Mund “possibly the most important, and also the most famous, master’s thesis of the century” genannt: Shannon zeigte dort, dass die Operatoren der Booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT – diese Operatoren liegen unserem Denken zu Grunde) auf einfache Weise mit elektronischen Schaltkreisen dargestellt werden können – was einige Jahre später, als mit dem Transistor ein elektronischer Schalter entdeckt wurde, zur Grundlage unserer heutigen elektronischen Rechner wurde. (Raible) Die Operatoren liegen nicht unserem Denken zugrunde, sondern unserem Argumentieren, nämlich soweit es sich um logisches Schließen handelt. (Soviel ich weiß, brauchte man auch nicht auf den Transistor zu warten, weil logische Maschinen z. B. auch mit magnetischen Relais oder elektronischen Röhren gebaut werden können und auch gebaut worden sind.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.05.2020 um 05.28 Uhr |
|
Zum vorigen Eintrag: Skinner beschwerte sich über redaktionelle Eingriffe in sein Manuskript, u. a. die Ersetzung von which durch that im Sinne der normativen Grammatikvorstellungen Fowlers: Fowler’s Modern English Usage is probably responsible for the current belief that there is logical elegance in using that as a defining restricting pronoun and which as a non-defining restricting. The distinction between the two cases is carried in speech by pausing and inflection, and in writing by commas. It has never been consistently carried by that vs. which. Ein wichtiger Punkt, wo es um Skinners Definition des Sprachverhaltens geht. In der behavioristischen Diskussion spielt das eine große Rolle. Ich komme darauf zurück, weil es für meinen naturalistischen Zeichenbegriff wichtig ist. Vgl. vorläufig: Maria de Lourdes R. da F. Passos in: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3359847/ |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.04.2020 um 20.04 Uhr |
|
Natürlich kann ich auch die Sprache benutzen, ohne das geringste von ihrer Geschichte zu wissen. Es geht hier um ein Mißverständnis, das sich nicht so leicht ausräumen läßt. Meine Ausgangsfrage ist: Wie kann man feststellen, daß etwas ein Zeichen ist und nicht eine zufällige andere Konstellation? Das ist keine Frage des Benutzers (Teilnehmers), sondern eine des Beobachters, der ich als naturalistischer Semiotiker bin. Ich stelle gerade eine Zeichendefinition zusammen, aber ich muß um etwas Geduld bitten, weil ich anderweitig gebraucht werde; habe es aber nicht vergessen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.04.2020 um 18.01 Uhr |
|
Wenn ich nun, wie es Mathematiker zu tun pflegen, z.B. sage, es seien n eine natürliche Zahl größer als 1 und pn (p mit tiefergesetztem Index n) eine beliebige Primzahl, die bei Division durch n den Rest 1 läßt. Dann habe ich doch einfach so, ohne lange Geschichte, ein Zeichen pn definiert, welches künftig innerhalb des hierauf bezogenen Textes, sozusagen synchron, die festgelegte Bedeutung hat. Deshalb meine ich, manche Zeichen mögen wohl eine längere Semantisierung durchlaufen, aber es kann doch nicht zu den allgemeinen Kriterien eines Zeichens gehören, daß so eine Geschichte existiert. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.04.2020 um 16.44 Uhr |
|
Nur schnell zur "Geschichtlichkeit": Damit ist die Entstehungsgeschichte, genauer die Semantisierung gemeint, wie hier auch im Haupteintrag dargestellt. Ich könnte auch "genetisch" sagen (und sage es ja auch), aber das ist ebenso zweideutig. Das kann ich leider nicht ändern. Geist, Bewußtsein usw. – das sind für mich Konstrukte einer volkstümlichen Psychologie, keine wirklichen Gegebenheiten. Für einen gewissen "Materialismus" war Bewußtsein eine Eigenschaft der höher organisierten Materie, aber damit kleistert man nur zu, was die ältere Philosophie das Leib-Seele-Problem nannte. Für mich natürlich kein sachliches, sondern ein sprachkritisch aufzulösendes (nicht zu lösendes) Problem. Die Verkennung dieser Verhältnisse macht den Geist zu etwas Mysteriösem. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.04.2020 um 14.14 Uhr |
|
Der Geist ist mysteriös? Warum? Ich habe eine materialistische, realistische Grundeinstellung und sehe im Geistigen bzw. im Bewußtsein nichts Mysteriöses. Es existiert als Eigenschaft der Materie. Es ist natürlich schwer, von der Bedeutungsseite eines Zeichens zu sprechen, wenn man die Existenz des Ideellen, eines Dinges wie „Bedeutung“, überhaupt bezweifelt. Vielleicht ist die Zeichentheorie sowieso erst einmal eine weltanschauliche Frage. Ich kenne leider nicht Ihren ganzen Aufsatz „Wirkliche Zeichen“, aber den hier verlinkten Teil zitieren Sie sehr oft, so daß man wohl annehmen kann, daß er das Wichtigste enthält. Der Abschnitt „Der Begriff des Zeichens“ läßt eigentlich erwarten, hier Ihre Zeichendefinition zu finden. Statt dessen widerlegen Sie aber nur die kellerschen Begriffe. Ich finde das sehr wohl interessant und soweit auch einleuchtend, aber Sie sagen eben nicht, was wirklich ein Zeichen ist, geschweige denn etwas über dessen Geschichtlichkeit. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.04.2020 um 04.04 Uhr |
|
Die geistige Seite ist mysteriös, weil der Geist mysteriös ist, eine Mystifikation, genauer gesagt. Über die Geschichtlichkeit des wirklichen Zeichens kann ich nicht viel mehr sagen als hier: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#31975 |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.04.2020 um 00.28 Uhr |
|
Was ist mysteriös an der zweiten Seite des Zeichens? Was ist z. B. mysteriös daran, daß ein Buchstabe eine Schriftform und einen Lautwert hat? Was hat die Zweiseitigkeit eines Zeichens mit der synchronen Sicht zu tun? Vielleicht hat es Saussure so gesehen, aber wenn schon, wäre das nicht korrigierbar, muß man deswegen den ganzen zweiseitigen Zeichenbegriff verwerfen? Sicher sind viele Zeichen in einem historischen Prozeß entstanden, aber braucht es den unbedingt? Ich kann mir doch irgendein Zeichen ausdenken und sagen, darunter verstehe ich fortan dies und nur dies. Jeder, der das liest, kennt mein Zeichen. Das hat nichts mit zeitlicher Entwicklung zu tun. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.04.2020 um 17.53 Uhr |
|
Biologie ohne Evolution ist sinnlos (Dobzhansky). Sprachwissenschaft ohne Geschichte (Kulturgeschichte und Konditionierungsgeschichte) ist sinnlos. Zeichen sind „synchron“ nicht einmal als solche zu erkennen, weil das einzige Kriterium der Prozeß der Semantisierung ist, also eine „historische“ Tatsache (im weiteren Sinn). (s. u. a. „Blumen und Bienen“, heutiger Eintrag) Aus der von Saussure dogmatisierten synchronen Sicht erscheint die Bedeutung als mysteriöse zweite „Seite“ des Zeichens. So schon Dante (De Vulgari Eloquentia 1.3.3) und das ganze Abendland. Aber nochmals: „Meaning or content is not a current property of a speaker’s behavior. It is a surrogate of the history of reinforcement which has led to the occurrence of that behavior.“ (Skinner) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 19.09.2019 um 23.45 Uhr |
|
Ich glaube nicht, daß die Theorie des bilateralen Zeichens wegen des Vorfeld-es ins Wanken geraten könnte. Aber ein paar ihrer Anhänger disqualifizieren sich natürlich selbst, wenn sie dieses zum Zeichen mit leerer Bedeutung erklären.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.09.2019 um 15.41 Uhr |
|
Ich hätte damit kein Problem. Es sind doch die von mir Kritisierten, die in Schwierigkeiten kommen mit ihrem Bedeutungsbegriff, der sie dann dazu zwingt, von Zeichen ohne Bedeutung zu sprechen.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 19.09.2019 um 15.28 Uhr |
|
Meiner Ansicht nach haben Vertreter der Theorie, es gäbe Wörter mit leerer Bedeutung, sog. semantisch leere Zeichen, einfach nicht recht. Solche Zeichen gibt es nicht. Sie, lieber Prof. Ickler, nennen das Anzeigen der Satzart ist die Funktion des Vorfeld-es. Kann man das nicht genausogut auch seine Bedeutung nennen? Sonst hätten ja viele Wörter, z. B. Pronomen, gar keine Bedeutung: Was bedeutet das gerade von mir verwendete Wort "seine"? Nichts als einen Verweis auf ein kurz vorher genanntes Maskulinum oder Neutrum und eine Besitzanzeige. Dies kann man Funktionen nennen, oder, wenn man so will, auch die Bedeutung des Wortes. Hier sind Funktion und Bedeutung m. E. das gleiche, vielleicht nur in einer etwas anderen Sichtweise. Analog beim Vorfeld-es. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.09.2019 um 12.35 Uhr |
|
Wie die Vertreter eines bilateralen Zeichenbegriffs mit den Synsemantika, Funktionswörtern oder "semantisch leeren" Zeichen zurechtkommen wollen, ist mir nicht recht klar. Die IDS-Grammatik erkennt nur das Vorfeld-es als semantisch leer an. "Semantisch leer" ist eine etwas verfremdete Umschreibung für "ohne Bedeutung". Sind Zeichen ohne Bedeutung überhaupt Zeichen im Sinne der Definition? Manche schreiben ihnen, um nicht gegen das Zeichenmodell zu verstoßen, eine Inhaltsseite zu, die sei aber leer. Zeichen, die nur eine Ausdrucksseite haben, aber keine Inhaltsseite (wie die Strukturalisten uns zumuten), lassen sich nicht von beliebigen Gegenständen unterscheiden, die niemand als Zeichen ansehen würde. Zum Beispiel die Tomate dort. Für uns Behavioristen gibt es dieses Problem nicht. Zeichen haben eine Funktion, sie besteht in den Gebrauchsbedingungen. Das Vorfeld-es sichert die Verbzweitstellung und zeigt damit die Satzart an. Da es die Verarbeitung der übrigen Zeichen steuert, gehört es zu den autoklitischen Sprachmitteln. Zu diesem es möchte ich noch anmerken, daß in volkstümlichen Erzählungen statt Es war einmal sehr oft Da war einmal steht. (Bitte googeln nach "Da war einmal ein Mann"!) Ich vermute, daß ein blasser Rest von personaler Deixis geblieben ist: Der Sprecher verweist auf den Hörer, in dem sich die Erzählwelt aufbaut. Führe er fort mit Und dieser Mann..., so könnte er in lebhafter Sprechweise mit dem Zeigefinger auf den Hörer weisen (keinesfalls aber auf die eigene Brust, wie denn auch hier als Einleitung ganz undenkbar wäre). Das da am Anfang hat also ungefähr die Funktion von Stell dir vor... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.08.2019 um 10.57 Uhr |
|
Zur "inneren Rede" (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#32123): Wir verbringen den größten Teil unseres Wachlebens „mit uns selbst“, d. h. innerlich redend, uns die Dinge zurechtlegend, zurechtredend, sei es auch grammatisch rudimentär. All das bestärkt uns in der Meinung, das Innenleben sei das primär Gegebene und die „Außenwelt“ (schon der Begriff setzt ja die Existenz der Innenwelt voraus) beweisbedürftig. Das sind eigentlich keine Selbstgespräche im Sinne eines Sprechens mit uns selbst. Wir reden uns normalerweise nicht an (ich habe das noch nie getan, etwa so: „Theo, du mußt jetzt ganz ruhig bleiben“), stehen uns nicht gegenüber, auch nicht als Fiktion (Verstellungsspiel). Vielmehr ist es eine Art Probesprechen, Versuchsformulierung, durchaus für imaginäre andere. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.07.2019 um 11.33 Uhr |
|
Die Verkehrszeichen sind anscheinend alle zusammengesetzt und analysierbar (Form, Farbe, Aufschrift bzw. Bild). Einige wenige sind redundant kodiert: Das rote Oktogon bedeutet schon STOP, die Aufschrift verdoppelt die Botschaft. Verkehrsampeln teilen dasselbe durch Farbe und Position der Lampen mit, ein Ampelmänchen kann als Verdreifachung hinzukommen. Es wirkt wie eine Synonymenschar. Meistens ist aber ein hypotaktisches oder prädikatives Verhältnis gegeben. Das Abbild eines Pferdes mit Reiter nennt den Gegenstand, ein schräger roter Strich sagt, daß er nicht zugelassen ist. Das Durchstreichen ist eine konventionelle Annullierung. Im Gegensatz zum Ausradieren erkennt man aber noch, worum es geht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.06.2019 um 03.59 Uhr |
|
Von der IDS-Website (https://grammis.ids-mannheim.de/progr@mm/5253): "Wörter werden in der alltäglichen Kommunikation dazu verwendet, um auf die außersprachliche Realität Bezug zu nehmen." Alle Wörter? Zum Beispiel die Artikel in diesem Satz? "Das Wort selbst ist weiter segmentierbar in kleinere Zeichen, die Morpheme." Jedes Wort? Auch die Präposition in diesem Satz? "Die Morpheme – wenn man sie weiter segmentiert – bestehen aus bedeutungsunterscheidenden Einheiten, den Phonemen. Phoneme besitzen im Gegensatz zu den Wörtern und den Morphemen keine Bedeutung, tragen aber dazu bei, Bedeutungen zweier oder mehrerer Wörter zu unterscheiden." Phoneme unterscheiden Morpheme, nicht Bedeutungen. Gleich darauf wird derselbe Sachverhalt in Saussureschen Begriffen ein zweitesmal dargestellt: "Die Phoneme /r/, /z/, /k/, /m/, /f/, /d/ sind zum Beispiel verantwortlich für die Bedeutungsunterschiede zwischen rein, sein, kein, mein, fein, dein. Als einzelne Einheiten haben sie keine Inhaltsseite (kein Signifikat)." Aber die Inhaltsseiten oder Signifikate unterscheiden sich nicht durch Phoneme; das paßt begrifflich nicht zusammen, schon weil die Bedeutungen auf ganz verschiedene Weise beschrieben werden können und an sich überhaupt keine phonologische Struktur haben. Sonst wären sie ja wieder Zeichen usw. So ungefähr wird die herrschende Lehre tausendfach weitergegeben, beispielsweise in sämtlichen Einführungsbüchern und im linguistischen Grundkurs. Die fundamentale Störung wird nicht bemerkt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.06.2019 um 04.37 Uhr |
|
„Unter einem umfassenden semiotischen (zeichentheoretischen) Aspekt, kann man mit einem anderen Semiotiker, Umberto Eco, so weit gehen, die komplette Welt als zeichenhaft zu betrachten. Bei dieser Annahme bestünde unsere Welt ausschließlich aus Zeichen, welche Bedeutung besitzen und dadurch interpretierbar wären.“ (https://grammis.ids-mannheim.de/progr@mm/5253) Das ist die Formel des semiotischen Imperialismus. Aber „Bedeutung“ hat hier keinen unterscheidenden Sinn mehr. Jede Beschaffenheit läßt auf etwas anderes schließen, wenn jemand da ist, der genug darüber weiß. Das Spektrum ferner Sterne verrät dem Physiker etwas über die dort vorhandenen Elemente usw. Kohlenmonoxid läßt auch auf etwas schließen, außerdem tötet es uns, was auch noch zu beachten wäre – vermutlich ein semiotischer Vorgang wie alles andere. Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1578 (Das IDS ist auf Saussures bilateralen Zeichenbegriff festgelegt.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.06.2019 um 07.23 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#40404 Der bekannteste Vertreter des "semiotischen Imperialismus" (der Allzuständigkeit der Semotik) ist Umberto Eco. Weil alles Repräsentant eines anderen sein kann, kommt er zu dem Schluß: "Hier wird allmählich klar, womit ein Buch über den Begriff des Zeichens sich beschäftigen muß: mit allem." (Umberto Eco: Im Labyrinth der Vernunft. Texte über Kunst und Zeichen. Leipzig 1990:11). Zugrunde liegt die Auffassung, daß etwas schon dadurch zum Zeichen wird, daß jemand es für ein Zeichen hält (und eine Deutung versucht). Für mich wird etwas nicht durch die Deutung zum Zeichen, sondern durch die Semantisierung. Das ist eine zweiseitige Angelegenheit. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 13.05.2019 um 14.37 Uhr |
|
Danke für die Möglichkeit, meinen Einwand gegen #41452 neu zu formulieren. Der Vergleich des bilateren Zeichens mit Vorder- und Rückseite eines Gegenstands hinkt m. E. ein bißchen. Beide letzteren sind materiell, aber beim Zeichen gilt das nur für eine Seite, den Zeichenkörper, die andere, die Bedeutung, ist eine Idee. Das ist keine Beziehung zwischen gleichberechtigten Entitäten, sondern eine Abhängigkeit. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.05.2019 um 09.50 Uhr |
|
Der bilaterale Zeichenbegriff ist eine Sonderform der herkömmlichen Sprachauffassung, wonach ein Ausdruck, um zu funktionieren, eine Bedeutung „haben“ müsse. Diese Redeweise nimmt man wörtlich, als gehe es um zwei numerisch verschiedene „Entitäten“ (Etwasse), zwischen denen eine Beziehung bestehe, vergleichbar der Beziehung zwischen Vorder- und Rückseite eines Gegenstandes oder zwischen Behälter und Inhalt. Den Individuenbezeichnungen, also Eigennamen, Kennzeichnungen und Pronomina entsprechen dann konkrete Gegenstände, den Appellativen abstrakte Gegenstände (oder Universalien, Ideen...). Schon ist man in der Metaphysik, statt sich an die Linguistik (einschließlich empirische Sprachverhaltenanalyse) zu halten und die Probleme zu lösen, wo sie noch lösbar sind, also das Funktionieren der Sprache aus seiner Geschichte zu erklären. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.05.2019 um 05.16 Uhr |
|
Man denkt: Um sagen zu können, daß das runde Quadrat nicht existiert, muß man annehmen, daß der Ausdruck rundes Quadrat sich auf etwas bezieht, sonst wäre er ein bedeutungsloses Geräusch und könnte nicht Subjekt einer Aussage sein. Folglich muß es das runde Quadrat doch irgendwie geben. Russell hat das Problem (mit dem sich Bolzano, Brentano, Husserl, Meinong u. a. herumschlugen) gelöst, soweit logische Bedürfnisse betroffen sind (On Denoting, Mind 1905). Aber die Logik ist nicht das Ganze: We cannot move very far in the study of behavior apart from the circumstances under which it occurs. Bertrand Russell has tried to improve upon a merely formal analysis, but he has never been fully successful because the methods available to the logician are not appropriate to the study of behavior. Consider, for example, the following passage from An Inquiry into Meaning and Truth: Thought, in so far as it is communicable, cannot have any greater complexity than is possessed by the various possible kinds of series to be made out of twenty-six kinds of shapes. Shakespeare’s mind may have been very wonderful, but our evidence of its merits is wholly derived from black shapes on a white ground. Russell might have gone a step further and reduced all of Shakespeare’s “mind” to a series of dots and dashes, since the plays and poems could be sent or received in that form by a skilled telegraphist. It is true that evidence of the “merits of Shakespeare’s mind” is derived from black shapes on a white ground, but it does not follow that thought, communicable or not, has no greater “complexity.” Shakespeare’s thought was his behavior with respect to his extremely complex environment. We do not, of course, have an adequate record of it in that sense. We have almost no independent information about the environment and cannot infer much about it from the works themselves. In discussing Shakespeare’s thought, then, we merely guess at a plausible set of circumstances or deal with our own behavior in responding to the works. This is not very satisfactory, but we cannot improve the situation by identifying thought with mere form of behavior. (Skinner VB) Das ist auch der entscheidende Einwand gegen jede strukturalistische, auf die Form beschränkte, unhistorische oder nicht-genetische Zeichentheorie. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 29.04.2019 um 00.22 Uhr |
|
"Gerade nicht" ist anscheinend eine Antwort auf meinen letzten Beitrag, aber ich verstehe leider nicht, was genau damit gemeint ist. Das Argument der Zeicheninflation leuchtet mir immer noch nicht ein. Ich bin nicht sicher, ob de Saussure sich auch mit ganz allgemeinen Zeichen beschäftigt hat, ich denke, es geht bei ihm vor allem um sprachliche Zeichen. Damit hat er aber bereits eine Grundmenge festgelegt, und zwar sprachliche Ausdrücke. Ist nicht tatsächlich jeder sinnvolle sprachliche Ausdruck ein sprachliches Zeichen? Eine Zeicheninflation ist da gar nicht möglich. Sobald ein Laut einen Sinn hat, also verstanden wird, ist er eben ein sprachliches Zeichen. Will man nun den bilateralen Zeichenbegriff ganz allgemein definieren, kann man nicht einfach sagen, alles, was eine Bedeutung hat, ist ein Zeichen. Ich frage noch einmal (wie in 1240#41323), sagt de Saussure wirklich, oder wer sagt das, daß hinter jeder beliebigen Bedeutung ein Zeichen steckt? Falls es jemand so sagt, wäre das natürlich falsch, aber das wäre m. E. nicht das Ende des bilateralen Zeichenbegriffs, als das Sie es ausgeben, lieber Prof. Ickler. Man muß eben zuerst genau festlegen, was man unter einem Zeichen verstehen will. Das ist dann die Zeichendefinition. Die Eigenschaft, daß jedes Zeichen eine Form und eine Bedeutung hat, kann dann aus dieser Definition abgeleitet werden, aber es ist nicht die Definition, zumindest nicht allein. Etwas ähnliches tun Sie ja auch, lieber Prof. Ickler, wenn Sie über das Verhalten bestimmen, welche Anzeichen wirkliche Zeichen sind. Vielleicht ist dieser Weg sogar der beste, nur, warum sollte man anschließend bestreiten, daß jedes so erkannte Zeichen eine Form- und eine Bedeutungsseite hat? Jedes Zeichen kann man wahrnehmen, das ist seine Formseite, und man kann es im nachfolgenden Verhalten berücksichtigen, das ist seine Inhalts- oder Bedeutungsseite. Ist das nicht das logischste von der Welt? |
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 28.04.2019 um 10.28 Uhr |
|
Franck Ribérys aufsehenerregendes Goldsteak war gewiß als Zeichen gedacht. Zugleich war es ein Anzeichen für unbekümmerte Einfalt.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.04.2019 um 10.05 Uhr |
|
Gerade nicht! Anzeichen sind keine Zeichen (wg. Zeicheninflation, was ja nur die andere Seite der Medaille ist: Wenn Anzeichen Zeichen wären, dann wäre alles und nichts Zeichen, weil man aus allem etwas anderes erschließen kann, aber nicht muß). Ich gebe zu, daß meine Ansicht etwas ungewohnt ist, und bemühe mich die ganze Zeit, mir selbst darüber klar zu werden. Außerdem habe ich die Sache noch kompliziert, weil ich einen Fall gebracht habe, bei dem ich durch mein üppiges Schmausen unbeabsichtigt eine Botschaft ausgesandt habe. Den armen Leuten ist trivialerweise klar, daß sie sich das teuere Steak nicht leisten können, aber sie könnten mein Essen auch noch so auffassen, als wollte ich ihnen den Unterschied hinreiben... |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 28.04.2019 um 09.43 Uhr |
|
Man kann also nie allgemein von einem Zeichen sprechen (nicht: Das Steak ist ein Zeichen), sondern immer nur in einem bestimmten Sinnzusammenhang (Das Steak ist für arme Leute ein Zeichen von Reichtum). Für andere bedeutet die Sache entweder gar nichts (ist kein Zeichen) oder es bezeichnet etwas anderes (anderes Zeichen).
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.04.2019 um 05.43 Uhr |
|
Ich kann ein Steak essen, um satt zu werden. Ich kann aber damit gleichzeitig demonstrieren, daß ich reich genug bin, mir ein Steak zu leisten, zum Beispiel als Botschaft an die armen Schlucker, die sich am Restaurantfenster die Nasen plattdrücken und sich das Steak nicht einmal von einem Monatsgehalt leisten könnten. (Schon erlebt, wenn auch als unfreiwilliger Sender.) Zahavi hat Veblens „conspicuous consumption“ als „handicap principle“ in die Evolutionsbiologie eingeführt: zeichenhafter Überbau über vitalen Funktionen. Pfauenrad usw. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.04.2019 um 05.34 Uhr |
|
Vor einigen Jahren berichtete Wolfgang Raible über ein Freiburger Symposium über “Information –
Ein Schlüsselbegriff für Natur- und Kulturwissenschaften". Das Symposion hat gezeigt, dass von den sieben Disziplinen, die beteiligt waren, im Grund nur die Jurisprudenz mit dem Informationsbegriff arbeitet, der sich in der Allgemeinsprache eingebürgert hat. Sowohl für die drei Disziplinen, die sich unmittelbar auf die Informationstheorie bezogen haben (Biologie, Physik und Informatik) wie auch für die Biochemie und die Physiologie, hat sich dagegen die Informationstheorie als entscheidend wichtig erwiesen: es geht um eine berechenbare, messbare Informationsmenge... Weniger vornehm ausgedrückt: Die Teilnehmer haben großenteils aneinander vorbeigeredet. Das hätte man vorhersagen können, und es ist für Veranstaltungen unter solchen Sammelbegriffen nicht ungewöhnlich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.03.2019 um 16.35 Uhr |
|
Mit dem Rorschachtest ist es wie mit der Psychoanalyse. Man kann sie nach dem gegenwärtigen Stand evaluieren (was beidesmal vernichtend ausfällt) oder sich mit ihrer Entstehungsgeschichte beschäftigen (was zwar nicht entscheidend ist, denn auch ein blindes Huhn könnte mal ein Korn gefunden haben, aber doch ziemlich erstaunliche Dinge zutage fördert). Mit Religionen verhält es sich ähnlich. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 27.03.2019 um 16.01 Uhr |
|
Die Symmetrie ist wegen der Einschränkung auf symmetrische Gegenstände ziemlich störend. Ich frage mich, warum die Psychologen nicht einfach nach der Herstellung einer Klecksographie eine Hälfte abschneiden. Da könnten sich Deuter und Deutungsdeuter viel mehr austoben.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.03.2019 um 07.15 Uhr |
|
Das stimmt, und in diesem Sinne könnte man offenlassen, daß einige Probanden die Gebilde wirklich für gegenständliche Malerei halten. Sehr wahrscheinlich ist es nicht und würde auch am Kern nichts ändern. Übrigens haben die klappsymmetrischen Rorschach-Gebilde die erwartbare Folge, daß Probanden besonders häufig eine Fledermaus oder einen Schmetterling zu erkennen meinen. (Der Rorschachtest genügt den üblichen Kriterien der Textgüte nicht im geringsten, aber die Psychologen sind immer sehr froh, wenn sie überhaupt einen Test in der Hand haben. Ihr Ärger, als die Rorschach-Bilder samt Standarddeutungen veröffentlicht wurden, läßt auch tief blicken. Seither behaupten sie, der Test sei erst dadurch unbrauchbar geworden.) |
Kommentar von R. M., verfaßt am 26.03.2019 um 20.03 Uhr |
|
Der Proband muß nicht notwendigerweise wissen, wie die Bilder zustandegekommen sind, ist also nicht unbedingt am Verstellungsspiel beteiligt.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.03.2019 um 17.30 Uhr |
|
Klecksographien (Ausdruck von Justinus Kerner, auch ins Englische entlehnt) sind semiotische Grenzfälle. Durch gelenkten Zufall entstanden, werden sie zwar gedeutet, sind aber nicht auf Deutung hin angelegt, sondern grundsätzlich wie Kaffeesatz, Vogelflug, Sprünge in Schildkrötenpanzern usw. aufzufassen. Deutbare Gestalten werden in Vorlagen von hoher Unwahrscheinlichkeit hineinprojiziert. Gemäß Aufforderung deutet der Proband oder Patient (im Rorschach-Test, der bezeichnenderweise „projektiv“ genannt wird) die Kleckse nicht als Botschaften (Mitteilungen), sondern als Bilder. Bilder sind entweder gegenständlich (Abbildungen bzw. Darstellungen von etwas anderem) oder ornamental. Die Zeichnung eines Bisons an einer Höhlenwand ist eine Simulation. Sie ist gewissermaßen der Bison selbst, jedoch in diesem besonderen Modus der Simulation – zugleich defizient gegenüber dem Original (man kann darum nicht auf ihn schießen, braucht auch nicht vor ihm wegzulaufen) und um neue Möglichkeiten bereichert (man kann das Bild z. B. rituell nutzen oder sich ästhetisch daran erfreuen, wie es mit dem Original nicht möglich wäre). Die Simulation ist an sich kein Zeichen, kann aber in zeichenhaftes Verhalten eingebaut werden. Die Muster im Koffer eines Handlungsreisenden sind Teil des Kaufangebots, also eines zeichenhaften Verhaltens. Klecksographien sind spielerische Abbildungskandidaten; spielerisch deshalb, weil alle Beteiligten wissen, wie sie zustande gekommen sind, nämlich nicht wie wirkliche Abbildungen; Kandidaten deshalb, weil die Deutung als Abbildung nur in Gang kommt, wenn man vorweg annimmt oder spielerisch anzunehmen vorgibt, daß es überhaupt Abbildungen sind. ("Spielerisch" bedeutet also hier Verstellungsverhalten.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.03.2019 um 05.05 Uhr |
|
„Die präverbale Bedeutungsstruktur (...) muß alle Informationen enthalten, die eine Übersetzung in eine sprachliche Oberflächenstruktur erlauben.“ (Günther Görz (Hg.): Einführung in die künstliche Intelligenz. Bonn u.a. 1993:510) Wieso „präverbal“ und dann „Übersetzung“? Es läuft dann auf eine angeblich nicht sprachliche, sondern „propositionale Repräsentation“ hinaus. Aber das „Übersetzen“ verrät den Trick. Ebenso mysteriös, mit "Mapping" statt "Übersetzung": „Sprachverstehen kann als der Prozeß oder die Funktion beschrieben werden, die die physikalische Form einer sprachlichen Äußerung auf die Repräsentation ihrer Bedeutung abbildet.“ (342) „Die Funktion des Sprachverstehens ist die Abbildung einer sprachlichen Äußerung in physikalischer Form auf eine mentale Repräsentation ihrer Bedeutung.“ (350) Diese Psychologie ist Prüfungsstoff, wie ich als Beisitzer erlebt habe. Obwohl mir dabei ganz kribbelig wurde, konnte ich natürlich meine grundsätzlichen Bedenken nicht anbringen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.03.2019 um 06.34 Uhr |
|
Nach Elisabeth Leiss im Duden-Band „Grammatik wozu?“ sind Bedeutungen im Gehirn gespeichert. Das ist die neurosophische Fassung von: „Sprecher wissen, wie man die Wörter verwendet.“ Und das haben wir uns schon gedacht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.01.2019 um 06.48 Uhr |
|
Die Warntracht der Wespen könnte man zeichenhaft nennen. „Gelernt“ ist bei Freßfeinden das Muster, ähnlich einem Geruch, der anziehend oder abstoßend wirken kann. Mustererkennung ist fürs Überleben notwendig. Die gelbschwarze Warnfärbung der Wespe tut dem Feind gewissermaßen ebenso weh wie der Stachel; es ist aber für beide Seiten besser, wenn der Stachel gar nicht erst zum Einsatz kommt. (Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Warnfarbe) Anders gesagt und an das Handlungsschema angeglichen (s. „Naturalisierung der Intentionalität“): Nicht die wirkliche Ungenießbarkeit oder die Gefahr durch den Stachel schreckt die Freßfeinde ab, sondern die vorgeschaltete Musterung. Die Wespe „rät ab“, wenn sich der Freßfeind nähert und seine „Absicht“ kundtut. Die Äquivalenz von Warnfarbe und Stachel könnte dazu führen, auch den Stachel bzw. den Stich als Zeichen aufzufassen. Ebenso den bitteren Geschmack und das Gift, mit dem sich Pflanzen und Tiere wehren. Sie sind alle durch empfängerseitige Semantisierung entstanden (also durch ihre Wirkung selektiert bzw. konditioniert). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.01.2019 um 06.45 Uhr |
|
Das Verhältnis zwischen einem Zeichen und dem Gegenstand, auf den es sich „bezieht“, wird hauptsächlich in zwei Weisen modelliert: Entweder ist das Zeichen ein vom Gegenstand ausgehender Eindruck oder Abdruck; dann muß das Original irgendwie und irgendwo existieren. Oder das Zeichen zielt gewissermaßen auf einen Gegenstand wie der Pfeil auf die Schießscheibe; auch dann muß das Ziel irgendwie und irgendwo existieren. Bei Individuenbezeichnungen (Eigennamen, Kennzeichnungen) scheint der Fall klar, aber wie steht es mit Allgemeinbegriffen, Prädikaten? Das ist das sogenannte Universalienproblem, das von Platons Ideenlehre über den scholastischen Universalienstreit (mit theologischen und daher auch machtpolitischen Implikationen) bis in die Gegenwart (vor allem Philosophie der Mathematik) die besten Köpfe beschäftigt hat. Aus naturalistischer Sicht ist es ein Scheinproblem, verursacht durch die naive referentielle Zeichentheorie. Entledigt man sich dieser Auffassung, läßt sich das Problem gar nicht mehr formulieren. „Das Universalienproblem (...) betrifft die Frage, ob es ein Allgemeines wirklich gibt oder ob Allgemeinbegriffe menschliche Konstruktionen sind.“ (Wikipedia Universalienproblem) Es gibt weder ein Allgemeines noch Allgemeinbegriffe (und Begriffe überhaupt), sondern nur eine verallgemeinernde Redeweise als besondere Verständigungstechnik. „In metaphysics, a universal is what particular things have in common“ (...) (Wikipedia Universals) Diese und ähnliche Formulierungen legen die Vorstellung nahe, daß es ein Etwas gebe, das die Gegenstände gemein haben. Mit dieser Vergegenständlichung ist man bereits in die Sackgasse geraten. „Paradigmatically, universals are abstract (e.g. humanity), whereas particulars are concrete (e.g. the personhood of Socrates). However, universals are not necessarily abstract and particulars are not necessarily concrete. For example, one might hold that numbers are particular yet abstract objects. Likewise, some philosophers, such as D. M. Armstrong, consider universals to be concrete.“ Offensichtlich ein Streit um unklare herkömmliche Worte. Zur Definition des Abstrakten könnte die Sprachwissenschaft beitragen (s. „Namen für Satzinhalte“). Zahlen sind aus dieser Sicht nicht abstrakt. Das scheint nur aus der Sicht einer gewissen „Metaphysik“ anders, die das Abstrakte als irgendwie nicht-sinnlich auffaßt. Schon die Voraussetzung einer zweiten Welt (des „Intelligiblen“ o. ä.) ist als ein Mißverständnis aufzuklären. Ein Abstraktum (Pl. Abstrakta; lateinisch nomen abstractum, von abstractus (-a, -um) „abgezogen“) ist in der Grammatik und Sprachwissenschaft ein Substantiv, mit dem etwas Nichtgegenständliches bezeichnet wird. Beispiele für Abstrakta sind der Glaube, die Liebe, die Hoffnung, der Stress, die Höflichkeit oder der Sozialstaat. Als Gegenbegriff gilt das Konkretum, etwas Dingliches. (Wikipedia) Nein, das ist nicht der sprachwissenschaftliche Begriff von Abstraktheit, auch wenn viele Sprachwissenschaftler sich dieser metaphysischen Tradition anschließen, d. h. sich nicht um eine wirklich sprachwissenschaftliche Betrachtungsweise bemühen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 26.01.2019 um 22.19 Uhr |
|
Ich glaube schon die Einwände gegen meine Darstellung zu kennen: Was "bewegt" sich denn im Mentalen? Da gibt es ja nichts. Aber irgendeine Art von geistiger Bewegung (die somit den Ausdruck "Geschicklichkeit" auch im Geiste rechtfertigt) muß doch stattfinden!? Was ist denn "denken", wenn sich nichts bewegt? Natürlich ist es ein Kategorienproblem. Aber irgendeine Verbindung muß es einfach geben. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 26.01.2019 um 20.03 Uhr |
|
Keine Geschicklichkeit ist im Spiel? Sie meinen die Geschicklichkeit in bezug auf physische Bewegungen. Ist das etwas prinzipiell anderes als die Geschicklichkeit in bezug auf geistige Bewegungen bzw. mentale Berechnungen? Man nennt es wohl entweder Sport oder Denksport. Na ja, vielleicht gibt es doch einen Unterschied. Jeder Gedanke ist so etwas wie eine Aussage, kann nur wahr oder falsch sein. Das kann man von physischen Bewegungen nicht sagen. Also sind geistige Bewegungen sehr determiniert, aber physische Bewegungen sehr vom Zufall abhängig? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.01.2019 um 10.31 Uhr |
|
Natürlich war es nur eine Frage der Zeit, bis Computerprogramme besser Schach und Go spielen würden als jeder Mensch. Schach und Go sind vollständig mathematisch, keine Geschicklichkeit ist im Spiel, keine Zufälle wie Bodenunebenheiten oder Luftströmungen. Die „Kreativität“ ist rein kombinatorisch. Sprechen ist gemischt, daher teils simulierbar, teils unbestimmt-aleatorisch. (Teils wie Schach, teils wie Mikado oder Tischtennis...) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.01.2019 um 03.53 Uhr |
|
Von Information ist die Rede, wenn man bei ähnlichen Makrostrukturen verschiedene Mikrostrukturen unterscheiden kann. Zum Beispiel ist mein Hausschlüssel dem deinen zum Verwechseln ähnlich, aber der meine öffnet meine Haustür, der deine nicht. Ich würde in diesem Fall nicht zögern, von Information zu reden, die in der Mikrostruktur (im „Bart“) des Schlüssels enthalten ist. Mein Schlüssel kann etwas, was der deine nicht kann, nicht etwa weil er „stärker“ wäre als der deine, sondern weil er eine bestimmte Information überträgt, die vom Schloss „verstanden“ wird. (Valentin Braitenberg: Das Bild der Welt im Kopf: Eine Naturgeschichte des Geistes. Stuttgart 2009:88) Wenig später äußert Braitenberg Bedenken, ob man in der unbelebten Welt von Information sprechen kann, aber im Fall des Schlüssels scheint er solche Bedenken nicht zu haben, weil Schlüssel und Schloß künstlich hergestellt sind. (Er nennt diesen Grund allerdings nicht.) Vielleicht bringt es in irgendeiner Hinsicht einen Vorteil, das Passen eines Schlüssels ins Schloß in informationstheoretischen Begriffen darzustellen. Begrifflich sparsamer ist die Auffassung als geometrisch-mechanisch. Das Kind lernt, daß bestimmte hölzerne Teile (Sterne, Dreiecke, Scheiben) nur in bestimmte Aussparungen passen. Es ist unnötig, von Informationen zu sprechen, die in den Teilen enthalten sind und an die Aussparungen übertragen werden. Auf einer waagerechten Tischplatte bleibt eine Kugel liegen, von einer schrägen rollt sie herunter. Information ist dabei nicht im Spiel. Erst bei einem gewissen Komplexitätsgrad scheint die Versuchung aufzutreten, von Information zu sprechen. Braitenberg legt später dar, daß lebende Materie als informationshaltig dargestellt werden könne, offenbar wegen der Anpassung. Wieder einmal dient, wie Skinner sagen würde, Bedeutung als Surrogat für Geschichte. Weil die Geschichte (Evolution) phänomenal nicht greifbar ist, packt man ihren Ertrag, die Anpassung, in den Begriff Bedeutung bzw. Information. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.12.2018 um 09.09 Uhr |
|
Nach Russells Theorie der Namen, die auch heute noch vertreten wird, steht der Name Odysseus für nichts, weil Odysseus nicht existiert hat. Nun stehen Wörter sowieso nicht "für etwas", aber auch abgesehen von dieser archaischen Sprachauffassung gibt es semiotisch keinen Unterschied zwischen Odysseus und Sokrates. Beide sind nur durch Textketten ("intraverbal" im Sinne Skinners) überliefert. Daß Sokrates existert hat und Odysseus wohl nicht, ist eine zusätzliche Tatsache, die mit dem Funktionieren der Sprache nichts zu tun hat. Ob ein gewisser Jesus aus Nazareth existiert hat, interessiert Theologen, nicht Linguisten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.12.2018 um 09.18 Uhr |
|
Eine Semiose ist dadurch gekennzeichnet, daß A einem Zeichen B die Bedeutung C zuordnet; eine Zoosemiose liegt dann vor, wenn A ein Tier ist. Sie kann in einer einfachen Reaktion auf einen Umweltreiz bestehen, etwa dann, wenn ein Regenwurm sich vom Licht abwendet. (...) Bei Semiosen von Tieren sprechen wir von einem „Anzeichen“, wenn es beim Zeichenempfänger zu einem Verhalten führt, das nicht als einfache Reizantwort anzusehen ist. Das Zappeln der Beute im Netz der Spinne ist für diese ein Anzeichen, auf dessen Botschaft („hier ist ein Insekt, das sich zu befreien sucht“) sie entsprechend ihrem jeweiligen Hungerzustand sowie je nach Art und Größe der Beute angemessen reagiert; sie handelt so, als ob das Anzeichen bei ihr zur Bildung einer Vorstellung geführt hätte. (Werner Schuler in HSK Semiotik 1, S. 523) Danach wäre jede Reaktion auf einen Reiz Zeichenverhalten. Es gibt keinen Grund, das auf Organismen zu beschränken. Man kann auch das „Verhalten“ eines Steins unter der Schwerkraft semiotisch deuten, wie in Schopenhauers Karikatur. Was ist eine „einfache Reaktion“, eine „einfache Reizantwort“? Ein Reflex? Das Reden von Vorstellungen ist völlig überflüssig, auch wenn es nur ein „Als-ob“ sein sollte. Es gibt hier kein Zeichen, keine Botschaft usw. Der große Umfang der Abteilung „Semiotik“ in den „Handbüchern zur Sprach- und Kommunikationsforschung“ (HSK) beruht auf dem „semiotischen Imperialismus“ der Richtung Eco, Sebeok, Posner usw., also auf einem unklaren Zeichenbegriff. |
Kommentar von Theodor ickler, verfaßt am 22.12.2018 um 05.03 Uhr |
|
Laut dem Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure (1857-1913) ist jedes sprachliche Zeichen bilateral. Es besteht aus zwei Aspekten, einer Ausdrucks- und einer Inhaltsseite. Die Ausdrucksseite ist der Signifikant, er spiegelt sich im Laut- oder Schriftbild wider. Die Inhaltsseite stellt das Signifikat dar, also das begriffliche Konzept eines Zeichens. (http://www.glottopedia.org/index.php/Signifikant_vs._Signifikat) Der ganze Irrsinn in kürzester Form. Schon begrifflich unmöglich: Etwas kann nicht aus zwei Aspekten „bestehen“. Die Inhaltsmetapher verträgt sich nicht mit der Metaphorik der zwei „Seiten“, aber diese Bildmischung wird auch sonst gar nicht mehr bemerkt. Was Widerspiegelung hier bedeuten soll, ist völlig rätselhaft. Und dann wird noch das zwar doppelt gemoppelte, aber trotzdem unverständliche „begriffliche Konzept“ eingeführt, das in den meisten Fällen eine zweite Sprache hinter der Sprache zu sein scheint, aber ohne Klarheit über die Voraussetzungen einer solchen Annahme (Homunkulus usw.). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.12.2018 um 17.27 Uhr |
|
Ich greife aus dem Haupteintrag noch einmal auf: „Wir haben beim Kreislauf des Sprechens gesehen, daß die im sprachlichen Zeichen enthaltenen Bestandteile alle beide psychisch sind, und daß sie in unserem Gehirn durch das Band der Assoziation verknüpft sind. (...) Das sprachliche Zeichen vereinigt in sich nicht einen Namen und eine Sache, sondern eine Vorstellung und ein Lautbild.“ (Ferdinand de Saussure: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Berlin 1967:77) „Stellen wir uns vor, daß eine gegebene Vorstellung im Gehirn ein Lautbild auslöst: das ist ein durchaus psychischer Vorgang, dem seinerseits ein physiologischer Prozeß folgt: das Gehirn übermittelt den Sprechorganen einen Impuls, der dem Lautbild entspricht“ usw. (ebd. 14) Was immer er wirklich gesagt hat – in dieser Form ist es rezipiert und nachgesprochen worden. Wie man sieht, ist ein so definiertes Zeichen überhaupt nicht verwendbar, da alles rein psychisch sein soll. Es ist auch bewußtseinsfremd, d. h. der Sprecher weiß nichts von solchen theoretischen Konstrukten – wie kann er sie „benennen“? Vor allem aber: Es geht nicht um das Zeichen, sondern um eine spekulative (und sehr konventionelle) psychologische Theorie der Zeichenverarbeitung. Wie man das je verwechseln konnte, ist ziemlich rätselhaft. |
Kommentar von ppc, verfaßt am 18.12.2018 um 14.28 Uhr |
|
>Auf der Rückseite eines Verkehrszeichens steht aber meistens gar nichts. Doch: „Made in R.O.C.” |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.12.2018 um 17.09 Uhr |
|
Anderswo habe ich schon aus der dummen Dummie-Grammatik von Matthias Wermke zitiert: Wie jedes Verkehrszeichen, Hinweisschild oder Warnsignal haben auch die sprachlichen Zeichen zwei Seiten, nämlich eine Ausdrucksseite und eine Inhaltsseite. (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1044#29031) Ist das nicht ein komischer Vergleich? Auf der Rückseite eines Verkehrszeichens steht aber meistens gar nichts. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 11.12.2018 um 23.56 Uhr |
|
Jetzt verstehe ich, und ich glaube nun auch den Widerspruch zwischen A. Assmann und Ihnen zu sehen. Sie verwenden jeweils den Ausdruck "verweisen auf" in einem anderen Zusammenhang. Assmann sagt, die Eingeweide verweisen auf Schicksale, sie verwendet "verweisen auf" ähnlich wie ich synonym zu "stehen für", nämlich zwischen den beiden Seiten des Zeichens. Sie, lieber Prof. Ickler, verwenden jedoch "verweisen auf" ausschließlich innerhalb der Bedeutungsebene des Zeichens. Man könnte die beiden Lesarten anhand Ihres Wegweiser-Beispiels so zusammenbringen: Die Bedeutung ist: Spardorf ist dort, wohin der abstrakt dargestellte Pfeil zeigt/verweist (Ickler). Das Zeichen Wegweiser steht für/verweist auf (Assmann) ebendiese Bedeutung, die Richtungsangabe. Assmann hätte sicher nicht doppelt gemoppelt: "Das Zeichen verweist auf eine Richtungsweisung." Da würde "steht für" besser passen. Aber für ihr eigenes Beispiel mit den Eingeweiden paßt das Verweisen ganz gut. Sie meint ja damit nicht wörtlich-bildhaft die Zeigegeste, sondern nur in übertragenem Sinne die bilaterale Zusammengehörigkeit von Zeichen und (Be-)Deutung. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.12.2018 um 17.03 Uhr |
|
Laien sind wir auf diesem Gebiet alle, und es ist auch nicht so, daß es hier einen fachlich normierten Sprachgebrauch gäbe, in den Sie, lieber Her Riemer, nicht eingeweiht wären. Ich habe nur (inzwischen an unzähligen verstreuten Stellen) deutlich zu machen versucht, daß es sinnvoll ist, beispielsweise zwischen "für etwas stehen" und "auf etwas verweisen" einen Unterschied zu machen, auch wenn er im alltäglichen Reden nicht oder nicht immer gemacht wird. Das Verweisen ist in vielen Fällen einem Zeigen ähnlich, darum habe ich auch den Wegweiser erwähnt. Die Zeiggeste ist sicherlich grundverschieden von einer Stellvertreterschaft, nicht wahr? Damit wären wir schon ein Stück weiter. Mein nächster Punkt: Die Zeiggeste (und abgleitet der Wegweiser) ist ein Zeichen im strengen Sinn. Stellvertreter sind keine Zeichen. Sie gehören in den Zusammenhang der Simulationspiele. Der Klotz, den das Kind mit "puffpuff" hinter sich herzieht, vertritt eine Lokomotive. Er ist aber kein Zeichen für eine Lokomotive, sondern bis zu einem gewissen Grade diese selbst. (Das "bis zu einem gewissen Grade" ist entscheidend.) Noch das vielerörterte Männchen auf der Klotür (s. meinen Aufsatz "Wirkliche Zeichen", zu Rudi Keller) ist ein Stellvertreter. Man sieht, daß die Toilettenanlage von einem Mann benutzt wird, wenn auch arg stilisiert. Der Fall zeigt auch, daß Stellvertreter konventionell in einen Zeichenverkehr eingebaut werden können, vgl. Wittgensteins "Boxer", der hier schon erörtert wurde. Das ist eine sekundäre Verwendung von Abbildern, Mustern, Repräsentanten, eben Simulationen im weitesten Sinn als Zeichen oder Teile von Zeichen. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 11.12.2018 um 15.42 Uhr |
|
Mutter: Dieses Tier ist ein Schwein. Kind: Was hat es denn getan? |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 11.12.2018 um 11.22 Uhr |
|
Es könnte sein, daß ich sinngemäß von Repräsentation gesprochen habe, was natürlich an meiner naiven (laienhaften) Herangehensweise liegt. Es reicht aber in der Zeichentheorie offenbar nicht, Deutsch zu können, sondern Begriffe wie bedeuten, vertreten, stehen für/anstelle von, verweisen auf usw., die ich im Grunde alle synonym benutze, haben einen ganz streng definierten Anwendungsbereich. Da kann ich natürlich nicht mithalten. Ich glaube einfach (und nur deswegen wage ich überhaupt mitzudiskutieren), daß man auch mit dem ganz normalen sog. gesunden Menschenverstand ungefähr verstehen können muß, was ein Zeichen ist. Wenn ich also das Selbstverständliche weiß, nämlich daß das Wort "Fuchs" nicht der leibhaftige Fuchs ist, dann spielt es doch keine Rolle mehr, ob ich nun sage "Fuchs" verweist auf einen Fuchs, "Fuchs" vertritt den Fuchs, "Fuchs" bedeutet das Tier Fuchs, "Fuchs" steht/ertönt für einen Fuchs, ... Für mich gibt es ein Zeichen "Fuchs", ich kenne dessen schriftliche und phonetische Form, und ich kenne die Bedeutung dieses Zeichens. Es kommt mir halt als Laie sehr wortklauberisch vor, darüber zu streiten, mit welchem Verb diese beide Seiten des Zeichens nun genau miteinander in Verbindung gebracht werden. Ich versuche auch, den behavioristischen Standpunkt zu verstehen. Das Zeichen "Fuchs" wird erklärt als ein menschliches sprachliches Verhalten (was man wohl noch in Zeichengeben und Zeichenempfangen unterteilen muß). Soweit leuchtet mir das ohne weiteres ein. Aber negiert diese Sicht denn das bilaterale Verständnis? Es bleibt doch trotzdem dabei, daß jedes Zeichen, also jedes sprachliche Verhalten, eine inhaltliche Form und eine Bedeutung hat, oder? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.12.2018 um 04.30 Uhr |
|
Das wäre in der Tat trivial, aber von Identität war ja auch nicht die Rede, damit verderben Sie die Pointe. Es geht um Stellvertretung. Zeichen als Stellvertreter – das ist eine uralte, geradezu ehrwürdige Sprachtheorie. Und hatten Sie sich nicht selbst für "Repräsentation" ausgesprochen? Da geht es doch auch nicht um Identität. Stellvertreterschaft gibt es als magische Komponente der Zeichen. Nach viktorianischen Moralvorstellungen mußten Tische so verhängt werden, daß die B...e nicht sichtbar waren und anständige Damen an wirkliche B...e erinnern konnten; auch das Wort B... ließ die Menschen erschauern und wurde vermieden. Guilty by association (Metonymie) war dann auch Hose usw. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 10.12.2018 um 16.24 Uhr |
|
Ich bin verblüfft, wie viele Worte man doch für den absolut trivialen (dachte ich) Sachverhalt machen kann, daß das Bild eines geschriebenen oder der Ton eines gesprochenen Wortes, also ein Zeichen, nicht mit dem bezeichneten Gegenstand identisch ist.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.12.2018 um 14.21 Uhr |
|
Mein Einwand betrifft die stillschweigende Ersetzung von "stehen für" durch "verweisen auf". Das sind völlig verschiedene Dinge. Die Stellvertreterschaft kann man vergessen, das ist von der sprachanalytischen Philosophie gründlich widerlegt. Und das Verweisen müßte anders erklärt werden; es wird aber gar nicht erklärt, als sei das mit dem naiven "stehen für" schon erledigt. Für eine wirkliche Erklärung siehe meine Abhandlung "Naturalisierung der Intentionalität". Vgl. auch Skinner: John B. Watson meinte in diesem Sinne, daß „Wörter in derselben Weise Reaktionen hervorrufen wie die Gegenstände, für die sie stellvertretend eingesetzt werden.“1 Er zitiert Swifts Erzählung von dem Mann, der einen Sack voller Gegenstände trug, die er vorzeigte, anstatt in Wörtern zu sprechen. (87) „Der Mensch erwirbt früh für theoretisch jeden Gegenstand einen sprachlichen Stellvertreter in sich selbst. Danach trägt er die Welt in Gestalt dieses Apparates mit sich herum.“ Aber diese Welt ist natürlich einigermaßen nutzlos. Er kann Sandwich nicht essen und mit Klauenhammer keinen Nagel herausziehen. Es ist eine oberflächliche Analyse, die noch zu sehr der traditionellen Vorstellung verhaftet ist, die Wörter „stünden für“ Dinge. Derselbe Einwand kann gegen die Deutung des Hörerverhaltens vorgebracht werden, die Bertrand Russell in seiner „Untersuchung über Bedeutung und Wahrheit“ gibt: „Angenommen, jemand in Ihrer Begleitung sagt plötzlich Fuchs, weil er einen Fuchs sieht, und weiter angenommen, daß Sie ihn zwar hören, aber den Fuchs nicht sehen. Welche Wirkung hat es dann auf Sie, daß Sie das Wort Fuchs verstanden haben? Sie sehen sich um, aber das würden Sie auch getan haben, wenn er Wolf oder Zebra gesagt hätte. Vielleicht haben sie eine Vorstellung von einem Fuchs. Was aber vom Beobachterstandpunkt aus zeigt, daß Sie das Wort verstanden haben, ist, daß Sie sich (innerhalb gewisser Grenzen) so verhalten, als ob Sie selbst den Fuchs gesehen hätten. Allgemein gesagt: Wenn Sie ein Gegenstandswort hören und verstehen, ist Ihr Verhalten in gewissem Maße so, als wenn der Gegenstand selbst es verursacht hätte. Das kann ohne ´mentale´ Vermittlung geschehen, durch die normalen Regeln der konditionierten Reflexe, nachdem das Wort mit dem Gegenstand assoziiert worden ist.“ Aber wir verhalten uns gegenüber dem Wort Fuchs, außer in einem begrenzten Sinn, nicht so wie gegenüber Füchsen. Wenn wir Angst vor Füchsen haben, wird der sprachliche Reiz Fuchs, den wir in Gegenwart von wirklichen Füchsen gehört haben, eine emotionale Reaktion hervorrufen. Sind wir auf der Jagd, wird er einen Zustand erzeugen, den wir freudige Erregung nennen. Möglicherweise kann, wie wir später sehen werden, das Verhalten, „einen Fuchs zu sehen“, nach demselben Schema interpretiert werden. Aber der sprachliche Reiz Fuchs führt nicht aufgrund von einfacher Konditionierung zu irgendeinem praktischen Verhalten, wie es gegenüber Füchsen angemessen wäre. Es kann, wie Russell sagt, dazu führen, daß wir uns umsehen, ebenso wie es der Reiz Wolf oder Zebra getan hätte, aber wenn wir einen Fuchs erblicken, sehen wir uns nicht um, sondern blicken auf den Fuchs. Nur wenn man die Begriffe Reiz und Reaktion in einem sehr weiten Sinn verwendet, kann man das Prinzip der Konditionierung als biologische Grundform der Symbolisierung betrachten. Das praktische Verhalten des Hörers in bezug auf den sprachlichen Reiz des Takts folgt derselben dreigliedrigen Beziehung, die wir schon bei der Untersuchung des Sprecherverhaltens verwendet haben. Wir können annehmen, daß in der Geschichte des von Russell beschriebenen Hörers der Reiz Fuchs eine Gelegenheit gewesen ist, umherzublicken und daraufhin einen Fuchs zu sehen. Wir können ferner annehmen, daß der Hörer ein aktuelles „Interesse“ daran hat, „einen Fuchs zu sehen“, daß also ein Verhalten, das vom Sehen eines Fuchses abhängt, stark ist und daß der Reiz, den das Erblicken eines Fuchses darstellt, bekräftigend wirkt. Der gehörte Reiz Fuchs ist der Anlaß, bei dem der Hörer sich oft umgedreht und umgeschaut hat und dafür durch das Sehen eines Fuchses bekräftigt worden ist. Technisch gesprochen, ist das Umdrehen und Umschauen eher ein diskriminativer Operant als ein bedingter Reflex. Der Unterschied ist wichtig. Der sprachliche Reiz Fuchs ist kein Ersatz für einen Fuchs, sondern eine Gelegenheit, bei der gewisse Reaktionen durch das Sehen eines Fuchses bekräftigt worden sind und wahrscheinlich weiterhin bekräftigt werden. Das Verhalten, das ein Fuchs hervorruft – Hinblicken oder Nachreiten – kann durch den sprachlichen Reiz nicht hervorgerufen werden, und es gibt daher keine Möglichkeit, Reize als Entsprechung von Zeichen oder Symbolen einzusetzen. Betrachten wir ein weiteres Beispiel. Wenn eine Köchin mit der einfachen Ankündigung Das Essen! einen bestimmten Stand der Dinge taktet, schafft sie einen sprachlichen Anlaß, sich mit Erfolg am Tisch niederzulassen. Der Hörer setzt sich aber nicht zum sprachlichen Reiz nieder oder verzehrt ihn. Die Art von Reaktion, die sowohl auf das Essen als auch auf den sprachlichen Reiz Das Essen! erfolgen kann, wird durch die nach der Pawlowschen Formel konditionierte Absonderung von Speichel verkörpert. Das praktische Verhalten des Hörers (dessen Folgen letzten Endes für die Entwicklung der sprachlichen Reaktion am Anfang der Kette verantwortlich sind) muß als diskriminativer Operant verstanden werden, der aus drei Gliedern besteht, von denen keine zwei dem Begriff eines Symbols entsprechen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 10.12.2018 um 13.31 Uhr |
|
Das Schicksal als (Be-)Deutung der Eingeweide im Sinne des bilateralen Zeichens finde ich schon in Ordnung. Mein Einwand gilt eigentlich nur für die beiden Beispiele, die ich dazu nicht für ganz adäquat halte.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 10.12.2018 um 11.39 Uhr |
|
Gehen Sie da nicht einen Schritt zu weit? Es wird doch gar nicht behauptet, die Eingeweide seien oder vertreten die Schicksale, auch nicht, die Planetenkonstellation sei oder vertrete die Unternehmung, und auch nicht, der Wegweiser stünde anstelle von Spardorf. Die Eingeweide sagen etwas ÜBER die Schicksale, die Planetenkonstellation etwas ÜBER den Verlauf der Unternehmung und der Wegweiser etwas ÜBER die Richtung und evtl. Entfernung nach Spardorf. In diesem Sinne sehe ich zur herkömmlichen Zeichendefinition den Widerspruch nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.12.2018 um 09.55 Uhr |
|
Aleida Assmann geht von der bekannten Zeichendefinition aus: Aliquid stat pro aliquo. Gleich darauf sagt sie: „(...) auch konkrete Zeichen – wie z. B. die Eingeweide eines Opfertiers – können auf unsichtbare und noch nicht in die Wirklichkeit eingetretene Schicksale verweisen.“ (Aleida Assmann: „Zeichen – Allegorie – Symbol“ In: Jan Assmann (Hg.): Die Erfindung des inneren Menschen. Gütersloh 1992:28-50, S. 28) Hier wird also die Stellvertreterschaft ohne weiteres als Verweisen gedeutet. Aber die Eingeweide des Opfertiers vertreten in keinem vernünftigen Sinn die künftigen Schicksale. Eine Planetenkonstellation kann den Geschäftsmann anweisen, eine Unternehmung an einem bestimmten Tag zu beginnen, aber sie steht nicht anstelle dieser Unternehmung und vertritt sie nicht (was immer das heißen könnte). Ein Wegweiser mit der Aufschrift „Spardorf“ steht nicht anstelle von Spardorf; der Autofahrer steigt z. B. nicht aus, als sei er bereits in Spardorf, sondern verhält sich in entscheidender Hinsicht gerade so, als sei er noch nicht in Spardorf. Dieser Widerspruch wird durchgehend nicht bemerkt. Wie konnte das alles passieren? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.11.2018 um 17.29 Uhr |
|
Saussure ist für mich abgehakt, aber sein Vergleich wird bis heute nachgesprochen, ohne daß der interessante sachliche Unterschied erkannt würde.
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 22.11.2018 um 16.08 Uhr |
|
Auf den Einwand, daß man Schach auch mit Dame-Spielsteinen spielen könnte, mußte Saussure nicht gefaßt sein.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.11.2018 um 13.42 Uhr |
|
Saussure vergleicht die Sprache mit dem Schachspiel. Es kommt nicht auf die Form der Figuren an, sondern nur darauf, welchen Regeln sie folgen und daß sie voneinander unterscheidbar sind. Aber man könnte Schach auch mit lauter völlig gleichen Figuren spielen. Welche Züge jede einzelne machen darf, hängt davon ab, auf welchem Ausgangsfeld sie gestanden hat bzw. welche Züge sie bis zum jeweiligen Spielstand bereits ausgeführt hat (ihr „Schicksal“). Es erleichtert die Sache zwar für den menschlichen Schachspieler, für das Spiel selbst ist es irrelevant. (So könnte man auch menschliche Funktionsträger in unterscheidbare Uniformen stecken wie Soldaten, aber man könnte auch darauf verzichten.) (Wie verfolgt ein Schachcomputer die Identität der Spielfiguren?) Für die Sprache gilt das nicht: aaa aaa aaaaaaa aaaa aaa aaaaa kann nicht bedeuten „Für die Sprache gilt das nicht“. Schachfiguren sind Gegenstände mit einer Identität, darum können sie aus dem Spiel fliegen, wenn sie geschlagen sind. Man kann sie ersetzen, wenn sie beschädigt sind, aber gerade das beweist ihre Individualität. Verhaltensabschnitte vom Format eines Wortes kann man wiederholen, aber man kann sie nicht ersetzen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.11.2018 um 05.12 Uhr |
|
Zum vorigen vgl. Angelika Storrer/Eva Lia Wyss: „Pfeilzeichen: Formen und Funktionen in alten und neuen Medien“ In: Ulrich Schmitz/Horst Wenzel (Hg.): Wissen und neue Medien. Bilder und Zeichen von 800 bis 2000. Berlin 200:159–196. Die Abbildung eines Pfeils ist an sich noch kein Richtungsweiser, sondern eben das Bild einer Jagdwaffe. Zwar können nur Menschen zeigen, aber das bedeutet nicht, daß das Zeigen angeboren ist. Es kann eine kulturelle, also historische Verhaltensweise sein, auf der Grundlage elementarer, nun wirklich biologischer Eigenschaften des Menschen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.11.2018 um 05.02 Uhr |
|
Das heutige Google-Doodle gilt der Arecibo-Botschaft, die wie die schon erwähnte Pioneer-Plakette (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#28582) ein Denkanstoß für Semiotiker bleibt. Worauf könnte jedes "intelligente" (was ist das?) Wesen kommen, und was ist kulturspezifisch? Zu jener Plakette habe ich noch gefunden: One of the parts of the diagram that is among the easiest for humans to understand may be among the hardest for the extraterrestrial finders to understand: the arrow showing the trajectory of Pioneer. An article in Scientific American criticized the use of an arrow because arrows are an artifact of hunter-gatherer societies like those on Earth; finders with a different cultural heritage may find the arrow symbol meaningless. Ich habe ja schon oft auf die Sinnlosigkeit der Rede von "gerichteten Gegenständen" (Searle, Dennett) hingewiesen. Für die Naturalisierung der Intentionalität ist es nötig, sogar einen Pfeil (oder dessen stilisierte Abbildung) nicht als gerichtet zu betrachten, sondern als einen Gegenstand wie jeden anderen. Man muß sozusagen den Handlungszusammenhang des Schießens oder Werfens aus ihm wegdenken, wie es im Zitat angedeutet ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.11.2018 um 09.49 Uhr |
|
Immer ältere gegenständliche Felszeichnungen werden entdeckt. Wir wissen nicht und werden nie eindeutig wissen, welche Funktion sie hatten. Darum können wir auch nicht sagen, ob es Zeichen waren. Zunächst ist jede figürliche Darstellung eine Simulation, ein Als-ob. Man könnte davor "in effigie" gewisse Riten ausgeführt haben, "als ob" es sich um die dargestellten Wesen handelte. Das wäre eine magische Praxis. So betet man vor Ahnen- oder Heiligenbildern. Magisch ist auch das Sprachtabu und auf der anderen Seite das erwünschte Herbeirufen eines Wesens durch Aussprechen seines Namens. Überschneiden sich magische und Zeichenfunktion, oder ist die eine in der anderen enthalten? Verwandt ist die Mimikry, deren semiotische Einordnung auch noch umstritten ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.10.2018 um 04.21 Uhr |
|
Ich bestreite ja nicht, daß Zeichen eine Form und eine Funktion (Bedeutung) haben, sondern kritisiere nur die Mystifikation durch die Redeweise von zwei "Seiten", die außerdem noch beide "psychisch" sein sollen. Wie Skinner sagt: "Bedeutung ist ein Surrogat für Geschichte." Da weiß man wenigstens gleich, was man untersuchen muß. Als Radfahrer brauche ich mich ja um Verkehrszeichen nicht zu kümmern, aber ich glaube, ein roter Kreis auf weißem Grund bedeutet "Durchfahrt verboten". Nun, wer käme darauf, dieses Zeichen als Verbindung zweier psychischer Einheiten anzusehen, von denen die eine auf die andere verweist? |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 26.10.2018 um 14.00 Uhr |
|
Ich dachte, daß sich solche Gegenstände dadurch mit unter Verhalten einordnen lassen, daß man genaugenommen nicht sie selbst, sondern ihre Benutzung (Herstellung, Auswertung) als Verhalten betrachtet. Wenn die dem Zeichen zugrundeliegende Sache "semantisiert" sein muß, haben wir dann nicht gerade wieder den bilateralen Begriff, auf der einen Seite die Sache (Gegenstand, Merkmal, Verhalten), auf der andern Seite das Ergebnis der Semantisierung, also die Bedeutung? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.10.2018 um 12.19 Uhr |
|
Lieber Herr Riemer, eine endgültige Definition ist gerade das, wonach ich suche. Zunächst einmal muß ich aber sagen, daß ich keineswegs nur Verhalten als Zeichen ansehe, sondern natürlich auch Gegenstände wie Verkehrszeichen, Schwanzfedern usw. Der Kernpunkt ist, daß wirkliche Zeichen von anderen Mustern durch ihre Entstehung unterschieden werden müssen. Mein Zeichenbegriff ist also ein "historischer" oder "genetischer". Ein Gegenstand, ein Merkmal oder ein Verhalten muß "semantisiert" worden sein, was nicht heißt "gedeutet" (deuten kann man auch Fußspuren und Jahresringe), sondern durch diese Deutung in seiner Form oder seinem Auftreten (Frequenz) verändert und auf Dauer gestellt. Kurzum: es muß sein Dasein und Sosein gerade der Wirkung auf einen anderen Organismus verdanken. Das ist aber nur notwendig, nicht hinreichend, weil sonst jede Form der Koevolution und Symbiose ebenfalls zeichenhaft wäre. Zum Beispiel leben gewisse Ameisen mit Pilzkulturen zuasammen, die einen können nicht ohne die anderen. Dabei mögen auch (chemische, olfaktorische) Zeichen eine Rolle spielen, aber damit habe ich mich nicht beschäftigt. Die Symbiose selbst jedenfalls ist nicht zeichenhaft. Anders das Verhalten des Honiganzeigers: Davon hat der Honigdachs zunächst mal gar nichts, aber es führt ihn zum Bienennest, von dem er sich ernährt. Davon wiederum haben die Vögel zunächst auch nichts, aber wenn der plündernde Dachs abgezogen ist, können sie die Waben fressen, an die sie ohne den Dachs nicht herangekommen wären. Die teils grotesken Balztänze der Vögel haben mit der Fortpflanzung direkt nichts zu tun, signalisieren aber dem Weibchen, worum es geht, und genau deshalb wird bis zum heutigen Tage getanzt und gerade so. Die Übertragung auf die menschliche Rede dürfte leicht sein. Man sieht hier die Zwischenschaltung einer Ebene, auf der sich das Zeichenhafte abspielt. Das müßte man noch hübsch formulieren... Zur Zeicheninflation: Wenn alles dadurch, daß es gedeutet wird, zum Zeichen werden könnte, dann wäre es ein Funktionsbegriff wie "Hindernis". Alles kann zum Hindernis werden, es gibt aber gerade darum keine Klasse der Hindernisse. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 26.10.2018 um 11.33 Uhr |
|
Lieber Prof. Ickler, Sie definieren das Zeichen m. W. ungefähr so: Ein Zeichen ist ein Verhalten. Ich verstehe, daß jedes Zeichen, bzw. das Zeichengeben und das Zeichenerkennen, ein Verhalten ist. Aber nicht jedes Verhalten kann man wohl als Zeichen ansehen. Das heißt, die genaue Definition eines Zeichens müßte doch etwas komplexer ausfallen. In "Wirkliche Zeichen" setzen Sie sich mit Rudi Keller auseinander und widerlegen ausführlich seinen Zeichenbegriff, d. h. aber, Sie schreiben eigentlich immer nur, was ein Zeichen nicht ist. Z. B. schreiben Sie, was Zeichen "den ikonischen Charakter gibt ... ist eine Zusatzqualität von anderweitig bereits konstituierten Zeichen". Ja, aber wodurch ist denn nun ein Zeichen konstituiert? Hier und in anderen Beiträgen geben Sie immer viele Beispiele für Zeichen und Nichtzeichen, aber ich vermisse eine genaue Definition. Was ist ein Zeichen? In dem genannten Aufsatz finde ich nur die Definition eines Zeichenkandidaten, nämlich als etwas Interpretierbarem. Aber was genau macht den Zeichenkandidaten, das Interpretierbare, denn nun ggf. zum "wirklichen Zeichen"? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.10.2018 um 16.09 Uhr |
|
Das Zitieren (Vorführen) einer sprachlichen Form wird in der neueren Linguistik fast einhellig der "Metasprache" zugeordnet. Rudi Keller schreibt zum Beispiel: Ein jedes sprachliche Zeichen kann dazu benutzt werden, als Zeichen seiner selbst zu dienen. Das nennt er Metasprache. Aber das Vorführen steht zum Vorgeführten nicht in derselben Beziehung wie die Benennung. Es ist vielmehr dessen Simulation und daher allenfalls ikonisch. Diesen Fehler wiederholt Keller an einer späteren Stelle, wo es um die Frage geht, ob man Symbole ihrerseits symbolisieren kann. Wieder erklärt er das Zitieren für eine den Symbolen angemessene Art der Symbolisierung und übersieht, daß es sich dabei um eine extrem enge ikonische Abbildung handelt, während die eigentliche Symbolisierung eine Benennung wäre, etwa wie wir einen bestimmten Text Dekalog nennen und einen anderen das Vaterunser oder auch (noch weiter vom Zitieren entfernt) das Gebet des Herrn. Das sind symbolische Bezeichnungen für symbolische Zeichenkomplexe. Das Geräusch, das Schweine hervorbringen, kann man nachmachen und zu Kommunikationszwecken vormachen oder vorführen; aber solche Hervorbringungen sind gerade keine „Symbole“, auch nicht in stilisierter Fassung (oink-oink oder so ähnlich). Symbol ist vielmehr die Bezeichnung Grunzen. (Dies stammt im wesentlichen aus meinem Aufsatz "Wirkliche Zeichen".) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.10.2018 um 12.01 Uhr |
|
Ein aufgeklärter Zeichenbegriff schließt die sogenannten ikonischen und indexikalischen Zeichen aus, weil weder Ähnlichkeit noch Kontiguität Zeichenhaftigkeit begründen können. (Das Argument der Zeicheninflation erledigt die Klassifikation von Peirce, Morris und ihren vielen Nachfolgern.) Wie steht es mit Mimikry und mit Attrappen? (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#39372) Die Attrappe eines Polizisten am Straßenrand ist kein Zeichen eines Polizisten und „bedeutet“ keinen, sie verweist den verängstigten Autofahrer auch nicht auf einen solchen, sondern sie IST gewissermaßen ein Polizist. Der Autofahrer reagiert wie auf einen richtigen Polizisten und macht sich nicht etwa auf die Suche nach einem solchen (wie er auf eine abgebildete Kaffeetasse hin das Café aufsuchen würde). Wenn ein Kind einen Holzklotz über den Tisch schiebt und dazu ein Motorengeräusch nachahmt, dann tut es in gewisser Hinsicht so, als halte es den Klotz für ein Auto (nicht in jeder Hinsicht, es läuft zum Beispiel nicht angstvoll davon, aber das ist gerade das Wesen des Verstellungsspiels im Gegensatz zu einer wirklichen Täuschung wie bei der Polizistenattrappe). Der Klotz ist aber kein Zeichen für oder von einem Auto, er IST bis zu einem gewissen Grade ein Auto. Eine gefälschte Unterschrift ist kein Zeichen der echten. Falsifikate können alllerdings in den Dienst der Kommunikation gestellt werden („Muster ohne Wert“) und sind dann Zeichen, aber nicht durch die Ähnlichkeit an sich. Eine Sexpuppe bedeutet keine Frau, sondern IST eine. Simulation ist an sich nichts Kommunikatives. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.09.2018 um 17.17 Uhr |
|
"Referenz ist eine Relation zwischen dem Vorkommnis eines singulären Terms (einer Gegenstandsbezeichnung) und dem dadurch bezeichneten Objekt." (Albert Newen/Eike v. Savigny: Analytische Philosophie. München 1996:193) Das ist tautologisch, weil im „Bezeichnen“ die Referenz noch einmal vorkommt. Die Relation ist eben das Bezeichnen. Ob "referieren" oder "bezeichnen" – beides gehört zur gleichen naiven Redeweise, nicht-naturalistisch (denn in der Natur gibt es so etwas nicht), und muß aufgeklärt werden (s. Intentionalität und Sprache). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.09.2018 um 04.12 Uhr |
|
Zur Mimikry (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#39372) Bienen haben, soweit ich weiß, keine Signaltracht; wenn die Bienenragwurz sie nachahmt, ist das einfach die Angleichung eines Musters, das seinerseits funktional begründet ist. Anders die Warntracht etwa bei den Schwebfliegen, die wie Wespen aussehen. Wespen warnen Freßfeinde durch ihre Warntracht. Bei den Schwebfliegen muß man zweimal hinsehen, bis man z. B. an ihrer Zweiflügligkeit erkennt, was für Betrüger sie sind. Hier handelt es sich also um die Nachahmung von zeichenhaften Mustern. Dieser Unterschied zwischen einfacher Nachahmung und Signalfälschung steht quer zur Unterscheidung von Tarnung, Anlocken und Warnen (Batessche Mimikry). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.09.2018 um 09.25 Uhr |
|
Zu: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#38920 Sprache funktioniert über Zeichen. Einem Bedeutungsträger wird eine Bedeutung zugeordnet. Diese Zuordnung, das ist die große, immer noch nicht genügend gewürdigte Entdeckung von Ferdinand de Saussure, ist willkürlich. (Klaus P. Hansen: http://www.klaus-p-hansen.de/fileadmin/downloads/sprache_und_kollektiv_klaus_p_hansen.pdf) Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, wenn man immer wieder diesen Unsinn liest. Ich zítiere noch einmal Friedrich Hebbel: „Viel sind der Sprachen auf Erden; schon dieses sollte uns lehren, Daß kein inneres Band Dinge und Zeichen verknüpft.“ (Damals war Saussure mit seinem Beispiel "arbre – Baum" noch nicht geboren.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.08.2018 um 17.23 Uhr |
|
Eine Fotografie ist ein Abbild (einem Schatten vergleichbar), aber an sich noch kein Zeichen. Eine solche Funktion kann ihr natürlich, wie jedem Gegenstand, irgendwann zuwachsen. Die Ähnlichkeit wird häufig so behandelt, als sei sie praktisch dasselbe wie Abbildlichkeit: „Ein Zeichen ist ein Ikon (griech.: Bild), wenn seine Beziehung zum Gegenstand auf einem Abbildverhältnis, d. h. auf Ähnlichkeiten, beruht.“ (Angelika Linke/Markus Nussbaumer/Paul R. Portmann: Studienbuch Linguistik. 2. Aufl. Tübingen 1994:19) Tatsächlich wird statt der als Zeichenbegründung unzureichenden Ähnlichkeit meist die Abbildlichkeit unterstellt: „Etwas sinnlich Wahrnehmbares wird zum ikonischen Zeichen dadurch, dass wir in ihm das Bezeichnete als Abgebildetes (wieder)erkennen.“ (Ebd. 21) Die Herstellung von Abbildern ist aber oft in ein wirkliches Zeichenverhalten eingebettet, oder sie bereitet zumindest ein solches vor. Die Gegenstände im Musterkoffer eines Handlungsreisenden und die Abbildungen in einem Katalog sind ikonische Bestandteile eines zeichenhaften Verhaltens, aber nicht allein wegen ihrer Ähnlichkeit mit den Originalen, sondern weil sie in ihrer Umgebung – z. B. bei der Unterbreitung eines Angebots – eine bestimmte Mitteilungsfunktion auf den Betrachter ausüben. Eine bloße Beschreibung des angebotenen Objekts ohne jede Abbildlichkeit erfüllt denselben Zweck. Die Abbildlichkeit wird dem Zeichen, das als solches bereits konstituiert sein muß, zusätzlich beigebracht. Dabei kann es übrigens durchaus sein, daß auch das Abbildverhältnis erst erkennbar wird, nachdem man es gelernt hat. Abbildlichkeit kann konventionellen Regeln unterworfen sein und ist es gewöhnlich auch. Das Lesen von Landkarten oder Stadtplänen muß gelernt werden. Ferner ist es kein Widerspruch, daß willkürlich produzierte Indices, z. B. Männlichkeitssignale in der Mode, sowohl konventionell als auch mimetisch sind. Ähnlichkeit kann durch Nachahmung entstehen. Wenn jemand sich Flügel baut und den Vogelflug nachahmt, ist sein Verhalten dem der Vögel ähnlich. Es ist aber offensichtlich kein Zeichen, weder für den Vogelflug noch für etwas anderes. Zum Zeichen könnte es werden, wenn der Flieger die Nachahmung dazu benutzte, anderen Lebewesen als Vogel zu erscheinen. Die zahlreichen Formen von Mimikry im Tier- und Pflanzenreich sind phylogenetische Fälle von „Nachahmung“. Sie haben sich jeweils unter dem Einfluß der Reaktion bestimmter anderer Organismen herausgebildet, ganz ebenso wie Merkmale, die nicht mimetischer Natur sind. Durch diesen Prozeß und nicht durch ihre Ähnlichkeit mit etwas anderem sind sie wirkliche Zeichen geworden, und die mimetische Qualität ist etwas Hinzukommendes. Sie beruht darauf, daß ein bereits vorhandenes Muster zufällig das Material abgab, an das sich die Zeichenentwicklung anschließen konnte. Ein Vogel z. B. mag kleine Zweige übersehen oder Wespen als Beutetiere meiden; Insekten, die wie Zweige oder wie Wespen aussehen, bleiben daher unbehelligt. Ihr Aussehen wird sich immer genauer an das von Zweigen oder Wespen anpassen. Die Blüten der Bienenragwurz sehen wie Bienen aus; richtige Bienen werden dadurch angelockt. Daß auch das Vormachen eine Ähnlichkeit erzeugt, liegt auf der Hand. Die Herstellung von Mustern ist ein Sonderfall des Vormachens. Die Mitteilungsfunktion liegt auch hier bereits fest, wenn das vorgeführte Muster seinen Anteil beisteuert. Kurz gesagt: Zeichen können zusätzlich bildhaft sein, Bilder können zusätzlich als Zeichen fungieren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.07.2018 um 16.15 Uhr |
|
Wie kann man vom „Verstehen“ und „Nicht verstehen“ eines Satzes reden; ist es nicht erst ein Satz wenn man es versteht? (Ludwig Wittgenstein: Philosophische Grammatik 1) Dasselbe Sophisma wie bei jenem Zeichen, das erst durch seine Deutung zum Zeichen wird, das man aber nur deuten kann, wenn man schon weiß, daß es ein Zeichen ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.07.2018 um 03.14 Uhr |
|
Ich hatte dieses Beispiel schon anderswo erwähnt (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1110#13946). Die Fiktion der "Wahl" hängt mit dem strukturalistischen Zwei-Achsen-Modell zusammen, das vor allem Roman Jakobson dogmatisiert hat. Es liegt seiner Poetik ebenso wie seiner Theorie von Spracherwerb und Aphasie zugrunde. "Die poetische Funktion überträgt das Prinzip der Äquivalenz von der Achse der Selektion auf die Achse der Kombination." (Roman Jakobson: Linguistik und Poetik, in: Jens Ihwe (Hg.): Literaturwissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven, Frankfurt/M. 1971, S. 142-178. S. 153) Alles, was sich ereignet, ist die Negation dessen, was sich nicht ereignet, und könnte als Ergebnis einer Wahl dargestellt werden. Man sieht, wohin es führt. Vgl. auch http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#24443 |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.07.2018 um 20.40 Uhr |
|
Laut "Vernäht und zugeflixt" vom Dudenverlag soll ein gebildeter Sprecher in jedem Augenblick aus einem Vorrat von ca. 94.000 Wörtern auswählen, die im Gehirn gespeichert sind. Abgesehen von allem anderen: Woher weiß er, wonach er suchen muß? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.07.2018 um 05.20 Uhr |
|
Kinder lernen, nicht alles auszusprechen; so entsteht die nicht besonders gut erforschte stumme, innere Rede. Alte Menschen neigen mehr und mehr dazu, dies wieder rückgängig zu machen. Zuerst begleiten sie manche Tätigkeiten mit geflüsterten Kommentaren, dann sprechen sie ständig vor sich hin, wie man es auf der Straße manchmal erlebt. Nachlassen der sozialen Disziplinierung auch bei Tourette u. ä. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 15.07.2018 um 00.40 Uhr |
|
Ich habe mir das Du angeboten. In Selbstgesprächen benutze ich für mich selbst nur Pronomen, meist 1. Person Einzahl, mitunter auch Mehrzahl, die 2. Person nur in der Einzahl. Das Pronomen kann höchstens ein Attribut haben (ich/du Idiot o.ä.). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.07.2018 um 18.43 Uhr |
|
Also wirklich hörbar rede ich nie mit mir selbst (hoffe ich wenigstens). Aber das sind persönliche Merkmale (intro- vs. extravertiert?), und ich hatte auch ein bißchen den Wunsch, andere Stimmen einzuholen. |
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 14.07.2018 um 18.09 Uhr |
|
(Aber das sind dann wohl eher Selbstgespräche.)
|
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 14.07.2018 um 18.07 Uhr |
|
Sie haben sich noch nie selbst angeredet? Auch nicht laut, wenn Sie einen Fehler gemacht, sich beispielsweise mit dem Hammer auf den Daumen gehauen haben? Das scheint sonst sehr üblich zu sein. Ein Freund hat mich mal gefragt, ob meine Wahl in solchen Fällen auf den Vornamen oder Nachnamen falle; er selbst greife zum Nachnamen. Ich habe darauf geachtet: ich machs wie er. Um verärgerte Distanz auszudrücken.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.07.2018 um 15.35 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#32123 Ich weiß nicht, ob ich es schon einmal gesagt habe: Wir sprechen wohl die meiste Zeit unseres Wachseins stumm vor uns hin, aber das ist kein "Selbstgespräch", wenn man darunter ein Gespräch "mit" uns selbst (s. Wikipedia "Autokommunikation") versteht. Vielmehr bilden wir mehr oder weniger vollständige Sätze, die ausdrücken, was wir sagen wollen, sagen werden, gesagt haben oder hätten sagen können/sollen usw. Nie mit Anrede an uns selbst verbunden (wie der zitierte Odysseus sich ausnahmsweise selbst anredet). Ich glaube nicht, daß ich mich jemals selbst angeredet habe, das käme mir spaltungsirre vor. Ich nehme an, daß andere meine Erfahrung teilen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.07.2018 um 03.59 Uhr |
|
„Soweit Indizes nicht intendiert sind (z. B. Rauch) werden sie auch den echten Zeichen (Symbol, Ikon) gegenübergestellt und als unechte Zeichen bezeichnet bzw. nicht als Zeichen anerkannt. Für die Anerkennung als Zeichen wird angeführt, dass es im Bereich der Mode, des menschlichen Verhaltens/Sich-Gebens praktisch unmöglich sei, zwischen intendierten und nicht-intendierten Signalen zu unterscheiden. Insoweit indexikalische Zeichen nicht auf einer Kommunikationsabsicht beruhen, werden sie den kommunikativen Zeichen (Ikonen, Symbolen) entgegengesetzt. Jedes Verhalten kann indexikalisch interpretiert werden.“ (Wikipedia „Index“) Das läuft auf Watzlawick hinaus: Man kann nicht nicht-kommunzieren. Es ist zwar schwierig, die zeichenhafte Überformung des Funktionalen zu erkennen, aber man sollte es nicht aufgeben. Mit mentalistischen, folkpsychologischen Begriffen wie „Absicht“, „intendieren“ (= wollen) wird man es nicht schaffen. Der Mensch ist uns nur als Kulturwesen gegeben, der Naturzustand muß rekonstruiert werden. Die erwähnte Mode oder die Eßsitten sind Standardbeispiele. Wo gibt es Menschen, die sich „einfach“ etwas Wärmendes umhängen und „einfach“ mit den Händen zulangen, wenn sie hungrig sind? Manche Naturvölker kommen nahe heran, aber bei genauerem Hinsehen gibt es auch da Bräuche und Zwänge, auch „Techniken“, deren Beherrschung zeichenhaft überformt ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.06.2018 um 15.28 Uhr |
|
Unsere Studenten sprechen ehrfurchtsvoll nach, Saussure habe zwischen langue und parole unterschieden und die "Arbitrarität" (so muß man es ausdrücken) des sprachlichen Zeichens entdeckt. Also Dinge, die seit langem Gemeingut und im 19. Jahrhundert vollends selbstverständlich waren. Bei Blatz z. B. ist es ebenfalls ausgesprochen. Saussure hat ja auch gar nicht den Anspruch erhoben, hier etwas Originelles zu sagen. Er hat die Dinge dann eher mystifiziert, jedenfalls in der allgemein verbreiteten Fassung seiner rekonstruierten Vorlesung.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.05.2018 um 05.39 Uhr |
|
Karl Bühler in dieser Hinsicht besonders empfindlich, kritisierte an Saussure den Psychologismus. Dafür hatte man lange Zeit gar keinen Blick. Heute wird gerade diese naive sprachgeleitete Psychologie des 19. Jahrhundert als "Kognitionswissenschaft" für besonders modern gehalten. Saussure war also "auch schon" Kognitivist (wie jedermann seit 2.500 Jahren). Manchmal ist es schwer, keine Satire zu schreiben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.05.2018 um 15.15 Uhr |
|
Learning a word involves mapping a form, such as the sound "dog", onto a meaning or concept, such as the concept of dogs. Was könnte das bedeuten? Es muß irgendwie zwei Gegenstände geben, damit man den einen auf den anderen abbilden kann. Bei der Wortform ist es klar, aber was mag "meaning or concept" sein? Ich verstehe das einfach nicht, halte den Satz und tausend ähnliche also für sinnlos. (Welche der vielen Bedeutungen von mapping ist gemeint? Vielleicht eine Punkt-zu-Punkt-Zuordnung, eine Isomorphie oder was? Aber eigentlich spielt es keine Rolle, denn dieser zweite Gegenstand ist völlig mysteriös.) Bei den meisten Theorien dieser Art läuft es darauf hinaus, eine zweite Sprache, eben die Language of Thought, anzunehmen, ohne daß man das genauer sagte oder sich gar der damit verbundenen Probeme bewußt wäre. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.04.2018 um 03.41 Uhr |
|
„Ein gedrucktes Wörterbuch ist einfach eine Abbildung von Bedeutungen auf Formen.“ (...) „Jedes gedruckte Wörterbuch kann man als lexikalische Matrix darstellen: man muß nur eine eigene Spalte für jede Wortform und eine eigene Zeile für jede Wortbedeutung bilden.“ (George A. Miller: Wörter. Heidelberg 1993:51; vgl. das Zitat im Haupteintrag) Dies stellt er auch als Schema dar, aber es sind natürlich keine Bedeutungen, sondern andere Wörter, die man eintragen muß. Skinner hat darauf hingewiesen, daß Wörterbücher keine Bedeutungen, sondern andere Wörter enthalten, entweder in einer anderen Sprache oder – verführerischerweise - in derselben (Synonyme). Im naiven Speichermodell wird das Ganze psychologisiert: „Im mentalen Lexikon gibt es jeweils ein eigenes Speichersystem für die Wortformen und die Wortbedeutungen.“ (Volker Harm: Einführung in die Lexikologie. Darmstadt 2015:111) Wie speichert man Bedeutungen? Leeres Gerede. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.03.2018 um 09.08 Uhr |
|
Beim Menschen sind natürlich auch funktionale Verhaltensweisen oft symbolisch überdeterminiert, sonst braucht man keine Soziologie. Die anderswo erwähnten Nachbarn, die zugleich mit den Amseln und Spechten ihre Frühlingsaktivitäten wiederaufnehmen, geben mit dem lautstarken und ausdauernden Betrieb des Hochdruckreinigers zu verstehen, was für ordentliche Leute sie sind. Desgleichen die Reihenhausfamilie, die jeden Morgen um halb sechs ihre Betten ausklopft, anschließend bei offenen Fenstern die ganze Wohnung staubsaugt und nebenbei alles übertönend die Kinder zurechtweist. Distinktionsgewinn. Tischmanieren usw. braucht man gar nicht zu erwähnen. Manchmal kommen Zweifel auf. Ißt Frau X wirklich nur deshalb so hastig, weil sie Hunger hat, oder auch weil sie (unbewußt) demonstrieren will, daß sie vor lauter Pflichterfüllung eigentlich keine Zeit fürs Essen hat? Da ich ihre Herkunft kenne, halte ich dies für wahrscheinlich. Andere essen hastig, weil sie früher mal fast verhungert wären, das ist dann Symptom und kein Zeichen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.03.2018 um 05.07 Uhr |
|
Seit einigen Tagen singen die Amselmännchen, etwa zehn Tage später als normal wegen der Kältewelle ("Putins Peitsche"). Das sind natürliche Zeichen, phylogenetisch zu erklären. Die Funktion scheint in der Abgrenzung des Reviers zu bestehen, während das Trommeln der Spechte (auch der Weibchen), das ungefähr gleichzeitig begonnen hat, in variierender Form auch verschiedene Funktionen haben soll. Nun denn, wie soll man das bilaterale Zeichenmodell hier anwenden? Ordnet die Amsel oder der Specht Ausdrucks- und Inhaltsseite einander zu? Haben sie im Kopf einen Speicher für Bedeutungen? Übrigens habe ich bisher immer beobachtet, daß das Singen und das Trommeln von weiter her eine Antwort bekommen, also dialogisch aufreten. Ob es aufhört, wenn kein anderer Vogel antwortet, habe ich nirgendwo nachschlagen können. Würde mich interessieren. Wie kommen wir überhaupt darauf, daß Gesang und Getrommel Zeichen sind? Als Kind dachte ich zuerst, daß die Spechte mit ihrem Trommeln Insekten aus der Rinde holen, aber irgendwann habe ich beobachtet, daß es ein ganz anderer Funktionskreis ist als das kräftige Hacken und Spalten zwecks Nahrungssuche. Singen und Trommeln sind Verhaltensweisen von hoher Unwahrscheinlichkeit. Wir suchen also nach einer Funktion (Stadium der Annahme von "Zeichenkandidaten"). Mit der Ernährung kann es nicht zusammenhängen, dazu ist es zu ineffizient. Wir fragen also nach der Wirkung und finden, daß es nicht die mechanische ist ("Worte brechen keine Knochen", fällt uns ein). Dann fällt uns der dialogische Charakter auf usw. Und: "Nichts in der Biologie macht Sinn außer im Licht der Evolution." So kommen wir dazu, wirkliche Zeichen zu identifizieren. Objektiv, nicht nur im Auge des Betrachters wie bei den Okkultisten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.03.2018 um 09.45 Uhr |
|
Im Anschluß an die berühmte Stelle vom "Käfer in der Schachtel" sagt Wittgenstein: Wenn man die Grammatik des Ausdrucks der Empfindung nach dem Muster von "Gegenstand und Bezeichnung" konstruiert, dann fällt der Gegenstand als irrelevant aus der Betrachtung heraus. (PhU 1967:127) Richtig, aber zu spät. Auch schon bei Ausdrücken, die sich nicht auf das (metaphorische, "transgressive") "Innere" beziehen, muß ebendies, das "Sich-Beziehen", die Referenz, Aboutness, Intentionalität gestrichen werden. Das Naturalisierungsprogramm kann mit solchen metaphysischen Begriffen nichts anfangen. Wörter beziehen sich nicht auf Gegenstände, sondern werden manchmal mehr oder weniger von Gegenständen gesteuert. Selbst diesen Fall überschätzen die Philosophen, weil sie sich berufsbedingt meistens mit Wörtern wie Tisch beschäftigen (den haben sie vor sich), allenfalls Katze, aber nicht mit Hochzeitsfeier, Schlußfolgerung usw. (Vgl. schon http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#31459) – Das Vorkommen solcher Verhaltensabschnitte im Redefluß wird von vielen ganz verschiedenen Faktoren gesteuert. Dem geht die Verhaltensanalyse nach (multiple causation), ein mühsames und ungewohntes Geschäft. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.02.2018 um 17.09 Uhr |
|
Mentalisten stellen die "Redeplanung" ungefähr so dar (hier Theo Hermannn): 1. Erzeugung der kognitiven Äußerungsbasis: Der Sprecher generiert eine Mitteilung bzw. eine Botschaft („message“), die den momentanen Sprecherabsichten und der soeben vorliegenden Kommunikationssituation möglichst adäquat ist. Diese Botschaft ist (von wenigen Ausnahmen abgesehen) kognitiv-nonverbal, d.h. sie stellt eine noch nicht in einer Einzelsprache formulierte „gedankliche Struktur“ dar. Das ist unbegreiflich: Die Basis soll propositional, aber nichtsprachlich sein. Eine Struktur, aber unbenannt, von was eigentlich? Dabei wählt er diejenigen kognitiven Inhalte aus, die er enkodieren wird (= Selektion) und bringt die für die Verbalisierung ausgewählten kognitiven Inhalte in eine bestimmte Reihenfolge (= Linearisierung). Wie kann man Inhalte linearisieren? Die Übertragung auf nichtsprachliches Verhalten ist ebenfalls schwer vorzustellen. Und wer ist es eigentlich, der auswählt und linearisiert, und was bringt ihn zu diesem Verhalten? Es ist schon irreführend, vom Sprecher als Agens dieses Anfangsverhaltens zu sprechen. „Der Sprecher generiert eine Mitteilung“ – wer kann sich darunter etwas vorstellen? Um den infiniten Regreß zu vermeiden, muß man davon absehen, hierin ein weiteres Verhalten zu sehen. Auch soll die so generierte Botschaft den Sprecherabsichten adäquat sein, d. h. es gibt ein personales Subjekt mit Absichten, bevor überhaupt die Botschaft inhaltlich gebildet wird. Das alles ist unvorstellbar, modisches Gerede. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.02.2018 um 15.19 Uhr |
|
Allein von der Empfängerseite betrachtet, lassen sich Anzeichen und wirkliche Zeichen nicht unterscheiden. Die Fliege wird durch Aasgeruch angezogen, aber dieser Geruch ist dem verrottenden Fleisch nicht um der Fliege willen zugewachsen, sondern eine reine Begleiterscheinung. Die Fliege wird auch von der Stinkmorchel angezogen, und deren Aasgeruch hat sich genau deshalb entwickelt, weil die Fliege auf diese Weise die Sporen von Phallus impudicus verbreitet (eine Art olfaktorische Mimikry). Hier ist der Geruch zeichenhaft. Der Unterschied ist nur für den Betrachter erkennbar, der einen Überblick über die Zeichenentstehung (Evolution) hat.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.02.2018 um 05.45 Uhr |
|
Um Erkenntnisse auszudrücken und festzuhalten, brauchen wir eine Sprache. Sie muß die gewonnenen Begriffe bezeichnen. Die Wörter sind Zeichen für die Begriffe und damit auch Zeichen für die entsprechenden – durch die Begriffe bezeichneten – Gegenstände, für Tatbestände und Beziehungen zwischen Tatbeständen. (Hans Gradmann: Menschsein ohne Illusionen. München 1970:181) Also immer noch Aristoteles, nur schlechter formuliert. Wenn die Begriffe auch wieder etwas bezeichnen, sind sie Zeichen, und wir stecken im unendlichen Regreß. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.02.2018 um 04.24 Uhr |
|
Die „Information“, die der Dendrochronologe den Jahresringen entnehmen kann, ist etwas ganz anderes als die „Information“ im Sinne der Informationstheorie. Anders gesagt: Die Ausbildung von Jahresringen ist kein Kommunikationsereignis. Sie ist eine Folge des Wachstums oder einfach ein Teil des Gesamtvorgangs. (Die Zerlegung in Ursache und Folge ist menschengemacht, wegen der Unvollständigkeit unseres Überblicks.) Jahresringe gibt es – anders als Blüten und Pfauenaugen (Determinativkompositum) auf Pfauenaugen (Possessivkompositum) – nicht deshalb, weil sie von einem Empfänger als Zeichen gedeutet worden sind. Es bleibt dabei: Anzeichen oder Symptome sind keine Zeichen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.02.2018 um 05.31 Uhr |
|
Vielleicht kann ich Ihre Bedenken wenigstens zum Teil durch den Hinweis auf meinen älteren Aufsatz beheben: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#31975 |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 02.02.2018 um 21.57 Uhr |
|
Man sollte nicht das Zeichen oder das Wort, sondern das Sprechen/Schreiben/Zeichengeben bzw. das Hören/Lesen/Sehen ein Verhalten nennen. Es ist wohl abkürzend auch so gemeint, aber es verwirrt. Als ob die Kartoffel eine Tätigkeit genannt würde statt das Essen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 02.02.2018 um 16.43 Uhr |
|
Ob Verhalten frei oder determiniert ist, halte ich für eine philosophische Frage. Aber ich könnte mich kaum damit abfinden, daß mein Verhalten völlig determiniert, ohne einen einzigen Freiheitsgrad ist. Deshalb sehe ich auch das Wort konditionieren (= abrichten? [wie ein Tier?]) sehr skeptisch. Aber auf das gleiche Zeichen hin verhalten sich zwei Zeichenrezipienten oft unterschiedlich, und beide sowieso anders als der Zeichenproduzent. Welches Verhalten "ist" nun das Zeichen? Es gibt sicher ein erwünschtes Verhalten, das würde ich die Bedeutung des Zeichens nennen. Aber da bin ich schon wieder beim bilateralen Begriff. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.02.2018 um 07.34 Uhr |
|
Wie unklar der Zeichenbegriff ist, erlebt man auf Schritt und Tritt. Es gibt auch natürlich entstandene Funksignale, z. B. die von Quasaren abgestrahlten Impulsfolgen, deren Analyse zur Vermessung von Erde und fernem Weltall dienen kann; die wichtigsten ihrer Frequenzbereiche werden vor technischer Nutzung geschützt. Natürlichen Ursprungs sind auch die von Blitzen in Gewittern hervorgerufenen, stoßartigen Wellenfronten; sie haben den Funkwellen sogar ihren Namen gegeben. (Wikipedia Funksignal) Aber anfangs sind auch Funksignale als Zeichen definiert worden: Ein Funksignal ist ein durch Funkwellen ausgesandtes Zeichen oder eine kurze Zeichenfolge zur drahtlosen Übermittlung von Nachrichten. Die Strahlung von Himmelskörpern ist nicht zeichenhaft. Vgl.: Ein Signal (lateinisch signalis ‚dazu bestimmt‘, signum ‚ein Zeichen‘) ist ein Zeichen mit einer bestimmten Bedeutung, die das Signal durch Verabredung oder durch Vorschrift erhält. Eine Information kann durch ein Signal transportiert werden. Dazu benötigt man einen Sender und einen Empfänger (vgl. das Funksignal in der Nachrichtentechnik). Ohne technische Hilfsmittel kommt man bei der direkten menschlichen Kommunikation aus, dort können (oft nonverbale) Signale verschiedene Aufforderungen bedeuten. (Wikipedia Signal) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.02.2018 um 04.42 Uhr |
|
Although interest in signs and the way they communicate has a long history (medieval philosophers, John Locke, and others have shown interest), modern semiotic analysis can be said to have begun with two men — Swiss linguist Ferdinand de Saussure (1857–1913) and American philosopher Charles Sanders Peirce (1839–1914). (Arthur Asa Berger) Das ist die allgemeine Meinung. Ich teile sie nicht. Peirce und Saussure haben die Entwicklung einer modernen Semiotik verhindert wie niemand sonst. Sie haben Mystifikationen in die Welt gesetzt, an denen sich noch heute allzu viele abarbeiten. Das liegt hauptsächlich am archaischen Zeichenbegriff. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.02.2018 um 04.40 Uhr |
|
Über die "freie Entscheidung" muß ich lächeln. Das eine Verhalten ist so determiniert wie das andere, der Verbrecher ist nicht freier als der Gesetzestreue. Das ändert aber sowieso nichts an meiner Argumentation, die nicht der Psychologie der Autofahrer galt, sondern der Begrifflichkeit, mit der wir Zeichen untersuchen.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 01.02.2018 um 11.12 Uhr |
|
Das gefühlte Achtel bezieht sich natürlich nur auf die Situationen, in denen kein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug kommt, in denen man aber ungeachtet dessen aufgrund des Stopschildes trotzdem halten müßte.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 01.02.2018 um 10.48 Uhr |
|
Lieber Prof. Ickler, haben Sie schon einmal beobachtet, wie viele Autofahrer an einem Stopschild wirklich anhalten? Gefühlt ein Achtel, würde ich sagen. Zwischen Stopschild und dem erwünschten Anhalten liegt also noch die freie Entscheidung des Fahrers. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 01.02.2018 um 10.43 Uhr |
|
Prof. Ickler erwähnt "Produktion wie Rezeption von Rede". Gehören nicht zum verbalen Verhalten ebendiese zwei verschiedenen Aspekte? Zum Beispiel zum einen das durch ein Zeichen erwünschte, erwartete oder tatsächlich eingetretene Verhalten des Zeichenempfängers (was auch schon alles unterschiedlich sein kann), zum andern das Verhalten des Zeichengebers beim Erzeugen des Zeichens? Es ist jeweils ein ganz anderes Verhalten. Relativiert das nicht den Anspruch des behavioristischen Zeichenmodells, nicht bi- oder mehrlateral zu sein? Die zwei Seiten entstehen nur in einem anderen Zusammenhang. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.02.2018 um 10.27 Uhr |
|
„Die Deutung eines Zeichens geschieht in seiner Übersetzung in andere Zeichen. Seine Bedeutung ergibt sich aus seinen Übersetzungen.“ (Elmar Holenstein in ders., Hg.: Roman Jakobson: Semiotik. Frankfurt 1992:11) In welche andere Zeichen (in welcher Sprache) übersetze ich ein deutsches Wort (z. B. doch), ein Stopschild, die Farbe einer Spielkarte? Und wenn ich es in eine Gedankensprache übersetzen sollte – wie verstehe ich die Übersetzung? (Usw.) Der Autofahrer versteht das Stopschild durch Anhalten, nicht durch Übersetzen. Die Übersetzung eines Ausdrucks in eine andere Sprache erzeugt einen zweiten Ausdruck, der dieselbe Bedeutung hat wie der erste. Er muß ebenfalls erst verstanden werden (usw.). |
Kommentar von Pt, verfaßt am 31.01.2018 um 14.46 Uhr |
|
Der "freie Wille" eines Menschen kann natürlich auch auf vielfältige Weise ausgeschaltet oder umgangen werden, z. B. durch Konditionierung (Erziehung) oder Hypnose. Googlen Sie diesbezüglich auch mal die Stichwörter "MK Ultra", "Mind Control", "trauma based mind control". Oder suchen Sie auf Youtube nach "Mark Passio The 14 Methods Of Manipulation".
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 31.01.2018 um 10.48 Uhr |
|
Lieber Herr Kohl, wir schweifen aus? Ich dachte, wir sind immer noch bei den Grundlagen der Zeichentheorie. Ich hatte Sie nur gebeten, Ihre eigenen Halbsätze zu vervollständigen (Von welchem Fehler reden Sie? Welcher Sache ordnen Sie die Wahrscheinlichkeit eines Wortes oder Satzes zu und warum?). Wenn Sie das nicht klarstellen, dann schweifen wir nicht aus, sondern Sie weichen aus. Sie fragen, was man mit der Zuordnung Wort-Bedeutung machen kann, sie führe zu nichts. Aber ich habe es doch ganz genau geschrieben, es zeigt, daß die 2-Seiten-Theorie der Zeichen zumindest nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, sondern eine sehr naheliegende Grundlage hat. Mein Problem mit der behavioristischen Methode, die ich natürlich nicht ablehne, dazu müßte ich sie erst einmal besser verstanden haben, ist, daß da ständig von Konditionierung gesprochen wird. Man kann doch einen Menschen nicht wie ein Tier konditionieren, also abrichten. Zwischen dem Erkennen eines Zeichens und dem daraus resultierenden Verhalten steht beim Menschen ein Prozeß des Nachdenkens, die Bedeutung des Zeichens wird in bezug auf die aktuellen Umstände beurteilt, und daran schließt sich dieses oder jenes Verhalten an. Man kann beim Menschen auch nicht wie bei einer Zufallsmaschine die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Verhalten angeben. Ich gehe von einem freien Willen des Menschen aus. Ich sehe einfach nicht, wie man das Zeichen mit dem Verhalten gleichsetzen kann. |
Kommentar von Alexander Kohl, verfaßt am 30.01.2018 um 18.11 Uhr |
|
Ich glaube, langsam schweifen wir hier zu weit aus. Es geht ja nicht darum irgend etwas zuzuordnen, sondern um den funktionalen Zusammemhang zwischen Wahrscheinlichkeit und Umweltbedingungen. Das kann ich bei der hebeldrückenden Ratte machen wie beim sätzesprechenden Menschen. Die Unwiderlegbarkeit ist genau das Problem. Sie können halt beliebig Bedeutungen zuordnen, aber was kann man damit dann letztlich machen? Es führt zu nichts und genau das macht Skinner so elegant, daß man diesen Ballast nicht mehr mit sich rumschleppen muß. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 30.01.2018 um 17.39 Uhr |
|
Was heißt "werden zugeordnet"? Wir können doch beliebige Dinge einander zuordnen. Die Frage ist nur, was wir jeweils mit dieser Zuordnung machen und daraus schlußfolgern. Ich habe den Wörtern ihre jeweilige Bedeutung (nach Ihrer Definition) zugeordnet. Da beides existiert, kann ich beides einander zuordnen. Die Zuordnung ist eineindeutig (wenn man Homonyme als verschiedene Wörter ansieht). Das Ergebnis zeigt, daß aus dieser Sicht Wörter als sprachliche Zeichen tatsächlich im saussureschen Sinne 2 Seiten haben. Meiner Ansicht nach ist dieser Punkt nicht widerlegbar. Oder was sollte an meinem Vorgehen falsch sein? Die Frage wäre aber, ob diese Sichtweise zweckmäßig zum gesamten Verständnis von Zeichen ist, oder ob es nicht z. B. nach Skinner Wege gibt, den Zeichenbegriff anders, logischer und vollständiger zu erklären. Sie, lieber Herr Kohl, ordnen also die Wahrscheinlichkeit, daß ein Wort oder Satz gesagt wird, wem zu? Ebendiesem Wort oder Satz? Vielleicht ein paar Beispiele (die Zahlen sind nur ganz grob zur Illustration von mir geschätzt): Brot -> 0,001 die -> 0,03 Wir gehen heute abend ins Kino. -> 0,0001 Gut, eine eindeutige Zuordnung, aber was soll das bringen? |
Kommentar von Alexander Kohl, verfaßt am 30.01.2018 um 11.45 Uhr |
|
Nicht Wörter oder Sätze werden zugeordnet, sondern die Wahrscheinlichkeit, daß sie gesagt werden. Diese Wahrscheinlichkeit ist eine Funktion von Umweltvariablen (Kontexten) und meiner Lernerfahrung (Konditionierungsgeschichte). Man kann mit Sätzen Aussagen modellieren. Wenn Sie aber im Alltag sprechen, kann ich das als Ereignis beobachten. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 30.01.2018 um 10.56 Uhr |
|
zu Herrn Kohl: Ordnen wir doch einmal die Sammlung aller Sätze und Kontexte, in denen das Wort X benutzt wird, dem Wort X zu. Das sollte wohl möglich sein. Dann tun wir das gleiche mit allen Wörtern, die wir kennen. Wir erhalten damit eine vollständige Zuordnung aller Wörter zu ihrer Bedeutung, natürlich keine statische Zuordnung, eine veränderliche. "Der Fehler entsteht ..." – welcher Fehler? Warum sollte man die Bedeutung nicht als "essentialistische Eigenschaft" des Wortes verstehen? Ohne die Bedeutung gibt es auch das Wort nicht. Ich soll mir einen Satz als Ereignis vorstellen? Wie soll das gehen? Ein Satz ist eine Aussage, das ist etwas ganz anderes als ein Ereignis. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.01.2018 um 06.56 Uhr |
|
Christian Lehmann: „Diese Theorie hat F. de Saussure aufgegriffen und in einer Form kodifiziert, die noch heute für die Linguistik gültig ist. Nach ihm umfaßt das Sprachzeichen ein Significans, ein Bezeichnendes, und ein Significatum, ein Bezeichnetes. Die Relation, von der die Scholastiker sprachen, verbindet nicht das Zeichen mit etwas außerhalb des Zeichensystems, sondern das Significans mit dem Significatum, besteht also innerhalb des Sprachzeichens.“ So wird die Funktion des wahrnehmbaren Zeichens (seine Vor- und Nachgeschichte) zu einer geheimnisvollen nicht-wahrnehmbaren „Rückseite“. „Sobald wir nicht mehr wissen, was ein Böttcher, eine Kemenate oder eine Tiefenstruktur ist, verlieren diese Zeichen für uns ihr Significatum. Aber dann gehen auch die zugehörigen Significantia verloren, das heißt, wir reden nicht mehr von Böttchern, Kemenaten und Tiefenstrukturen. Und wiederum existiert ein außersprachliches Objekt unabhängig davon, ob es von einem Zeichen denotiert wird. Ein Significatum dagegen existiert nur kraft seiner Beziehung zu einem Significans. Solange wir die Significantia Hippie, Ergänzungsabgabe und Theta-Rolle nicht hatten, hatten wir auch die zugehörigen Significata nicht. Bedeutungen sind nicht außerhalb von Sprache vorgegeben, sondern werden in der Sprachtätigkeit erst geschaffen (Morris 1938: 19f.).“ Das ist teils falsch, teils paradox. Man hypostasiert die Gebrauchsbedingungen. Die Bedeutung von etwas kann es ohne dieses Etwas nicht geben, was bei solchen relationalen Begriffen selbstverständlich ist. Ob es eine Kemenate gibt oder nicht, ist eine sachliche Frage. Wenn man nicht weiß, was Kemenate bedeutet, ist es nur ein Zeichenkandidat und kein Signifikant ohne Signifikat, denn diese Begriffe sind ja korrelativ. „Die Bedeutung eines Sprachzeichens, sein Significatum, ist also etwas rein Sprachliches. Der reale Gegenstand, auf den ein Zeichen sich beziehen kann, sein Denotatum, ist dagegen etwas Außersprachliches.“ ... „Sprache ist in hohem Maße eine selbstgenügsame Tätigkeit, die nicht darauf angewiesen ist, daß sie mit irgend etwas außer ihr selbst zu tun hat.“ [Dies haben die postmodernen Modephilosophen verabsolutiert und ein geistreichelndes Spiel daraus gemacht.] „Die Assoziation eines Significans mit einem Significatum ist nach dem zuvor Gesagten notwendig. Aber damit ist noch nicht gesagt, aufgrund wovon sie besteht. In der nicht-linguistischen Semiotik hat man diese Frage bezogen auf die Natur der Relation in dem Satz aliquid stat pro aliquo, also der Relation zwischen Zeichen und Denotatum, die man als für das Zeichen konstitutiv ansah. Diese Relation kann auf eine der folgenden drei Weisen begründet sein: 1. Sie kann durch Kontiguität zwischen Zeichen und Denotatum begründet sein. 2. Sie kann zweitens durch Ähnlichkeit zwischen Zeichen und Denotatum begründet sein. 3. Sie kann auf Konvention (Vereinbarung) beruhen. Ch. S. Peirce (1940: 104) nannte ein Zeichen, für das das erste gilt, einen Index; ein Zeichen, für das das zweite gilt, ein Ikon (icon); und ein Zeichen, für das das dritte gilt, ein Symbol. Wir wollen diese Begriffe kurz auf ihren Nutzen für den Begriff des Sprachzeichens überprüfen.“ „De Saussure und besonders L. Hjelmslev gingen sogar so weit zu behaupten, es gebe in der Sprache überhaupt keine positiven Größen, sondern lediglich Relationen und Unterschiede. Die Identität eines Zeichens ist für Saussure sein Wert (valeur), das ist das Gesamt seiner Beziehungen zu den anderen Zeichen. In dieser extremen Weise ist das zwar logisch unmöglich. Denn ich kann zwar x durch seine Relation zu y definieren; aber dann kann ich nicht gleichzeitig y durch seine Relation zu x definieren, ohne zirkulär zu werden. Soviel aber ist richtig, daß an den Zeichen in erster Linie das für das Sprachsystem relevant ist, was distinktiv ist, das heißt, was ihre Stellung und Identität gegenüber anderen Sprachzeichen ausmacht.“ Das Ganze ist ein gutes Beispiel für die Orthodoxie der heutigen strukturalistischen Linguistik. |
Kommentar von Alexander Kohl, verfaßt am 29.01.2018 um 22.08 Uhr |
|
Ich würde mich gerne an einer kurzen Erklärung versuchen. Skinners Sprachverhalten entspricht dem operanten Konditionieren, das heißt, die Wahrscheinlichkeit eines Verhalten steht in funktionalem Zusammenhang zur Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines darauffolgenden Verstärkers. Stellen Sie sich also jeden möglichen Satz oder sprachliche Einheit beliebiger Größe als ein Ereignis mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vor. Diese Wahrscheinlichkeit hängt nun vor allem von ihrer persönlichen Vorgeschichte ab. Wenn Sie diese Sätze miteinander vergleichen, stellen Sie fest, daß es sich wiederholende Muster gibt, Wörter, Wortgruppen, Phrasen o.ä. Das, was wir Bedeutung eines Wortes nennen, ist nichts anderes als die Sammlung aller Sätze und der Kontexte, in denen diese Wörter benutzt werden. Der Fehler entsteht, wenn man die Bedeutung als eine essentialistische Eigenschaft des Wortes versteht, die ihm zugeordnet ist. Im schlimmsten Fall schließt man dann daraus, daß diese Bedeutung irgendwie im Geist (Gehirn) gespeichert sein müsse. Im Prinzip ist es ein ähnliches Problem, wie man es in der Biologie vor Darwin hatte; vor Darwin hatte man in der Biologie einen essentialistischen Artbegriff, der versucht hat, jede Art als eine Sammlung bestimmter Eigenschaften zu definieren, deren Ursprung dann gottgegeben ist oder „intelligent designt“ wurde. Erst die Evolutionstheorie erklärt, daß aus einem gemeinsamen Vorfahren verschiedene Nachfolger herausdivergierten, die immer weniger in genetischem Austausch stehen, bis es aus rein pragmatischen Gründen sinnvoll ist, sie als Arten zu unterscheiden. Genau in dieser pragmatischen Weise sollte man auch den Bedeutungsbegriff anwenden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.01.2018 um 17.53 Uhr |
|
Menschen lernen auf verschiedene Weise, vor allem auch durch sprachliche Belehrung, Das ist aber keine Erklärung, sondern selbst erklärungsbedürftig. Skinner faßt es unter "intraverbales Verhalten" (Steuerung durch verbales Verhalten). Daß ich Sprache verstehe und aus Rede etwas lernen (mein eigenes Verhalten modifizieren) kann, geht letzten Endes auch auf Konditionierung zurück. An dieser Stelle kann ich nicht darauf eingehen. Skinner ist der einzige, der die ganze Komplexität dieser Vorgänge erfaßt hat, das ist der Grund für den Umfang des eigentlich ja sehr knapp formulierten Buchs "Verbal Behavior". Richtig ist, daß meine eigene Konditionierung für mich selbst nicht beobachtbar ist ("bewußtseinsfremd"). Aber nehmen wir das Üben, ob Vokabeln, Schleifenbinden oder Klavierspielen (oder eben Halten an der roten Ampel). Es ist uns selbst unbegreiflich. Warum kann ich es jedesmal besser? Ich beobachte es einfach und nehme als selbstverständlich hin, daß es funktioniert. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 29.01.2018 um 16.51 Uhr |
|
Die Erwartung ist die Bedeutung des Zeichens, die ich gelernt habe. Die Überlegung, also das völlig andere, mündet dann in mein Verhalten. Deswegen finde ich den Weg nicht zum behavioristischen Zeichenbegriff. Zeichen und Verhalten sind nicht das gleiche. Ein Zeichen kann sehr unterschiedliches Verhalten nach sich ziehen. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 29.01.2018 um 16.41 Uhr |
|
Andersherum: Welcher Erwachsene muß beim Anblick einer roten Ampel auch nur eine Millisekunde darüber nachdenken, was von ihm erwartet wird? (Die Überlegung, ob man das Signal ignoriert, ist natürlich etwas anderes.)
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 29.01.2018 um 16.33 Uhr |
|
Vielleicht ist es ja naiv, aber ich muß bei Konditionierung immer an den Hund denken, dem beim Hören eines Glockentons unwillkürlich der Speichel fließt. Wie paßt das damit zusammen, daß ich beim Anblick des Zeichens "rote Ampel" am Straßenrand stehenbleibe? Wurde ich etwa so konditioniert, daß ich, sobald ich eine rote Ampel sehe, unwillkürlich stehenbleiben muß? Vielleicht habe ich es noch nicht richtig verstanden, jedenfalls sperrt sich etwas in mir gegen den Gedanken, daß ich irgendwie "konditioniert" bin. Ich habe wohl etwas gelernt, aber das ist doch nicht das gleiche Verhalten wie beim Reflex eines Hundes (oder auch wie bei meinen unwillkürlichen Reflexen). Ich handle auf ein Zeichen hin nicht reflexhaft, sondern so, wie ich es aufgrund meines erlernten Wissens für besser halte, ggf. auch unterschiedlich. Daher habe ich mit dem Zeichenbegriff, der ein Zeichen mit einem bestimmten Verhalten gleichsetzt, noch Probleme. Das Zeichen hat wohl eine bestimmte Bedeutung, aber ob man sich auch entsprechend dieser Bedeutung verhält oder sie ignoriert, das steht doch wieder auf einem andern Blatt, oder? Letztlich komme ich über die Bedeutung des Zeichens immer wieder auf seine zwei Seiten zurück. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.01.2018 um 14.44 Uhr |
|
"Monolaterale" Zeichenmodelle (im Haupteintrag erwähnt) werden zwar postuliert, aber der Begriff hat keinen Sinn. Der behavioristische Zeichenbegriff operiert von vornherein nicht mit dem Bild von "Seiten", und schließlich ist eine Seite keine Seite. Das Zeichen im behavioristischen Sinn ist ein Gegenstand oder ein Verhalten mit einer Geschichte, und diese Geschichte (Konditionierungsgeschichte) ist die realistische Entsprechung jener mysteriösen zweiten Seite des herkömmlichen (phänomenologischen) Zeichenbegriffs. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.01.2018 um 06.40 Uhr |
|
Das Eichhörnchen wird durch die Nüsse nicht getäuscht. Sie sind keine Zeichen. Der Haselstrauch "will" nur indirekt, daß die Nüsse gefressen werden. Sie sollen aber dem Eichhörnchen schmecken. Er "will", daß die Eichhörnchen vergessen, wo sie die Nüsse versteckt haben. Dafür opfert er viele. (Ich reiße jedes Jahr einige Dutzend Pflänzchen aus, die von dem einzigen Haselstrauch stammen.) Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Versteckausbreitung Der Gang durch den Verdauungstrakt erhöht die Keimfähigkeit mancher Samen fleischiger Früchte. Außerdem: "Eine bedeutende Folge scheint zum einen die Entfernung von Pilzsporen zu sein. Man kann die Pilzbelastung der Samen messen, nachdem sie den Darm eines Vogels passiert haben, und das mit Samen vergleichen, die nicht verdaut wurden. Auf den Samen aus dem Darm sind viel weniger Pilze zu finden, was dazu führt, dass sich die Überlebensrate der Samen nahezu verdoppelt." Evan Fricke stellte auch fest, dass die vorverdauten Samen keinen typischen Eigengeruch mehr verströmen. Dadurch werden weniger Fressfeinde wie beispielsweise Ameisen angelockt. (DLF 9.8.13) Den Ameisen wird ein Teil des Musters entzogen, an dem sie die Samen erkennen. Der Eigengeruch ist aber nicht um der Ameisen willen entstanden und darum zwar Anzeichen, aber kein Zeichen. Oft ist es nicht leicht, Zeichen von bloßen Mustern zu unterscheiden, Mimikry von Zufall. Hier muß etwas offen bleiben ("Zeichenkandidaten"). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.01.2018 um 12.27 Uhr |
|
„Ein Zeichen ist ein Ding, das dazu dient, ein Wissen von einem anderen Ding zu vermitteln, das es, wie man sagt, vertritt oder darstellt. Dieses Ding nennt man das Objekt des Zeichens. Die vom Zeichen hervorgerufene Idee im Geist, die ein geistiges Zeichen desselben Objekts ist, nennt man den Interpretanten des Zeichens.“ (Peirce) Hat jemand die leiseste Ahnung, was das alles bedeutet? Wissen, Idee, Geist, geistiges Zeichen... wer kann damit heute noch etwas anfangen? Auch das "Vertreten" und "Darstellen" trifft ja offensichtlich nicht zu. Das Wort Glück vertritt nicht das Glück und stellt es auch nicht dar. Aber dieser Zeichenbegriff ist in verschiedenen Abwandlungen immer noch sehr beliebt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.12.2017 um 04.37 Uhr |
|
Statt sich vernünftige (sprachhistorische) Kenntnisse anzueignen, haben unzählige Sprachwissenschaftler ihre besten Jahre damit verbracht, die formalen Eigenschaften vermeintlich angeborener Universalgrammatiken zu analysieren. Nachdem diese Hirngespinste verweht sind, bleibt ein Haufen wertloser Bücher zurück, der entsorgt werden muß.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.04.2017 um 16.09 Uhr |
|
Die Zeichentheorien von Peirce, Morris usw. sind in meinen Augen reiner Unsinn (s. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#31975), aber ich möchte noch auf ein Problem hinweisen, das nicht nur hier auftritt. Sieht man sich zum Beispiel das Diagramm hier an: https://home.ph-freiburg.de/jaegerfr/Linguistik/texte/Morris%20Zeichentheorie.doc - so sieht man geometrische Eigenschaften, die gewissermaßen überschießen, weil sie nicht interpretiert werden können und sollen. Ich glaube, an Klaus Hegers Modell hat man es vor vielen Jahren auch schon kritisiert. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.03.2017 um 04.00 Uhr |
|
„Zwei fundamentale Gegebenheiten sind die folgenden: Erstens, die Sprache tritt uns nicht selbst, sondern nur in Form der verschiedenen Sprachen entgegen. Zweitens, die Sprache dreht sich zwar wesentlich um Bedeutung, diese ist aber nicht selbst wahrnehmbar, sondern nur die Zeichen, welche sie übermitteln.“ (Christian Lehmann: Thomas von Erfurt. (http://www.christianlehmann.eu/publ/Thomas_von_Erfurt.pdf) Ich versuche zu entmystifizieren: 1. Das Insekt tritt uns nicht selbst, sondern nur in Form verschiedener Insekten entgegen. 2. Eine Mausefalle hat eine Funktion; die sieht man aber nicht, man muß sie kennen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.11.2016 um 10.46 Uhr |
|
Die Theorie vom bilateralen Zeichen ermöglicht erst die seltsame Redeweise der Dudengrammatik: "Von Wortschöpfung spricht man dann, wenn eine Lautfolge erstmals Zeichencharakter erhält, indem ihr ein Inhalt zugewiesen wird." (2016:649) Als ob die Lautfolgen schon irgendwo herumschwirrten, ohne Zeichen zu sein, bevor jemand sie dazu macht! Die Namenerfinder im Auftrag von Renault haben doch nicht nach einer Bedeutung für Twingo gesucht, sondern nach einem schicken Namen für ein neues Auto. Ebenda wird der Firmenname Adidas als Wortschöpfung neben Twix und Twingo angeführt, kaum zu Recht, es steht ja auch die Ableitungsbasis Adi Dassler dahinter. (Seit wann Adolf Dassler Adi genannt wurde konnte ich nicht feststellen, vielleicht paarweise mit Rudolf/Rudi; zur Entnazifizierung der fortan verfeindeten Brüder s. Wikipedia.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.10.2016 um 03.39 Uhr |
|
Ich gebrauche ja den Begriff "Bedeutung" auch ständig, schon wegen meines Interesses an synonymischer Differenzierung, aber mir ist klar, daß ich ihn letzten Endes in Verhaltensbegriffe übersetzen müßte und auch könnte. Wie überhaupt die Eliminierung intentionaler Ausdrücke, die wir aus praktischen Gründen in der Alltagsrede beibehalten; Skinner selbst hat den Nutzen in nicht-theoretischer Kommunikation ausdrücklich anerkannt. Man könnte die praktische Unentbehrlichkeit mentalistischer Sprache wohl sogar beweisen. Wenn ich mich mit jemandem abstimmen will, muß ich ihm meine "Absichten" kundgeben, auch wenn ich theoretisch diesen Begriff ablehne. Das liegt daran, daß ich im Augenblick des Handelns die mein Verhalten steuernden Variablen nicht überblicke (nicht überblicken kann). Das gelingt bestenfalls einem Beobachter oder mir selbst post actum. Ich verweise nochmals auf Kap. 1 von "Verbal Behavior", wo all das, was man unter Bedeutung versteht, in Verhaltensbegrifflichkeit überführt wird. Natürlich zunächst nur grundsätzlich, die Ausfüllung kommt dann in dem ganzen Buch. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 18.10.2016 um 00.12 Uhr |
|
Mit Information meine ich eigentlich das gleiche wie mit Bedeutung, also nicht nur im mathematischen, sondern im allgemeinen Sinne. Information betont vielleicht besser das ideelle Wesen und die Rolle von Bedeutung. Letztlich ist sie eine bestimmte Ordnung bzw. Struktur der Materie.
|
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 16.10.2016 um 05.17 Uhr |
|
Zeichen: grünes Licht an der Fußgänger-Ampel (und zusätzlich ein marschierendes Ampelmännchen). Bedeutung: Fußgänger dürfen jetzt die Straße überqueren. Ich finde es ungemein praktisch, ein Zeichen und seine Bedeutung zu unterscheiden. Natürlich kann den Zusammenhang zwischen Zeichen und Verhalten auch ohne die "Bedeutung" des Zeichens erklären. Aber ist wirklich etwas gewonnen, wenn man die Angabe einer "Bedeutung" aus der Besprechung eliminiert? Genügt es nicht, einmal gezeigt zu haben, daß das Verhalten auch ohne eine sprachlich wiedergegebene "Bedeutung" des Zeichens erklärt werden kann? Wenn es irrig wäre, von der Bedeutung eines Zeichens zu reden, warum tun wir Normalbürger es dann? Die Rede von der Bedeutung eines Zeichens hat offensichtlich einen praktischen Wert. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.10.2016 um 05.10 Uhr |
|
"Information übermitteln" ist wieder eine andere Begrifflichkeit, die ich ja hier nicht gebraucht habe; man muß vorsichtig damit sein, von der einen in die andere zu wechseln. (Ganz abgesehen davon, daß "Information", wie Sie selbst am besten wissen, von Sprachwissenschaftlern und fast allen Gebildeten nicht im Sinne der mathematischen Informationstheorie gebraucht wird!)
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 15.10.2016 um 22.37 Uhr |
|
Ich werde es endlich lesen. Das wollte ich eigentlich schon seit längerem, aber daß ein Zeichen nichts bezeichnet und daß seine Funktion nicht darin besteht, eine Information zu übermitteln, macht mich endgültig neugierig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.10.2016 um 05.21 Uhr |
|
Aus naturalistischer Sicht gibt es kein Bezeichnetes und keine Referenz, diese Begriffe haben dort keinen Sinn. Es gibt nur Verhalten und steuernde Variable. Eine ausführliche Erklärung kann ich hier nicht geben. Ich verweise der Kürze halber auf Skinners "Verbal Behavior", das erste Kapitel genügt schon. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 14.10.2016 um 21.04 Uhr |
|
Dann ist also die Funktion das Bezeichnete? Die Funktion (Zweck, Aufgabe) des Halteverbotsschildes ist, dem Betrachter die Information "Hier ist Halten verboten" zu übermitteln. Haben wir nicht in dieser Information genau die ideelle Seite des Zeichens? Ob man sie nun in eine Funktion packt oder gleich als die eine Seite der Medaille ansieht, was macht das? Ob man die Funktion lernt oder einfach, welche Information zum Halteverbotsschild gehört, kommt aufs gleiche heraus. Und ob man die Funktion des Zeichens oder die zugehörige Information (Bedeutung) das Bezeichnete nennt, finde ich, obwohl ich begrifflich eher zu letzterem tendiere, eigentlich auch egal. Kurz gesagt, ich sehe bisher gar keinen Unterschied zum bilateralen Zeichenbegriff. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.10.2016 um 15.08 Uhr |
|
Halteverbotsschilder haben eine Funktion. Sie wird erlernt. Die Konditionierungsgeschichte liegt offen zutage. Wo ist da eine ideelle "Seite"? Die Dinge sind im Grunde einfach, Saussure hat sie so kompliziert, daß er sich selbst nicht mehr auskannte und aufgab.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 14.10.2016 um 14.44 Uhr |
|
Wenn man das Wort Inhalt so genau nimmt, als sei tatsächlich das Bezeichnete im Bezeichnenden physisch oder psychisch enthalten, dann ergeben sich wohl Widersprüche oder Mystisches. Ich meine aber, Inhalt, Wert, Bedeutung, Vorstellung sollte man in diesem Zusammenhang als Synonyme ansehen. Mit das Zeichen enthält das Bezeichnete ist doch einfach nur das gleiche gemeint wie mit das Zeichen hat die Bedeutung. Etwas anderes empfinde ich als Wortklauberei. Auch das Wort Seite (eines Zeichens) würde ich nicht physisch verstehen wie die Seite eines Gegenstands, sondern synonym zu Komponente. Warum sollen nicht materielle und ideelle Komponenten in einer Einheit verbunden sein, d. h. zusammengehören?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.10.2016 um 13.22 Uhr |
|
Auf "mystisch" bin ich gekommen, weil entweder Saussure selbst oder seine Schüler das Bild von den beiden Seiten eines Blattes Papier gebrauchen, die so wenig voneinander trennbar seien wie eben die beiden Seiten des Zeichens, das Bezeichnende und das Bezeichnete. Man könnte auch von einer Mystifikation sprechen. Naturalistisch gesehen, haben wir das Sprech- oder Schreib- oder sonstwie wahrnehmbare Verhalten (oder dessen Hinterlassenschaft) und andererseits die Faktoren, die es steuern. Beides "physisch", also nicht die Verbindung zwischen etwas Wahrnehmbaren und etwas "Geistigem". Bei Saussure sollen außerdem beide Seiten psychisch sein (Lautvorstellung und Gegenstandsvorstellung, im Geiste verbunden...), was die Sache zusätzlich kompliziert. Mit einem Zeichen, das das Bezeichnete "enthält", kann man natürlich nichts mehr bezeichnen, das ist ja alles schon inhärent geschehen. Ich verstehe das alles nicht, kann es bloß nachstammeln und mich davon distanzieren. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 14.10.2016 um 11.53 Uhr |
|
Ich gebe zu, daß ich hier nicht alles verstehe, aber da ich mich damit offenbar in guter Gesellschaft mit so manchem bekannten Sprachwissenschaftler (z. B. Eisenberg) befinde, traue ich mir doch mal ein paar Fragen. Was ist eigentlich am bilateralen Zeichenbegriff nach Saussure so mystisch? Ein Zeichen besteht im Zusammenhang zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem, das eine geht nicht ohne das andere. Soweit ist der Begriff des Zeichens für mich völlig klar, ich empfinde das geradezu als selbstverständlich, es ist beinahe in dem Wort Zeichen schon exakt so enthalten. Was ist falsch oder naiv daran? Das Mystische kommt für mich erst auf, wenn diese klare Definition zerredet wird, da gebe es Unterschiede zwischen den Termini Wert, Bedeutung, Inhalt, Vorstellung, was noch alles? Bedeutungen seien nicht alphabetisch sortierbar, verschiedene Zeichen (z. B. Wörter aus verschiedenen Sprachen) haben die gleiche oder leicht voneinander abweichende oder schwer metasprachlich beschreibbare Bedeutungen, und was nicht sonst noch alles an "Problematischem" genannt wird. Na und? Was hat das mit dem Grundbegriff zu tun? Ich wüßte gern, was eigentlich an einem naturalistischen Zeichenbegriff anders ist. Wie lautet da die Zeichendefinition? Kann man sie ähnlich kurz und klar und leicht verständlich wie die Saussure'sche aufschreiben? (Falls es hier schon irgendwo steht, bitte um Entschuldigung, ich habe es nicht gefunden.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.10.2016 um 05.24 Uhr |
|
Aus der Dudengrammatik hatte ich schon Eisenberg zitiert: „Jedes Wort hat eine Formseite und eine Inhaltsseite (Bedeutung).“ (auch in der Neubearbeitung 2016:19) Dazu noch: „Die Morpheme der Wortstämme weisen eine bestimmte Form und eine bestimmte Bedeutung (oder Bedeutungspalette) auf, sind also Verbindungen von Form und Bedeutung. Als Morpheme lassen sich aber auch Elemente mit grammatischer Funktion auffassen. Sie haben dann keine Bedeutung im landläufigen Sinn, das heißt, sie referieren nicht auf eine Vorstellung.“ (148, Gallmann) Der mysteriöse bilaterale Zeichenbegriff Saussures wird fortgeführt, die Bedeutung hypostasiert. Bei einer Mausefalle würde man nicht sagen, sie sei eine „Verbindung“ von Form und Funktion. Gallmann geht von der Bedeutung ohne weiteres zum „Referieren“ über, von dort zur „Vorstellung“, einem folk-psychologischen Begriff. Diese Mystifikationen bleiben allerdings folgenlos. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.07.2016 um 06.02 Uhr |
|
Nachdem das Institut für deutsche Sprache sich zu Saussures mystischem Zeichenbegriff bekannt hat, fährt es fort: Unter einem umfassenden semiotischen (zeichentheoretischen) Aspekt, kann man mit einem anderen Semiotiker, Umberto Eco, so weit gehen, die komplette Welt als zeichenhaft zu betrachten. Bei dieser Annahme bestünde unsere Welt ausschließlich aus Zeichen, welche Bedeutung besitzen und dadurch interpretierbar wären. (statt "komplett" sollte es "ganz" heißen, statt "besitzen" "haben") Wenn es nur Zeichen gibt, hat der Begriff nichts Unterscheidendes mehr. Ich habe schon erörtert, wohin das führt und wie man es verhindern kann. (Ist das Ableben Ecos auch nichts weiter als ein Zeichen? Wer will uns damit was zu verstehen geben?) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.05.2016 um 09.12 Uhr |
|
„Ce n’est pas ‘Gäste’ qui exprime le pluriel, mais l’opposition ‚Gast : Gäste’.” (Saussure) Dieses oft zitierte Beispiel soll die strukturalistische Denkweise erläutern. Aber man darf es nicht zu genau nehmen (und die Nachschrift von Saussures Vorlesung nicht auf die Goldwaage legen). Vom Glanz befreit, sagt der Satz nur, daß es keinen Plural gibt, wo es nicht auch den Singular gibt: Kein Numerus ohne Numerusunterscheidung. Die Opposition drückt keineswegs den Plural aus, sondern ist dessen Vorbedingung. Umwerfend wird man diese Einsicht nicht finden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.03.2016 um 18.13 Uhr |
|
Die innere Rede ist schwer zu beobachten und wird daher in der psychologischen Literatur nur selten behandelt, von der Sprachwissenschaft fast gar nicht. Dabei sind wir wahrscheinlich sehr viel mehr mit innerem als mit äußerem Reden beschäftigt. Alle Untersuchungen deuten darauf hin, daß wir den größen Teil unserer wachen Zeit innerlich vor uns hin sprechen. Wir legen uns zurecht, was wir sagen wollen, rekapitulieren, was wir und andere gesagt haben, kommen immer wieder darauf zurück, was wir eigentlich hätten sagen sollen usw.; unsere Tagträume sind von Sprache begleitet. Mit dieser inneren Rede üben wir das Sprechen ein, auch fremdsprachliches (leider ohne Korrektur). Die Realität dieses inneren Sprechens wird nicht bestritten, nicht einmal von strengen Behavioristen, die es als „covert verbal behavior“ bezeichnen. Auch wenn man Introspektion ablehnt, wird man kaum beweifeln, daß es so etwa wie stummes Sprechen gibt. Seine Herkunft ist in gewisser Hinsicht klar: Es kann nur aus dem offenen Sprechen stammen, das der Sprecher ja von seinen Mitmenschen gelernt haben muß. (Dazu auch Sibylle Wahmhoff: Inneres Sprechen. Psycholinguistische Untersuchungen an aphasischen Patienten. Weinheim und Basel 1980; mit Bezug auf Wygotski). Kleine Kinder sprechen zunächst laut vor sich hin, bis man ihnen eine Grundregel der zivilsierten Gesellschaft beibringt: „No talking to oneself in public“.“ (Erving Goffman: „Response cries“. In: Language 54, 1978, S. 787-815, S. 793) „Our society places a taboo on self-talk.” (Ebd. S. 788). Auch Skinner kommt in „Verbal Behavior“ mehrmals darauf zurück: Children should be seen but not heard. Zunächst bewegen sie noch die Lippen, und auch später kann man etwa beim stummen Lesen Muskelinnervationen nachweisen. Auch Zungenbrecher können, wie berichtet wird, selbst bei stummem Sprechen schwierig bleiben und unangenehme Empfindungen auslösen. A. Charles Catania spricht einige Probleme an: Another candidate for a crucial human versus nonhuman difference is the capacity to discriminate one's own covert behavior, to which Horne and Lowe occasionally appeal (e.g., "As with the echoic, higher order naming may become increasingly covert and abbreviated in form and may indeed be learned at the covert level of responding, this being reinforced and maintained by a range of consequences," p. 203). But to what is one responding in discriminating one's covert vocalizations, which by definition produce no sound? Are the relevant stimuli akin to auditory hallucinations (Jaynes, 1977)? Are they like the abbreviated articulatory muscle movements of the motor theory of consciousness (Max, 1934)? In either case, what might the phylogenic origins of such discriminations of the covert be? Perhaps it does not matter whether we can identify receptors (although Skinner, 1988, p. 194, argued that we cannot introspect cognitive processes "because we do not have nerves going to the right places"). It would be gratuitous, however, to assume that one cannot help knowing that one is talking to oneself. After all, individuals sometimes talk to themselves overtly without knowing it, and the covert should be less discriminable by virtue of its lesser magnitude. Horne and Lowe allude to the implications their account has for the concept of verbal consciousness, but the problem of covert verbal behavior implies that the resolution lies with applying the analysis of the language of private events (as in Skinner, 1957, pp. 130-146) to the synthesis of naming. (A. Charles Catania: „Natural contingencies in the creation of naming as a higher order behavior class“. JEAB 65/1996:276-279; S. 278f.) Nach einer Beobachtung Wackernagels (Vorl. I:109) stehen Selbstgespräche bei Homer immer in der ersten Person, nur jenes „τέτλαθι δή, κραδίη· καὶ κύντερον ἄλλο ποτ’ ἔτλης“ des Odysseus (υ 18) ist eine Ausnahme (eine halbe, denn Odysseus spricht ja sein Herz, nicht sich selbst an). Die Gewohnheit des inneren Sprechens ist die Hauptursache der Auffassung, daß Denken überhaupt sprachlich sei. Das ist nicht nur eine philosophische Überzeugung, sondern tief in der Grammatik verankert. So werden Gedanken in der Form direkter und indirekter Rede angeführt. Da „wir“ ja wissen, was wir sagen wollen, kann die innere Rede knapp und schnell sein. Vielleicht ist sie oft weitgehend fragmentarisch ausgearbeitet, ohne aber an Wirksamkeit auf „uns“ selbst einzubüßen: „Wir“ reagieren auch schon auf das nur Angedeutete. (Die Anführungszeichen sollen andeuten, daß nicht klar ist, wer hier wen beobachtet.) Wie kohärent sind die Texte der inneren Rede? Die Erfahrung des inneren Sprechens und damit die Meinung, Denken sei überhaupt sprachlich, mag auch der Theorie von einer „Sprache des Geistes“ (Language of thought, Mentalesisch usw.) zugrunde liegen, das innere Sprechen ist aber nicht damit zu verwechseln. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.03.2016 um 18.47 Uhr |
|
Learning a word includes the pairing of a phonological representation of its sound with a representation of its meaning. (Susan Carey in Eric Wanner/Lila R. Gleitman (Hg.): Language acquisition. The state of the art. Cambridge 1982:348) Offenbar nach dem Vorbild eines Wörterbuchs, ganz naiv und bis heute die herrschende Lehre. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.03.2016 um 04.33 Uhr |
|
Wohin die undurchschaute Metapher vom bilateralen Zeichen führt, sieht man an Christa Dürscheid, die behauptet, Phoneme hätten "nur eine Ausdrucksseite" (Einführung in die Schriftlinguistik). Ausdruck ist ja immer Ausdruck von etwas. Sonst könnte man von beliebigen Gegenständen und Ereignissen sagen, sie wiesen nur eine Ausdrucksseite auf: Bäume, Schneeflocken... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.02.2016 um 05.17 Uhr |
|
Der gerade verstorbene Umberto Eco hat eine konventionelle, auch von der Scholastik beeinflußte Zeichentheorie vertreten, die meiner Auffassung von einem naturalistischen Zeichenbegriff entgegengesetzt ist. Ich bringe einige Zitate und anschließend ein paar ältere Aufzeichnungen von mir selbst. „Eine Zeichen-Funktion liegt immer dann vor, wenn es eine Möglichkeit zum Lügen gibt: das heißt, wenn man etwas signifizieren (und dann kommunizieren) kann, dem kein realer Sachverhalt entspricht. Eine Theorie der Codes muß alles untersuchen, was man zum Lügen verwenden kann. Die Möglichkeit zum Lügen ist für die Semiose das proprium, so wie für die Scholastiker die Fähigkeit zum Lachen das proprium des Menschen als eines animal rationale war. Wo Lüge ist, da ist auch Signifikation. Wo Signifikation ist, da ist auch die Möglichkeit zum Lügen. Wenn das stimmt (und es ist methodologisch notwendig, das zu behaupten), dann haben wir eine neue Grenze des semiotischen Bereichs gefunden: nämlich die zwischen Signifikationsbedingungen und Wahrheitsbedingungen, anders ausgedrückt: die Grenze zwischen einer intensionalen und einer extensionalen Semantik. Eine Theorie der Codes befaßt sich mit einer intensionalen Semantik, während die Probleme, die mit der Extension eines Ausdrucks zusammenhängen, in den Bereich einer Theorie der Wahrheitswerte oder einer Theorie der Hinweisakte gehören. Doch handelt es sich hier um eine 'innere' Grenze, und sie muß nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft als eine methodologische Grenze gesehen werden.” (Umberto Eco: Semiotik. Ein Entwurf einer Theorie der Zeichen. München 1991:89) „Zeichen sind keine empirischen Objekte, die sich in der Welt vorfinden lassen wie etwa Bäume oder Häuser. Sie sind nicht «da» wie Fakten in der Welt, sondern sie lassen sich allenfalls an solchen aufweisen. Und sie existieren nur, soweit sie dabei als Hinweise für anderes genommen werden. Haarbüschel oder Markierungen im Schnee stellen von sich aus nichts vor, sondern werden erst zu deutbaren Spuren kraft einer Zuschreibung, die sie etwas ausdrücken lässt, was in ihnen nicht enthalten ist. Insbesondere folgt daraus, dass als Zeichen nur erkannt wird, was als solches «gelesen» werden kann. Dieses wiederum setzt vorgängiges Sich-darauf-Verstehen, also auch Verständnis voraus: Die Fährten eines Tieres vermag nur zu finden, wer sich auskennt, denn ein Unverständiger wüsste vermutlich weder, worauf er zu achten hätte, noch ob das, was er gerade vor sich hat, überhaupt zu interpretieren ist oder nicht. Das gleiche gilt für Bodenwellen oder Erosionen, die dem Geologen vielleicht ein dramatisches Kapitel der Erdgeschichte offenbaren, wo der naive Betrachter bestenfalls ein ästhetisches Naturschauspiel wahrnimmt. Zeichen sind Funktionen; sie sprechen nicht für sich selbst, sondern für ein anderes, das sie nicht sind und das deshalb aus ihnen erst «herauszubringen» (dia-legere) ist. [...] Oft ist es sogar gerade das in täuschender Absicht Verheimlichte, das für die kriminalistische Untersuchung ausschlaggebend wird. D.h. die Zeichen können trügen, sie können das, worauf sie zeigen, verbergen. Das gilt vor allem für die falschen Fährten, die gelegt werden, um von anderem abzulenken, oder für Spuren, die beim Versuch entstehen, sämtliche Spuren zu verwischen. [...] Zeichen sind daher für Eco alles, «was man zum Lügen verwenden kann» (SZ 26, 89). Ihr Vorhandensein bedeutet nicht notwendig, etwas offenbar zu machen, sondern gleichermaßen, mit ihrer Hilfe etwas kaschieren oder vertuschen zu können. Daraus folgt die Notwendigkeit ihrer Interpretation. Zeichen sind nicht allein eine Frage der Erkenntnis, sie gehen nicht unmittelbar in dem auf, was sie repräsentieren. Entsprechend hat es der Detektiv mit Hinweisen zu tun, die regelmäßig etwas anderes bedeuten können als sie zu bezeugen scheinen. Wenn es für ihn also darauf ankommt, das Entscheidende hinter einer Tat und ihr Zustandekommen herauszufinden, die Lüge zu demaskieren und den «tatsächlichen» Hergang bloßzulegen, so darf er sich nicht allein auf die Referenz der Zeichen verlassen, sondern er muss auf die Differenz zwischen Bezeichnung und Bedeutung pochen. Er muss sozusagen die wesentliche Dreistelligkeit des Zeichens in Rechnung stellen. Erst sie markiert die eigentliche «Schwelle der Semiotik». Allein das Kriterium des Sinns erlaubt, «den gesamten Kreis der Semiose abzudecken» (SS, 73). [...] Zeichen sind also immer nur im Hinblick auf einen vollständigen Text lesbar. Der Prozess der Semiose bildet ein komplexes Geschehen, das einzig im Verweis auf ein ganzes Netz anderer Zeichen abgerundet werden kann. Keinem Zeichen käme für sich alleine Bedeutung zu; vielmehr sind innerhalb eines Systems alle Zeichen ausschließlich in Beziehung zueinander deutbar. Das ist vor allem für die Rechtsprechung relevant.” (Dieter Mersch: Umberto Eco zur Einführung. Hamburg 1993:56ff.) „Wenn ein Code die Elemente eines übermittelnden Systems den Elementen eines übermittelten Systems zuordnet, so wird das erste zum Ausdruck des zweiten und das zweite zum Inhalt des ersten. Eine Zeichen-Funktion entsteht, wenn ein Ausdruck einem Inhalt korreliert wird, wobei die beiden korrelierten Elemente die Funktoren einer solchen Korrelation sind. Wir sind jetzt in der Lage, den Unterschied zwischen einem Signal und einem Zeichen zu erkennen. Ein Signal ist eine relevante Einheit eines Systems, das ein einem Inhalt zugeordnetes Ausdruckssystem, aber ebenso auch ein (dann von der Informationstheorie in engerem Sinn als solches untersuchtes) rein physikalisches System ohne jeden semiotischen Zweck sein kann; ein Signal kann ein Reiz sein, der nichts bedeutet, aber etwas bewirkt; es kann aber, wenn es als erkanntes Vorgängiges zu einem vorhergesehenen Nachfolgendem benutzt wird, als Zeichen betrachtet werden, insofern es (für den Sender oder den Empfänger) für sein Nachfolgendes steht. Ein Zeichen korreliert immer Elemente einer Ausdrucksebene mit Elementen einer Inhaltsebene. Immer wenn eine von einer menschlichen Gesellschaft anerkannte Korrelation dieser Art besteht, liegt ein Zeichen vor. Nur in diesem Sinn ist es möglich, Saussures Definition, wonach ein Zeichen die Entsprechung zwischen einem Signifikanten und einem Signifikat ist, zu akzeptieren. Aus diesem Ansatz ergeben sich einige Konsequenzen: (a) Ein Zeichen ist keine physische Entität, denn diese ist höchstens das konkrete Exemplar des relevanten Ausdruckselements; (b) ein Zeichen ist keine fixe semiotische Entität, sondern eher ein Treffpunkt unabhängiger Elemente (die aus zwei unterschiedlichen Systemen zweier verschiedener Ebenen kommen und aufgrund einer Codierungskorrelation assoziiert werden). Genau genommen gibt es nicht Zeichen, sondern nur Zeichenfunktionen. Hjelmslev zufolge »scheint es aber angemessen zu sein, das Wort Zeichen zu verwenden als Name für die Einheit aus Inhaltsform und Ausdrucksform, die von der Solidarität, die wir die Zeichenfunktion genannt haben, etabliert wird« (1943 [1961: 58]; dt. 1974: 61). Eine Zeichenfunktion kommt zustande, wenn zwei Funktive (Ausdruck und Inhalt) in wechselseitige Korrelation zueinander treten; dasselbe Funktiv kann auch in eine andere Korrelation eintreten, wodurch es ein anderes Funktiv wird und eine neue Zeichenfunktion entstehen lässt. Zeichen sind also das vorläufige Ergebnis von Codierungsregeln, die transitorische Korrelationen von Elementen festsetzen, wobei jedes dieser Elemente - unter vom Code bestimmten Umständen - auch in andere Korrelationen eintreten und so ein neues Zeichen bilden kann. Man kann sogar sagen, es sei nicht richtig, dass ein Code Zeichen organisiere; richtiger sei es zu sagen, Codes stellten die Regeln bereit, die im kommunikativen Verkehr Zeichen als konkrete Gebilde generieren. Der klassische Begriff >Zeichen< löst sich also auf in ein hochkomplexes Netzwerk wechselnder Beziehungen. Die Semiotik sieht hier eine Art molekularer Landschaft, in der das, was wir als alltägliche Formen zu erkennen gewohnt sind, sich als Resultat vorübergehender chemischer Aggregationen erweist und die so genannten >Dinge< nur das Oberflächenbild eines zugrundellegenden Netzwerks elementarerer Einheiten sind. Oder, besser, die Semiotik gibt uns eine Art photomechanischer Erklärung der Semiose, indem sie uns enthüllt, dass da, wo wir Bilder zu sehen glaubten, sich nur strategisch angeordnete Aggregationen schwarzer und weißer Punkte befinden, Alternationen von Anwesenheit und Abwesenheit, die nicht‑signifizierenden, nach Gestalt, Position und Farbintensität verschiedenen Grundelemente eines Rasters. Wie die Musiktheorie stellt die Semiotik fest, dass da, wo wir bekannte Melodien erkennen, nur eine komplizierte Verflechtung von Intervallen und Noten vorliegt, und wo wir Noten wahrnehmen, nur Bündel von Formanten.” (Umberto Eco: Semiotik. Ein Entwurf einer Theorie der Zeichen. 2., korrigierte Ausgabe. München 1991, S. 76ff.) „Wir beschränken uns darauf, eine neue Version des Dreiecks zu geben, bei der wir an jede Spitze die von unterschiedlichen Klassifikatoren gebrauchten verschiedenen Kategorien eintragen: (...) Wie man sieht, gibt es einen Konsensus des gesunden Menschenverstandes zwar über die Dreiteilung, aber nicht über die Namen, mit denen man die drei Pole bezeichnen soll. Ja man hat sogar das, was wir als Gegenstand bezeichneten, als /Signifikat/, und das, was wir /Signifikat/ nannten als /Sinn/ bezeichnet. In manchen Fällen handelt es sich um bloße terminologische Divergenzen, in anderen verbergen sich unter den terminologischen Divergenzen tiefgehende Unterschiede im Denken. Eine Untersuchung dieser klassifkatorischen Alternativen müsste zu einer umfassenden und polemischen Geschichte der Semantik geraten.“ (Umberto Eco: Zeichen. Einführung in einen Begriff und seine Geschichte. Frankfurt 1977:30f.) Aus meinen Bemerkungen zu Eco: Wenig klärend ist die Behauptung Ecos, jedes Werkzeug oder Bauwerk sei Zeichen, weil es nur dann benutzt werden könne, wenn es den Benutzer auf seine Funktion verweise. Kein Gegenstand kann benutzt werden, wenn man nicht gelernt hat, mit ihm umzugehen. Was soll es darüber hinaus heißen, daß ein Stuhl oder eine Treppe auf ihre Funktion „verweisen“? Ein Laserstrahl, so Eco, schneide so gut wie ein Messer, teile aber dem Laien, der den „Code“ nicht besitzt, diese Funktion nicht mit. Kein Gegenstand teilt seine Funktion mit. Bei Eco wird diese sonderbare Lehre anscheinend dadurch erzwungen, daß er auf jeden Fall die semiotische Lehre von „signifié“ und „signifiant“ beibehalten will. Der angenommene Zeichenträger Treppe muß um der Theorie willen auf etwas verweisen; also verweist er auf seine Funktion, das Hinaufsteigen. Wahrscheinlich spielt auch eine Rolle, daß wir eine Beziehung, deren Entstehung uns phänomenal unzugänglich ist, subjektiv als eigentümliche Anmutung erleben; man denke an das über sich Hinausweisende eines ausgestreckten Fingers oder eines Pfeiles, das gleichsam Einladende eines Henkels, das Auffordernde eines Türgriffs (Wilhelm Schapps „Wozu-Dinge“). Die Betrachtung und sogar schon die anschauliche Vorstellung einer Treppe kann die instrumentell nachweisbaren Muskelinnervationen der Steigbewegung auslösen (ideomotorisches Prinzip, Carpenter-Effekt), und dies ist vielleicht die physiologische Grundlage jenes Erlebens, selbstverständlich nur unter dem Einfluß vorausgegangener Erfahrung, die aber bewußtseinsfremd geworden ist. Raffiniertere „Instrumente“ wie der Laserstrahl entbehren dieser unmittelbaren Anmutung, weil sie weiter von der alltäglichen Praxis entfernt sind; diesen Unterschied mag Eco im Auge gehabt haben. Es ist aber kein semiotisch bedeutsamer. - Ein Fliehkraftregler kann physikalisch oder kybernetisch-informationstheoretisch beschrieben werden. Daniel Dennett hat keine Bedenken, auch solche einfachen Apparate als intentionale Systeme zu bezeichnen. Wenn Eco (1972:47f.) das verhältnismäßig aufwendige Beispiel eines homöostatischen Apparates zur Wasserstandsregelung vorstellt, so liegt es natürlich nahe, darauf die Begriffe der Nachrichtenübertragung anzuwenden. Aber grundsätzlich sind auch der Fliehkraftregler, der Thermostat am Heizkörper oder der einfache Füllmechanismus eines Toilettenspülkastens solche homöostatischen Apparate (mit negativer Rückkoppelung, also teleologische Maschinen im Sinne Norbert Wieners), und da fällt es schon schwerer, von Nachrichten, Code usw. zu sprechen. Im Organischen wäre die Gamma-Schleife des Muskelspindel-Apparates ein anschauliches Beispiel für positive Rückkoppelung im Sinne eines Servomechanismus. (Solche Fälle sind selten, weil positive Rückkoppelung in der Regel zur Zerstörung eines Systems führt.) Die Informationstheorie ist kein Zweig der Semiotik. Ihre Begriffe wie Information, Redundanz, Entropie, Signal, Steuerung usw. haben mit Zeichen im eigentlichen Sinne gar nichts zu tun. Anders gesagt: Die Informationstheorie sieht nicht nur vom Inhalt der Signale ab und beschränkt sich auf die Wahrscheinlichkeit ihres Eintreffens, sondern die „Signale“ der Informationstheorie haben als solche gar keinen „Inhalt“. Es gibt keinen Grund, hier überhaupt von „Botschaften“ zu sprechen (Eco 1972:54f.). Eine solche Deutung ist erst im Zusammenhang mit dem gesteuerten Apparat sinnvoll. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.02.2016 um 05.45 Uhr |
|
„Die Grammatik befaßt sich mit der Laut-Bedeutungs-Zuordnung in sprachlichen Äußerungen.“ (Karl Erich Heidolph in: Ludger Hoffmann (Hg.): Deutsche Syntax. Ansichten und Aussichten. Berlin, New York 1992:397) Heidolph sagt ausdrücklich, daß diese Auffassung in die „Grundzüge“ eingegangen sei, also die lange Zeit einflußreiche Akademiegrammatik. Es ist aber auch sonst die weithin herrschende Auffassung. Ein fatales Erbe Saussures. Als wenn es sozusagen zwei Reihen von Gegenständen gäbe, die Lautgebilde und die Bedeutungen. Daher dann auch im "mentalen Lexikon" ein Speicher für Bedeutungen. "Was bedeutet x?" ist harmlos, aber "Was ist die Bedeutung von x?" verführt zur Hypostasierung. Man könnte es für bloße Redeweisen halten, aber die Psycho- und Neurolinguistik machen sich auf die Suche nach dem Sitz dieser Bedeutungen im Kopf, und das ist nicht mehr harmlos. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.01.2016 um 05.25 Uhr |
|
Die Abbildung oder Repräsentation der Wortbedeutung sollte man nicht immer nur an Konkreta festmachen, sondern auch an Wörtern wie Rest oder Gliederung. Wie kann das „Konzept“ Gliederung gespeichert sein? Hier entfällt die sonst so verführerische Vorstellung von „Bildern“. Die Menschheit hat bestimmt 100.000 Jahre gebraucht, bis sie solche abstrakten, zusammenfassenden Wörter gefunden hat, die auf anderen, komplizierten Redeweisen aufbauen. Die angemessene Definition solcher Begriffe wäre von der Form: „Gliederung ist, wenn man...“, und dann folgt eine längere Geschichte über typische Erfahrungen. Aber wie „repräsentiert“ man das in einem „mentalen Lexikon“?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.08.2015 um 04.40 Uhr |
|
Dazu: de.wikipedia.org/wiki/E._M._Forster www.amazon.de/T-Shirt-Fun-Shirt-Woher-wissen-denke/dp/B00OTNIAME Der Klassiker ist natürlich Kleists Aufsatz über die allmähliche Verfertigung der Gedanken. |
Kommentar von Jan-Martin Wagner, verfaßt am 10.08.2015 um 19.05 Uhr |
|
Zu #29651: Einer meiner Freunde hat es so auf den Punkt gebracht: »Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?« Das hat er so von seinem Großvater gehört, wobei er aber nicht weiß, ob der das selber geprägt oder von woanders her hat. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.08.2015 um 04.38 Uhr |
|
Um noch einmal den Grundgedanken zu formulieren: Die Entstehung der Rede im Kopf ("Aktualgenese") wird von den meisten heutigen Linguisten und Sprachpsychologen so aufgefaßt: Am Anfang steht der Inhalt der zu formulierenden Sätze. Er scheint in irgendeiner Gedankensprache (Language of thought) abgefaßt sein zu müssen. Er wird dann sukzessive in die jeweilige Sprache übersetzt. Die Fehlerpsychologie (Versprecherforschung usw.) versucht die Abfolge der Bearbeitungsstadien herauszufinden, also die syntaktische, morphologische, phonetische "Enkodierung". Nach behavioristischer Auffassung ist es andersherum. Am Anfang steht ein diffuser Impuls, der auf eine Reaktion hinauslaufen wird, aber auf diesem Weg wird er durch verschiedene Faktoren (multiple causation, wie bei Skinner breit dargestellt) so geformt, daß er am Schluß situationsangemessen ist (bestimmte Reaktionen des Partners steuert). Die Bedeutung, also die Situationsangemessenheit, steht am Ende, nicht am Anfang der Aktualgenese. Das meinte offenbar auch Joubert mit seiner hier zitierten Bemerkung. Jenes kognitivistische Gegenmodell ist uralt und naiv. Es bringt die Neurolinguistik auf eine falsche Spur, denn die Gedankensprache und die vorab formulierten Inhalte bzw. deren neuronale Korrelate wird man nie finden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.08.2015 um 07.28 Uhr |
|
Hierzu auch: „En composant, on ne sait bien ce qu’on voulait dire que lorsqu’on l’a dit. Le mot en effet est ce qui achève l'idée et lui donne l'existence. C'est par lui qu'elle vient au jour, in lucem prodit.“ (Joubert: Pensées 101) Fritz Schalk übersetzt: „Beim Dichten weiß man erst, was man sagen wollte, wenn man es gesagt hat. Das Wort erst vollendet die Idee und gibt ihr das Leben. Durch das Wort kommt sie zutage, in lucem prodit.“ Gilt aber nicht nur für das Dichten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.07.2015 um 16.23 Uhr |
|
„Die Auswahl, die auf Grund des gemeinten Sinnes der Sprechende unter den bereitliegenden Worten trifft, ist das eigentliche Grundphänomen des natürlichen Sprechens. In einer vollständig beherrschten Sprache z. B. der Muttersprache ist dieses Wählen am geheimnisvollsten. In einer halbbeherrschten fremden Sprache ist es leichter zu verstehen; entweder gehe ich den gedächtnismäßig bewahrten Vorrat von Synonyma durch oder ich benutze ein Nachschlagewerk und stelle so den Satz nach den mir bekannten syntaktischen Regeln der Wortordnung und Flexion zusammen.“ (Julius Stenzel: Philosophie der Sprache. München, Berlin 1934:45) Stenzel problematisiert dann das Modell von vorausgehendem Sinn und Wortwahl. Aber der naive Mensch wird immer dabei bleiben: Erst weiß ich, was ich sagen will, und dann sage ich es. Die meisten Linguisten denken auch so. Das zeigen selbst die ausgefeiltesten Modelle der "Sprachproduktion", besonders kraß Willem Levelt. Anderswo hatte ich schon folgendes Zitat gebracht: „Von all dem (sc. wie es beim Sprechen in uns zugeht) hat der unbefangen sprechende Mensch selbstverständlich keine Ahnung. Er braucht Wörter, die zu Sätzen gefügt sind. Beide braucht er nicht zu suchen: sie bieten sich ihm 'von selbst' dar. Und das ist gut, denn wie sollte er sie suchen? Er kennt sie ja gar nicht abgelöst von der Situation, in der er sie gebraucht. Wir sagen zwar, daß der Sprecher 'seine Worte wählt'. Aber das stimmt gar nicht. Niemand kann den Wortschatz angeben, über den er im Bedarfsfalle verfügt, und nur mit Mühe und unvollständig bringt er wenigstens die Wörter für ein bestimmtes begrenztes Sachgebiet zusammen.“ (Walter Porzig: Das Wunder der Sprache. Stuttgart 1993:166 [=1950]) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.06.2015 um 04.35 Uhr |
|
„Sprache nennen wir die Wiedergabe und Mitteilung der Vorstellungen unseres Denkens durch die geregelten Lautgebilde unserer Sprachwerkzeuge.“ (Ludwig Sütterlin: Die deutsche Sprache der Gegenwart, S. 1) „Wörter nennt man die kürzesten selbständigen Lautzusammensetzungen, die eine Empfindung oder einfache Vorstellung wiederspiegeln, wie pst, an, Hund lieblich.“ (ebd. S. 87) Denselben Psychologismus finden wir bei anderen Grammatikern um 1900, wie bei Hermann Paul schon gezeigt. Es ist die harmlose Form, denn was Sütterlin anschließend und im ganzen Buch immer wieder mal als "gedanklich" oder "begrifflich" anführt, also Mehrzahl, Geschlecht usw., läßt sich rein funktional ausdrücken ohne Bezugnahme auf Psychisches. Der Strukturalismus hätte die Gelegenheit gehabt, das psychologistische Erbe ganz abzuwerfen, aber Saussure hat im Gegenteil eine radikale, wenn auch kaum verständliche Psychologisierung vorgenommen. (Auch Baker/Hacker zeigen das in ihrem großartigen Werk "Language, sense and nonsense".) Die nächste Etappe war Chomsky, für den die Linguistik ein Zweig der Psychologie (natürlich der spekulativen, rationalistischen, unwissenschaftlichen) ist. Nur der Behaviorismus hat sich vom Psychologismus befreit, also ausgerechnet eine psychologische Wissenschaft vom menschlichen Verhalten. Die heutigen deutschen Grammatiken sind ausnahmslos psychologistisch, ihre Verfasser jedoch keine Psychologen... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.04.2015 um 04.09 Uhr |
|
Die naive Zeichentheorie (Semiotik) hat zwei komische Höhepunkte zu bieten: die Pioneer-Plakette von 1972 und die "Atomsemiotik". Wie lustig die ganze Diskussion um jene Weltraumbotschaft war, kann man überall nachlesen. Die ernstere Seite betrifft den unbemerkten Anthropozentrismus, also die Voraussetzung, daß sich Zeichensysteme anderswo in grundsätzlich ähnlicher Weise wie bei uns entwickeln würden. Die Atomsemiotik nimmt sich vor, für Zehntausende von Jahren vorzusorgen und die Menschen der Zukunft vor den Gefahren unserer Atommüll-"Endlager" zu warnen. In diese Phantasien platzten dann die Nachrichten über die Asse usw., die uns zeigten, daß schon 30 Jahre zuviel für eine Gattung von Geschäftemachern sind. Sehr witzig auch der Untertitel dieses Buches: Roland Posner: "Warnungen an die ferne Zukunft. Atommüll als Kommunikationsproblem". Raben Verlag 1990. Die Semiotiker und Rhetoriker haben ja auch schon Kriege als mißlungene Kommunikation erklären wollen, im kleinen auch Eheprobleme. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.12.2014 um 04.51 Uhr |
|
Zum Thema dieses Eintrags gibt es einen kurzen und guten Aufsatz von Calvin Normore: http://hplinguistics.pbworks.com/f/%28Optional%29+Normore+2009+end+of+ML.pdf Übrigens bin ich zufällig auf die Einschätzung dieses nicht sehr bekannten Philosophieprofessors gestoßen: http://www.ratemyprofessors.com/ShowRatings.jsp?tid=111450 Normore wird die geradezu schwärmerischen Beurteilungen gern lesen, aber selbst dort findet jemand ein Haar in der Suppe; man kann es eben nicht allen recht machen. Wittgenstein würde bei Studenten wahrscheinlich durchfallen. Interessant ist noch, daß wie auch sonst oft rühmend hervorgehoben wird, der Professor benutze kein PowerPoint! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.10.2014 um 14.08 Uhr |
|
„People have things to talk about only by virtue of having represented them.“ (Ray Jackendoff) Ich habe schon mehrere ähnliche Stellen verschiedener Autoren zitiert. Zugrunde liegt ein bilaterales Zeichenmodell nach dem Muster: Hier ist das Wort - dort ist der Gegenstand, auf den es sich bezieht oder für den es steht. Also eine Existenzpräsupposition, die mit der Aboutness in herkömmlichem Verständnis verbunden ist. (Brentanos "Inexistenz") Man könnte es auch das eleatische Modell nennen, denn bei Parmenides und seiner Schule wird es vorausgesetzt. Platon hat sich damit herumgeschlagen, vor allem im "Sophistes", aber eigentlich zeitlebens. Wie kann man über Nichtseiendes sprechen? Wie kann man überhaupt etwas verneinen (= Nichtsein aussagen)? Die Lösung besteht darin, dieses Zeichenmodell aufzugeben. Damit entfällt auch das scheinbar Zwingende in der Ansetzung von "Repräsentationen". Aus behavioristischer Sicht kann ein solches Modell gar nicht erst aufkommen, das macht Skinners "Verbal Behavior" für Naturalisten so anziehend. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 16.11.2013 um 00.40 Uhr |
|
Man sollte eigentlich von »Saussure« oder Pseudo-Saussure sprechen, da die unter seinem Namen veröffentlichten Vorlesungen nachweislich nicht authentisch sind. Die eingangs gemachte Bemerkung trägt dem zwar Rechnung, bleibt dann aber ausdrücklich folgenlos. Daß es sich um eine (bloß) wissenschaftsgeschichtliche Frage handele, besagt auch nicht viel, denn was motiviert denn schon die Beschäftigung mit »Saussure«, wenn nicht dessen Bedeutung für die Geschichte der neueren Sprachwissenschaft?
|
Kommentar von Andreas Blombach, verfaßt am 15.11.2013 um 21.53 Uhr |
|
Ein schöner Text! (Vielleicht sollten Sie Ihr "Rechtschreibtagebuch" aber doch einmal umbenennen ...) Einige eigene Gedanken/Ergänzungen dazu: Beim Lesen von Saussure ist mir auch immer wieder aufgefallen, wie vage und unausgereift seine Begriffe oft bleiben (auch wenn viele Überlegungen und Ausführungen durchaus lesenswert sind). Die langue soll zugleich eine soziale Institution und rein psychisch sein – folgerichtig muss Saussure von einem "Kollektivbewußtsein" (S. 119) sprechen. Das klingt sehr nach Durkheim und ist hier wie dort gleichermaßen problematisch. Wissenschaftlicher Überprüfung ist ein solches Konstrukt nicht besonders zugänglich, worauf ja auch Ogden/Richards verweisen. (Allerdings scheinen sie individuelle geistige Vorgänge nicht problematisch zu finden, sonst würden sie wohl nicht am Thought in ihrem Zeichenmodell festhalten – wobei sie unter Thought auch schon Aufmerksamkeit auf etwas verstehen). Man kann natürlich – gegen Saussure – sagen, es gebe nichts als Einzelsprachen (und womöglich nicht einmal die, zumindest nicht als konsistentes "System"). Das wäre zwar deutlich näher an der Wirklichkeit, aber "das Deutsche", "das Französische" usw. sind doch oft nützliche Abstraktionen, die sich aufdrängen und über die man sprechen möchte. Das Problem an Saussures langue scheint mir weniger zu sein, dass sie abstrakt, über den einzelnen Individuen ist, als dass ihr die empirische Basis fehlt. Es spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, die Sprachgewohnheiten großer Gruppen zu untersuchen und dabei etwa zu beobachten, unter welchen Bedingungen bestimmte Äußerungen typischerweise hervorgebracht werden – das ist aber etwas ganz anderes, als Lautvorstellungen mit Vorstellungen verknüpft als Zeichen eines Systems zu betrachten (z.B., weil die gleiche lautliche Äußerung unter ganz verschiedenen Bedingungen auftreten kann und sich deshalb nicht einer Vorstellung oder Bedeutung zuordnen lässt, was auch immer das sein soll). Vorstellung, Inhaltsseite, signifié Saussure führt zwar mehrmals Beispiele wie au! oder nein an, geht aber bedauerlicherweise nicht recht darauf ein, was für eine Vorstellung denn eigentlich mit solchen Zeichen verbunden sei – die Vorstellung oder Inhaltsseite bei seinem berühmten Baum-Beispiel lässt sich mit einem Bildchen veranschaulichen, bei zahllosen anderen Wörtern (z.B. Abstrakta, Partikeln, Artikel, Konjunktionen) geht das offensichtlich nicht. (Und worin besteht eigentlich die Inhaltsseite eines Schriftzeichens? Saussure nennt die Schrift ja ausdrücklich als anderes, vergleichbares Zeichensystem, z.B. auf S. 142. Ist das berühmte bilaterale Zeichenmodell aus Ausdrucks- und Inhaltsseite nur ein Modell für einen bestimmten Bereich sprachlicher Zeichen?) Bedeutung und Wert (valeur) Bedeutung und Wert sind nicht synonym. "Geltung oder Wert, von der Seite des Vorstellungsinhaltes genommen, ist ohne Zweifel ein Bestandteil der Bedeutung, und es ist schwer, anzugeben, wodurch sich beides unterscheidet, obwohl doch die Bedeutung vom Wert abhängig ist." (S. 136) Diese Abgrenzung ist in der Tat schwierig, und ich bin mir nicht sicher, ob ich Saussure ganz folgen kann (oder ob er das selbst überhaupt ganz durchdacht hat). Um den Unterschied zwischen Wert und Bedeutung (vorher noch alternativ zu Vorstellung gebraucht) zu veranschaulichen, gibt Saussure u.a. das bekannte Schaf-Beispiel: franz. mouton kann die gleiche Bedeutung haben wie engl. sheep (womit er wohl meint, dass mit beiden Lautgestalten die gleiche Vorstellung verbunden sei), die beiden Wörter haben im Sprachsystem aber unterschiedliche Werte, weil sheep noch mutton neben sich hat, womit nur das zubereitete Fleisch bezeichnet wird, während im Französischen mouton auf Tier und Fleisch gleichermaßen anwendbar ist. Man könnte hier also auch vom Verwendungsbereich von Wörtern sprechen, aber das wäre Saussure vielleicht zu nah an der parole – also wohl eher etwas wie Begriffsumfang (aber was ist damit schon gewonnen?). Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie Saussure das eigentlich meint: Ist die Bedeutung das, woran man kontextunabhängig zuerst denkt, wenn man ein Wort hört (oder, meinetwegen, an dessen Lautgestalt denkt)? Dann hat er zumindest ignoriert, dass es Kontextunabhängigkeit eigentlich nie wirklich gibt – ein Franzose, der vernimmt, dass es zum Abendessen mouton gebe, wird dabei kaum an ein quicklebendiges Schaf denken (sofern er sich überhaupt irgendetwas bildliches vorstellt). Entspricht die Bedeutung der statistisch häufigsten Gebrauchsweise? Wie ist zu verstehen, dass die Bedeutung vom Wert abhängig sei? In manchen Einführungen wird einfach geschrieben, die Bedeutung eines Zeichens ergebe sich aus dem Sprachsystem, sei negativ bestimmt usw. – Bedeutung und Wert werden also gleichgesetzt. Ein Wort hat nach Saussure aber "nicht nur eine Bedeutung, sondern zugleich und hauptsächlich einen Wert, und das ist etwas ganz anderes" (S. 138). Diese Begriffsdifferenzierung scheint nicht nur mich etwas verwirrt zu haben, und sie wird auch nicht klarer, wenn Saussure auf S. 140 schreibt, "daß im Deutschen eine Vorstellung „urteilen“ mit einem Lautbild urteilen verbunden ist, mit einem Wort: es stellt die Bedeutung dar; aber diese Vorstellung ist, wohlverstanden, nichts Primäres, sondern nur ein Wert, der durch seine Verhältnisse zu andern ähnlichen Werten bestimmt ist, und ohne diese Verhältnisse würde die Bedeutung nicht existieren." Überhaupt erscheint mir das ganze Konstrukt der negativen Bestimmung von Zeichen ziemlich abenteuerlich. Die Idee, dass sich die Geltungsbereiche von Wörtern gegenseitig einschränken, ist im Grunde nicht schlecht. Wo man üblicherweise das eine Wort gebraucht, ist ein anderes schlechter oder gar nicht mehr anwendbar – und solche Verhältnisse können sich mit der Zeit verschieben, wenn etwa neue Wörter hinzukommen und die alten gewissermaßen von ihren Plätzen verdrängen. Praktisch lernen einzelne Sprecher Wörter aber gleich im Kontext kennen und verwenden sie selbst ähnlich – vom Einfluss anderer Wörter kann da eigentlich nicht die Rede sein. Gewiss lässt sich der Sprachgebrauch vieler Sprecher irgendwie so abstrahieren, dass einzelnen Wörtern gewisse Gebrauchsräume – Werte – zugewiesen werden, aber Saussures Ausdrucksweise lässt m.E. den Schluss zu, dass der Gebrauchsraum eines Wortes durch den der anderen bestimmt sei, und das ist eine Kausalität, die mir nicht einleuchten will. Kontext ist überhaupt etwas, was Saussure bei der negativen Bestimmung des Wertes von Zeichen zu ignorieren scheint. Auf S. 143 heißt es etwa, wesentlich sei bei der handschriftlichen Schreibweise des Buchstabens t nur, dass es von anderen Zeichen unterscheidbar sei – das trifft bei vielen Handschriften (und z.T. auch bei gedruckten Texten, wie ich aus Erfahrung mit OCR-Programmen weiß) im Einzelfall allerdings gar nicht zu, dank Kontext werden die Zeichen aber trotzdem richtig gedeutet. Assoziative Beziehungen Saussure spricht interessanterweise selbst noch nicht von syntagmatischen und paradigmatischen Beziehungen zwischen Zeichen (was ihm oft zugeschrieben wird), sondern von syntagmatischen und assoziativen. Syntagmatische Beziehungen bestehen zwischen Zeichen in einer Kette, assoziative – zunächst ganz allgemein und nicht etwa in Verbindung mit einem Syntagma – zwischen Wörtern, die etwas gemein haben. Diese Beziehungen sind also assoziationspsychologisch begründet und sollen im Gedächtnis bzw. im Gehirn (vgl. S. 147f.) bestehen. Weil sie aber der langue angehören sollen, müsste man wohl besser vom Kollektivgehirn o.ä. sprechen ... Nicht ganz klar wird bei Saussure, was er alles als assoziative Beziehungen auffasst. Seine Beispiele (auf S. 150f.) beziehen sich auf Ähnlichkeiten der Form (schmerzlich, lieblich, friedlich; Belehrung, belehren) und Ähnlichkeiten des Bezeichneten (Belehrung, Unterricht, Erziehung, Ausbildung), und er schreibt: "Jedes beliebige Wort kann jederzeit alles, was ihm auf die eine oder andere Weise assoziierbar ist, anklingen lassen." (S. 151) Wenn ich nun an ein Wort wie verirren denke, kann ich tatsächlich auf andere wie vertun, versetzen oder verschönern kommen, davor fällt mir aber verlaufen ein, das sowohl mit demselben Präfix beginnt als auch sehr ähnlich gebraucht werden kann. Davon ausgehend, komme ich allerdings schnell weiter zu Wörtern wie Labyrinth oder Wald, also zu Wörtern, die etwas bezeichnen, worin man sich leicht verirren oder verlaufen kann, und die häufig in denselben Syntagmen vorkommen wie die Verben. Typische Assoziationen sind das sicherlich, aber Saussure geht leider nicht darauf ein. In der Verbindung von syntagmatischen und assoziativen Beziehungen schließlich scheinen letztere den paradigmatischen, wie sie später genannt wurden, mehr oder weniger zu entsprechen. Es geht dann um die Austauschbarkeit von Elementen innerhalb von Syntagmen – Saussure selbst schreibt dazu nur wenig, insbesondere gibt er kein Beispiel zur Austauschbarkeit von Wörtern im Satz. Zweifelhaft ist, ob es wirklich in seinem Sinne war, bei der Austauschbarkeit nur von kategorialen Beschränkungen auszugehen, die viel zu abstrakt sind. Natürlich: Was bereits gesagt wurde, schränkt ein, was noch folgen kann. Wenn etwas nicht verstanden wurde (etwa aufgrund von Störgeräuschen), schränken das, was vorangegangen, und das, was gefolgt ist, ein, was es gewesen sein könnte. Doch die Rede von syntagmatischen und paradigmatischen Beziehungen ist dem Verständnis hier nicht wirklich zuträglich. Sprachliche Elemente lassen sich nicht beliebig substituieren, sondern werden von konkreten Kontexten und Situationen hervorgerufen. (Seitenangaben beziehen sich auf: Saussure, Ferdinand de: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Hrsg. von Charles Bally und Albert Sechehaye. Unter Mitw. von Albert Riedlinger. Übers. von Herman Lommel. 3. Aufl. Berlin [etc.]: de Gruyter, 2001.) |
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 06.11.2013 um 06.27 Uhr |
|
Wenn die Sonne dereinst zum Weißen Zwerg geschrumpft und alles Leben auf der Erde erloschen ist, dann wird auch das Wissen über das Universum verschwunden sein (sofern nicht irgendwo anders intelligentes Leben existiert). Das Universum wird dennoch ungerührt so weiterfunktionieren, wie es das schon getan hat, als es noch keine Menschen gab.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.11.2013 um 16.03 Uhr |
|
Nach dem Lexikon der Sprachwissenschaft von Hadumod Bußmann „trägt eine vereiste Fensterscheibe die Information, daß es friert.“ (3. Aufl. Stuttgart 2002:305). Daniel Dennett behauptet: „There is information about the climatic history of a tree in its growth rings – the information is present, but not usable by the tree.“ (Things about things) Das ist alles Unsinn, den Peter Hacker richtigstellt: „A great deal of information is amassed in the Encyclopedia Britannica. In that sense, there is none at all in the brain. Much information can be derived from a slice through a tree trunk, or from a geological specimen. And no doubt too from a dissection of a brain. But that is not information which the brain has. Nor is it written in the brain, let alone in 'the language of the brain', any more than the information 'in' the tree trunk about the severity of winters in the 1930s is written in arboreal patois.“ (Peter Hacker: „Languages, Minds and Brains“ In: Blakemore, Colin/Greenfield, Susan (Hg.): Mindwaves. Thoughts on Intelligence, Identity and Consciousness. Oxford 1987: 485-505, S.492f.) Aus allen Dingen kann man unbestimmt viel erschließen. Das heißt aber nicht, daß diese Informationen alle schon irgendwie in den Dingen vorhanden waren. Die Dinge enthalten keine Aussagen „über“ etwas, sondern allenfalls Spuren „von“ etwas. Ein Fingerabdruck „enthält“ keine Information. Er ist die Spur der Anwesenheit eines Menschen, und der Ermittler schließt daraus auf seine Täterschaft, aber diese Täterschaft ist nicht im Fingerabdruck irgendwie enthalten oder gar ausgedrückt. |
